
Interviews

Reinhold Andert
über die DDR-Singebewegung, die Weltfestspiele 1973 und die sozialistische Ikone Ernst Busch
„Honecker war Busch-Fan“
(Gespräch am 27. Februar 2006 in Berlin)
Reinhold Andert ist Jahrgang 1944. Er stammt aus Sömmerda in Thüringen. Nach der Grundschule besucht er das bischöfliche Vorseminar in Schöneiche bei Berlin, das er vorzeitig verlässt. Er beginnt eine Lehre als Orgelbauer in Gotha und holt in der Abendschule das Abitur nach. Von 1964 bis 1969 studiert er Philosophie und Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin und wird anschließend Dozent für Philosophie an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“. Nebenbei ist er in der Singebewegung aktiv und Mitbegründer des Oktoberklubs, der 1966 als Hootenanyklub gegründet worden ist. In dieser Zeit nimmt er auch erstmals bewusst Ernst Busch und seine Lieder wahr. Als ihm die FDJ 1971 anbietet, Leiter der Liedgruppe im Organisationskomitee der 10. Weltfestspiele zu werden, sagt er zu und wird für anderthalb Jahre zum „Lieder-Papst“ der DDR (O-Ton Andert). Nach den Weltfestspielen, die 1973 als eine Art „rotes Woodstock“ in Ost-Berlin über die Bühne gehen, arbeitet er als freischaffender Liedermacher und Schriftsteller, veröffentlicht Platten und Bücher. Im Jahr 1979 wird Andert, der 16 Jahre lang Mitglied der SED gewesen ist, aus der Partei ausgeschlossen und erhält Publikationsverbot. Seinen Beruf kann er bis zu seiner Rehabilitierung 1989 nur noch stark eingeschränkt ausüben. Einen seiner bemerkenswertesten Auftritte in dieser Zeit hat er bei der Trauerfeier für Ernst Busch im Jahr 1980 in der Akademie der Künste, an der auch die Politprominenz inklusive Erich Honecker teilnimmt. Nach der Wiedervereinigung reüssiert er als Autor dokumentarischer Texte, Aufsehen erregt das Buch „Der Sturz: Honecker im Kreuzverhör“, das sich mehr als 250.000 mal verkauft. Zusätzlich macht er Lesungen und gibt gelegentlich Konzerte.
Die Anerkennung für sein Mammut-Interview mit dem ehemaligen Staatsratsvorsitzenden der DDR habe sich eigentlich in Grenzen gehalten, erzählt Reinhold Andert vor Beginn unseres Gesprächs. Es habe Reaktionen gegeben von „Sie haben unsern Generalsekretär vorgeführt!“ über den Vorwurf „Geldmacherei!“ bis hin zu der Einschätzung, es handle sich hierbei immerhin um ein „notwendiges historisches Dokument“. Wir sitzen in Anderts Wohnung hoch über den Dächern von Berlin. Große Fenster, viele Bücher. Während er Kaffee macht, reden wir kurz über die technischen Probleme beim Transkribieren von Interviews. Andert berichtet, wie er mit seinen 40 Kassetten Honecker-Interviews verfahren ist. Er habe ein Computerprogramm zur Spracherkennung benutzt, das prima sei – nur leider habe das Programm das Genuschel des großen Vorsitzenden nicht verstehen können. Deswegen habe er alles, was Honecker gesagt hat, noch mal selber eingesprochen und es dann von dem Programm aufschreiben lassen. „Wenn man nicht perfekt Schreibmaschine schreibt, ist das ideal; das geht mindestens doppelt so schnell, wenn man sich das selber drauf quatscht.“ Ich darauf: „Bei 40 Kassetten dauert das wahrscheinlich immer noch lange genug.“ Andert: „Das ging ganz fix. Naja, ganz fix ist vielleicht etwas übertrieben …“
________________________________________________________________________
Bücher meines Gesprächspartners (Auswahl):
REINHOLD ANDERT: Lieder aus dem fahrenden Zug. Ost-Berlin (Henschel) 1978.
REINHOLD ANDERT / WOLFGANG HERZBERG: Der Sturz. Erich Honecker im Kreuzverhör. Berlin und Weimar (Aufbau) 1990.
REINHOLD ANDERT: Nach dem Sturz. Gespräche mit Erich Honecker. Leipzig (Faber & Faber) 2001.
________________________________________________________________________
Jochen Voit: In Ihrem Buch „Nach dem Sturz“ erwähnen Sie, dass Sie frühzeitig religiös und musikalisch geprägt worden sind. Ihr Elternhaus war katholisch, Ihr Vater hat Gitarre und Geige gespielt …
Reinhold Andert: … und Klarinette, Saxofon und alles Mögliche. Er hatte eine abgeschlossene Halbbildung auf allen Instrumenten. Er war pfiffig, aber das waren diese Dorfmusikanten früher immer. Mit Noten hatten sie nicht viel im Sinn, aber sie konnten improvisieren.
Von Beruf war er Schneider, und politisch hat er sich für die CDU engagiert.
Ja. Er war sogar Anfang der 60er Jahre Kreistagsabgeordneter. Wir waren in Bezirke und Kreise eingeteilt, vergleichbar mit den Landkreisen heute. Zunächst war er Vorsitzender der örtlichen CDU in Sömmerda, das war damals ein Ort mit 17.000 Einwohnern. Und die Heimatvertriebenen sind damals eben alle, weil es bei uns in der DDR keine Vertriebenenverbände gab, in die CDU gegangen. Die einheimischen Christen wären nie in so ’ne Partei gegangen – wozu auch? Aber für die Heimatvertriebenen war das genau richtig, die konnten dann ihre Feste als CDU-Ortsversammlungen tarnen. Mein Vater hatte ja im Grunde mit Politik nichts am Hut. Weder bei den Nazis noch später, er war völlig unpolitisch.
Trifft das auf Ihre Mutter auch zu?
Ja. Und zwar nach dem Motto: Gib dem Kaiser, was des Kaisers und gib Gott, was Gottes ist. Und sie hat im Grunde alles Gott gegeben. Der Kaiser interessierte sie nicht. Ich bin streng katholisch erzogen worden. Ich wollte ja Theologie studieren und Priester werden und bin mit fünfzehn Jahren nach Schöneiche bei Berlin aufs bischöfliche Vorseminar.
„Viel Frischobst und Fahrradfahren“ – Erziehung in der Klosterschule
Haben Ihre Eltern das unterstützt?
Aber klar, das ist doch für eine katholische Familie ein Glanzpunkt, wenn einer der Söhne Pfarrer wird … Ich musste sie leider enttäuschen …
Warum?
Das hatte viele Gründe. Das Ausschlag gebende war wahrscheinlich die Art des Umgangs dort mit uns. Und der Kirchenapparat, den wir durch unseren Rektor, das war der Bruder vom Erzbischof Bengsch, kennen lernten. Die ganze Atmosphäre war dermaßen spartanisch, und der Umgang mit uns war …, menschenfeindlich wäre vielleicht zu viel gesagt, aber so unchristlich im Grunde. Sodass ich mir gesagt hab: „Dieses Klerikale, diese Amtskirche, hat doch eigentlich mit dem Evangelium, mit dem Neuen Testament, nichts zu tun!“ Ich hab das dann ein Jahr vor dem Abitur und dem bevorstehenden Übergang ins Priesterseminar nach Erfurt abgebrochen.
Die Vorstellung, keusch leben zu müssen, hat Sie nicht geschreckt?
Das Zölibat hätte mir, glaube ich, weniger ausgemacht. Wahrscheinlich wären die großen Schwierigkeiten damit auch erst später gekommen. Aber ich hatte mit dem Thema Sexualität nicht allzu viel Schwierigkeiten. Es gibt ja auch Mittel und Methoden, darüber wegzukommen. Das haben die auch ziemlich geschickt gemacht: viel Frischobst und Fahrradfahren. (Lachen) Wir haben viel Sport getrieben und waren eigentlich immer beschäftigt. Da konnte vor lauter Betrieb keine Muße oder Melancholie aufkommen. Das war eine knochenharte Ausbildung! Erst später hab ich den Sinn verstanden, der natürlich in einer Doppelfunktion bestand: einerseits uns mit Wissen zuzuschütten und zweitens diese Zölibat-Problematik, die bei heranwachsenden Leuten ja anfängt, eine Rolle zu spielen, zu kaschieren.
„Ich wär auch Apotheker geworden“ – Berufsausbildung und Abitur
Dann haben Sie Orgelbauer in Gotha gelernt. War die Orgel für Sie noch eine Art Verbindung zur Kirche?
Nee, das war Zufall. Ich hatte ja nur neun Jahre staatliche Schulbildung, und eigentlich waren bei uns zehn Jahre Schulpflicht. Jetzt zählte ich mit meinen neun Jahren zu den ganz Doofen und kriegte keinen ordentlichen Beruf. Überall, wo ich mich bewarb, war die zehnte Klasse Voraussetzung. Dass ich von der kirchlichen Ausbildung her alle in die Tasche stecken konnte, nützte mir nichts. Und das einzige, was die bei der Berufsvermittlung vom Rat des Kreises für mich hatten, war diese Stelle in Gotha. Die Lehre dauerte zwei Jahre und war eine handwerkliche Ausbildung, die hatte mit Kirche oder Musik nichts zu tun. Ich wär auch Apotheker oder Drogist geworden, wenn die mich genommen hätten. Aber niemand nahm mich.
Welche Rolle spielte die Musik damals für Sie?
Wir haben zu Hause viel gesungen, vor allem Volkslieder. Meine Mutter war im Kirchenchor, mein Vater war Leiter des Kirchenchors und hatte ’n paar Kapellen, mit denen er zu irgendwelchen Volksfesten spielte. Und in diesem Klosterseminar wurde auch viel gesungen und mit der Klampfe gearbeitet – die Jugendpfarrer legten Wert drauf, dass in den Jugendgruppen viel gesungen wurde beim Wandern und am Lagerfeuer. Das haben wir auch gerne gemacht. Die Singerei gehört einfach zur katholischen Kirche. Ich war ja auch Ministrant und Oberministrant und in der Kirche wurde ja ständig gesungen. Musikalische Vorlieben hatte ich eigentlich in meiner Jugend keine speziellen … Beeindruckt haben mich diese Gregorianischen Gesänge, die uns unser Musiklehrer in Schöneiche beibrachte und die wir auch im Chor sangen. Für Schlager und Popmusik hab ich mich weniger interessiert. Ich hatte ja auch die Tanzschule verpasst, weil ich zu dieser Zeit im Kloster war. Da haben wir keine Mädels angefasst. Ich kann heut noch nicht tanzen. (…)
Wie begegnete man Ihnen bei staatlichen Stellen angesichts Ihrer kirchlichen Erziehung und Bildung?
Zunächst hatte ich ja das staatliche Abitur nachmachen wollen. Aber meine Bewerbung bei der Bildungsabteilung vom Rat des Bezirkes in Erfurt wurde schriftlich abgelehnt. Einigen anderen war es gelungen, in eine staatliche zwölfte Klasse zu kommen. Mir nicht …
Weil Sie kein Arbeiterkind waren?
Nein, das hatte ’62 schon nichts mehr damit zu tun. Ich war ’n bissl stur. Ich hatte da immer so ein Kreuz am Rockaufschlag, und dieses Demonstrative gefiel wahrscheinlich den Leuten nicht, als ich mich dort mal vorstellen musste. Und so hat man mich abgelehnt. Naja, das war auch gar nicht schlimm, denn es gab ja in der DDR diesen sogenannten zweiten Bildungsweg über die Volkshochschule. Davon hörte ich, als ich in Gotha war, und besuchte dann parallel zur Lehre die Abendoberschule und machte das Abitur. Und bei der Aufnahme an dieser Volkshochschule wurde überhaupt nicht gefragt, wer man politisch war. Die wollten nur wissen, welche Klasse man zuletzt besucht hatte. Das war eine wunderbare Situation, weil dort auch sehr gute Leute waren. Und wenn man dieses Abitur hatte, dann hatte man bessere Chancen, an der Uni aufgenommen zu werden, als mit dem normalen Abitur. Weil die Leute an der Uni sagten: „Dem isses wirklich ernst mit dem Studium; der hat sich nach der Arbeit, während andere zum Tanzen gegangen sind, noch hinter seine Bücher gesetzt und dieses Abi geschafft.“ Du hattest also doppelt so gute Chancen. Das heißt: Wenn mir heute jemand erzählt, er sei in der DDR benachteiligt gewesen und aufgrund seiner Weltanschauung nicht zum Studium zugelassen worden, dann lügt der frech. Das stimmt gar nicht. Das muss man wissen, wenn man über die DDR redet: Leute, die so was behaupten, sind Scharlatane, die sich im Nachhinein eine Widerstandsrente herbeireden wollen. (lacht) Und Ihr fallt darauf rein, weil Ihr oft keine Ahnung habt – das kann man ja auch nicht erwarten, aber es ist nun mal so.
„Ins Grübeln gekommen“ – Abkehr von der Kirche und Politisierung
Haben Sie die Orgelbauer-Ausbildung trotzdem fertig gemacht?
Nee. Als ich im Frühjahr ’64 das Abitur in der Tasche hatte, hab ich mir gesagt: „Wozu brauch ich jetzt noch den Orgelbauer-Abschluss, wenn ich sowieso nach Berlin zum Studieren gehe?“ Ich habe mich dann aber erst bei so einem Großbetrieb in Gotha als Hilfsarbeiter beworben, um mal in der Produktion rum zu schnuppern und um etwas Geld zu verdienen.
Waren Sie als Abiturient bereits an Politik interessiert? Kannten Sie zum Beispiel schon politische Lieder?
Das muss in dieser Zeit angefangen haben. Eigentlich war ich ja ein Feind der DDR und des Sozialismus, weil das eine atheistische Weltanschauung war, dieser Marxismus. Und ich hab mich für politische Dinge bis 1964 nicht interessiert. Das änderte sich dann durch Freunde und Bekannte, kurz bevor ich nach Berlin ging. Geistig interessiert war ich ja immer, und als ich mich dann öfter mit Leuten in Gotha getroffen hab, die ziemlich gebildete Marxisten waren, bin ich schon ins Grübeln gekommen. Ich habe überhaupt damals Menschen kennen gelernt, SED-Genossen, die sich unheimlich menschlich und ganz normal mir gegenüber verhalten haben. Leute wie zum Beispiel der Direktor der Volkshochschule, die meinem Antikommunismus die Spitze abbrachen, indem sie mich ins Leere laufen ließen und ganz freundlich mit mir umgingen. Ich bin ja in den ersten Jahren öfter an Idioten geraten und hab gesagt gekriegt: „Bekennende Christen haben bei uns nichts zu suchen!“
Hatten Sie Auseinandersetzungen zu Hause, als Sie anfingen, sich von der Kirche abzuwenden?
Ich bin ’64 sogar aus der Kirche ausgetreten. Das hat meiner Mutter sehr wehgetan. Im Nachhinein hab ich diesen Schritt ungeheuer bedauert. Denn man muss nicht unnötig jemandem wehtun.
Ihre antikommunistische Haltung hatten Sie also bereits vor Antritt Ihres Studiums der Geschichte und Philosophie abgelegt …
Ja. Ich bin noch in der Zeit, als ich in diesem Großbetrieb in Gotha arbeitete, dort in die SED eingetreten, ich wurde Kandidat. Meine Meinung war: Wenn man was verändern will, und ich hatte ein großes Veränderungsbedürfnis was die DDR anlangte, kann man das eigentlich nur innerhalb dieser Gruppe machen, die überall das Sagen hat. Das funktionierte leider nur bis zu einem gewissen Grad …
Die Partei Ihres Vaters hat Sie nicht interessiert?
Überhaupt nicht, das war ein Idioten-Verein, wie gesagt eine Tarnorganisation für die Heimatvertriebenen. Die waren weder christlich noch sozialistisch. Diese Blockparteien waren im Grunde eine Ausrede für Leute, die ein staatliches Amt haben wollten oder ihre Ruhe, weil sie ein staatliches Amt hatten, und aber nicht in die SED wollten. Mit Politik hatte das wenig zu tun.
„Mein Nachbar war Thierse“ – Student in den 60ern in Ost-Berlin
Als Sie dann nach Berlin gingen, war gerade die Singebewegung im Entstehen. Wie muss man sich das vorstellen, als es losging mit den Hootenanny-Klubs?
Das begann ungefähr ’64, und ich war so ziemlich von Anfang an dabei. Das ging von Leuten aus, die mit mir studierten, also entweder Philosophie oder Kulturwissenschaft. Die Kulturwissenschaftler hatten ja die ersten beiden Jahre gemeinsam mit uns Grundlagen der marxistisch-leninistischen Philosophie. Mein Nachbar damals war übrigens Wolfgang Thierse, der immer kam und mich überreden wollte, dass ich in die katholische Studentengemeinde mitkomme. Ich habe das abgelehnt, weil mich kurz vorher ein paar andere Leute ebenfalls gebeten hatten, dorthin zu gehen und die Ohren auszufahren und ihnen zu berichten, was dort geredet wird …
Die Stasi hatte Sie angesprochen …
Genau. Und denen hatte ich gesagt: „So was mach ich nicht; erstens sind die Katholiken keine Staatsfeinde, (…) und zweitens ist mir diese Art der Mitarbeit suspekt. Ich arbeite gern mit euch zusammen und kann euch informieren und berichten, wie das so läuft in der katholischen Kirche, das mach ich gerne. Aber da hingehen, horchen und petzen – das ist nicht mein Bier.“
An allgemeinen Erklärungen über die katholische Kirche waren die Leute von der Staatssicherheit wahrscheinlich weniger interessiert …
… ,weil sie selber ihre Meinung schon hatten. Also kam es zu keinerlei Zusammenarbeit. Das habe ich dem Thierse dann andeutungsweise gesagt, und das verstand er auch und ließ mich dann in Ruhe. (lacht)
Kommen wir noch mal zurück zur Singebewegung. Wie ging das los?
Initiatoren waren vor allem diese Kuwi-Leute um Lutz Kirchenwitz. Zum Teil waren das seine Schulkameraden aus der Oberschule, mit denen er gemeinsam so ein Programm mit Lyrik und Songs in der Volksbühne im dritten Stock gemacht hatte. Daraus entstand dann der Gedanke, so was regelmäßig zu machen … Dann kamen der Kanadier Perry Friedman mit seinem Hootenanny dazu und die Holländerin Lin Jaldati mit ihren jiddischen Liedern, die von ihrem Mann Eberhard Rebling auf dem Klavier begleitet wurde. Wir anderen waren ja alle blutige Laien … Aber das waren so die ersten Leuchttürme dieser beginnenden Bewegung. Lin Jaldati war mit Anne Frank in Bergen-Belsen und Auschwitz gewesen und hatte überlebt. Lin war eine Institution, wenn die auf die Bühne kam und anfing zu singen, dann spürtest du, wie es dir den Rücken runter lief, das war unglaublich. (…) Sie und ihr Mann waren übrigens auch mit Ernst Busch befreundet.
Hatten Sie damals schon Kenntnis von Busch und seinen Liedern?
Nur aus der Ferne hatte ich davon gehört. Richtig bewusst wahrgenommen habe ich ihn, glaube ich, erst später. Den Namen kannte ich natürlich und auch einige Lieder, aber ich wusste wohl noch nicht, dass es Lieder waren, die er gesungen hatte …
„Mit Klampfen, Waschbrettern und Banjos“ – Der Erste Mai 1965
Wie sind Sie nun zur Singebewegung gekommen?
Für mich war eigentlich der Erste Mai ’65 entscheidend. Da sind wir durch die Straßen marschiert und hatten statt Blasmusik alle irgendwelche Klampfen, Banjos und Waschbretter dabei und haben Ostermarschlieder gesungen. Das war eine bunte Mischung von Liedern, da waren auch amerikanische Protestsongs von Pete Seeger dabei und anderes. Wo wir die Lieder herhatten, weiß ich gar nicht. Wir hatten uns jedenfalls vorher zusammengesetzt und ’n bissl geprobt.
Wissen Sie noch, welche Songs Sie damals gesungen haben?
„Unser Marsch ist eine gute Sache, weil er für eine gute Sache ist“, (fängt an zu singen) ba-da-damm-bamm-bamm-bada-ba-damm-bamm … „Marschieren wir gegen den Osten? Nein! Marschieren wir gegen den Westen? Nein! Wir marschieren für die Welt, die von Waffen nichts mehr hält …“ – so hieß der Refrain. Und sind dann gleich kritisiert worden von unserem Parteisekretär: (polternd) „Was heißt hier ’Marschieren gegen den Osten’? Selbstverständlich auf keinen Fall! Wo wollt ihr denn hinmarschieren? Ihr seid wohl verrückt!“ (lacht) Der hatte den Text wörtlich genommen und nichts kapiert. Da dachte ich mir: „Guck mal an, man muss sich also gut überlegen, was man singt.“ Das war ich ja von der Kirche her nicht gewöhnt. Einigen wenigen, die da mitmarschiert sind, stieß das auf, was wir sangen. Aber den meisten hat ’s gefallen, das war ein frischer Ton und eine frische Musik. Wir sind da Unter den Linden lang marschiert und zum Schluss an diesem Marx-Engels-Platz an der Tribüne vorbei. Und die ganze Zeit haben wir diese Lieder gesungen.
Konnte man sich in diesem Riesenumzug mit Gitarren überhaupt Gehör verschaffen?
Das haben natürlich in erster Linie die Umstehenden mitgekriegt, also die da unmittelbar mitmarschierten. Du konntest ja machen, was du wolltest, bei diesem Ersten Mai. Das BE ist zum Beispiel immer mit dem Auto gefahren, da hat die Weigel drin gesessen und hat gewunken. Jeder hat sich irgendwas einfallen lassen, das war wie ein Faschingsumzug – na ja, nicht ganz so bunt … Danach, als sich alles anfing zu verflüchtigen und die ersten nach Hause gegangen waren, haben wir noch irgendwo gesessen und gesungen, und da kamen ein Haufen Leute und haben zugehört. Da entstand dann diese Idee, was Größeres draus zu machen. Und den Namen „Hootenanny“ hatten wir von Perry Friedman. Der Hootenanny-Klub wurde aber ’67 in Oktoberklub umbenannt, weil sich der Paul Verner (Stadtverordneter in Berlin und Mitglied des Politbüros; JV) beschwert hatte. Da gab es wieder mal so ’ne Kampagne gegen Anglizismen. Außerdem war gerade der 50. Jahrestag der Oktoberrevolution, da hieß auf einmal alles Oktober … Eigentlich war es ja auch egal, wie es hieß, man hätte es auch Spiegelei nennen können.
Gehörten damals auch Busch-Lieder zum Hootenanny-Repertoire?
Ich glaube, ein paar Spanienlieder wurden gesungen. „Die Herren Generale“ war wohl von Anfang an dabei.
„Propagandist der Weltanschauung“ – Andert und der Oktoberklub
Waren Sie auf der ersten Schallplatte vom Oktoberklub schon mit dabei?
Nee, da war ich nur auf dem Foto, das vorne drauf ist. Da gibt es übrigens einen schönen Dokumentarfilm von holländischen Filmemachern, die sich nach der Wende vier Leute, darunter auch mich, von diesem Coverfoto rausgepickt haben und ein Porträt über die gemacht haben. („Sag mir wo du stehst“) Jedenfalls bin ich erst später auf Platten zu hören gewesen. Ich glaube, ich bin erstmals aufgetreten mit Wanderliedern aus den 20er Jahren. Da wurde bei den Hootenanny-Veranstaltungen gefragt: „Wer is‘ ’n jetzt dran?“ Und als sich keiner meldete, hab ich mir die Klampfe geschnappt, um kein Loch entstehen zu lassen, und hab losgelegt. Ich hab nie eine gute Stimme gehabt, und meine Klampfenkünste waren auch nicht so besonders. Aber mir war die Sache wichtig. Ich hab diese ganze Singerei aus einem ganz andern Aspekt gesehen. Erstens hat es Spaß gemacht und zweitens hab ich das auch als Philosoph gesehen, das heißt: als Propagandist der Weltanschauung. Ich hab mich zumindest so verstanden. Es sollte nicht nur darum gehen, irgendwelche Ideen zu verkaufen, sondern Leute zu ändern. Leute, die in der Lage sind, Ideen aufzunehmen. Und diese Singerei schien mir da eine gute Möglichkeit zu sein. Die Hootenanny- oder später die Singebewegung war eine sehr demokratische Angelegenheit, weil jeder ohne viel Vorbereitung aktiv teilnehmen konnte. Drei Griffe lernt man schnell, dafür muss man nicht Musik studieren, und singen kann im Grunde auch jeder. Also kann sich jeder da vorne hinstellen und den Leuten was erzählen beziehungsweise vorsingen. Und das formt unheimlich die Persönlichkeit. Man verliert Hemmnisse und Scheu und lernt, die Aufregung in den Griff zu kriegen. Das hätte vielen Leuten sehr gut getan, da mal aufzutreten.
Geschah das ganz ohne Wettbewerbsgedanken?
Völlig ohne. Das spielte überhaupt keine Rolle. Ich hab mich der Sache sowieso eher von der soziologisch-philosophischen Ecke genähert. Ich dachte mir: „Da machste mit und gibst Obacht, dass das alles gut läuft!“ Und dass wirklich dieser Zweck erfüllt wird, den ich mir da vorgestellt hatte.
Wenn man den Film „Lieder machen Leute“ von Karl Gass aus dem Jahr 1968 sieht, in dem der Oktoberklub porträtiert wird, hat man den Eindruck, dass sich frühzeitig bestimmte Leitfiguren herausbildeten. Hartmut König steht da zum Beispiel sehr stark im Zentrum. Hatte er eine besondere Rolle?
Er war der erste, der anfing, eigene Lieder zu schreiben, die uns gefielen. Damit war er natürlich der Star. Wir sangen ja am Anfang immer nur Lieder von anderen oder alte Lieder. Und er kam da frisch, frank, fröhlich mit eigenen Sachen, hatte auch seine eigene Truppe, Team 4; die wurde dann im Zuge dieser Anglizismus-Phobie umbenannt in Thomas Natschinski und seine Gruppe. Ich fand diese Lieder prima, die damals entstanden. Eines von Hartmuts ersten Liedern war „Sag mir, wo du stehst“, den Titel hatte er geklaut von „Which Side Are You On“. Das war ein absoluter DDR-Hit, den haben dann alle Gruppen nachgesungen. Sogar in der Kirche wurde er gesungen, und da fiel einem dann auf, dass der Text dermaßen allgemein war, dass er eigentlich immer passt. Das ist natürlich auch ein Problem, weil dieses Lied schlimmstenfalls auch die Nazis singen können. (lacht)
Welche Rolle spielte die FDJ in der frühen Singebewegung?
Zunächst war das ziemlich FDJ-fern. Wobei von Anfang an einer aktiv dabei war, der hieß Siegfried Wein, und der war zuständig für Kultur in der FDJ-Bezirksleitung. Aber der war mittendrin, der kam nicht von außen. Und dann gab es eine Fernsehsendung in der Volksbühne, als wir uns in Oktoberklub umbenannten, inzwischen gab es schon Hootenanny-Klubs in der ganzen Republik, und nun wurde die ganze Sache DDR-weit bei allen möglichen Leuten bekannt. Die Folge war, dass sich der Zentralrat der FDJ einschaltete und uns erzählte, wir sollten mehr Arbeiterlieder singen und nicht nur immer Volkslieder und so ’n Quatsch. Das ging so bis zum Schluss, und das wurde immer perverser: diese Einmischung der FDJ und diese Versuche der Instrumentalisierung, sodass ich mich schließlich nach ’73 von der ganzen Angelegenheit verabschiedete. (…)
(Ende der ersten Kassettenseite)
(Exkurs über die Frage nach dem Gefühl einer Generationenzugehörigkeit sowie über Reinhold Anderts Dozententätigkeit an der Musikhochschule)
„DDR-konkret“ – Neue politische Lieder für die Singebewegung
Was hat Sie bewogen, dann selber Lieder zu schreiben?
Das war ein ganz konkreter Anlass. Es gab damals eine DDR-weite Studentenzeitung von der FDJ, die hieß Forum. Und der Chefredakteur Hilbig, den ich gut kannte, sagte zu mir: „Schreib mal ’nen Artikel über diese neu entstandene Singerei.“ Das hab ich dann gemacht, das muss ’67 gewesen sein, und habe geschrieben, dass eigentlich die meisten Lieder, die wir singen, uns gar nicht gemäß seien. Mich störte vor allem die veraltete Symbolik in den traditionellen politischen Liedern. Da ist immer die Rede vom Klassenkampf, der auf der Straße stattfindet mit einer Fahne in der Hand und der Sonne, die gerade im Osten aufgeht. Ich hab gesagt: Für uns junge Leute sind andere Dinge wichtig. Die Kämpfe meiner Generation, wenn man so will, vollziehen sich doch anders. Also beim Aufbau einer neuen Gesellschaft kann man nicht immer mit diesen antiquierten Symbolen ankommen. Das hatte mit unserem Leben in der Gegenwart nichts mehr zu tun, das war Geschichte. Darum hab ich gesagt: „Wir müssen neue Lieder schaffen, die unseren konkreten Bedingungen gemäß sind.“ Und so entstand der Begriff „DDR-konkret“, den ich da prägte, in diesem Artikel. Das hieß: konkrete Wirklichkeit einfangen in Verse, um Lieder draus zu machen. Der Chefredakteur hat mir das Ding zurückgegeben und gesagt: „Sehr schön, aber das ist ja nur die eine Seite. Jetzt hätte ich gerne noch ein Beispiel, damit man sieht, wie du das meinst.“ Ich sag: „Ich kann doch nicht reimen.“ Darauf er: „Mach mal, sonst nehme ich dir den Artikel nicht ab.“ (lacht) Naja, und weil ich natürlich eitel war und den Artikel veröffentlicht sehen wollte, hab ich mich hingesetzt und nach dem Motto „Reim dich, oder ich zerhack dir die Kommode!“ einen Text geschrieben: „Das Lied vom Klassenkampf“, mein erstes Lied überhaupt. Das wurde dann abgedruckt, ich hatte auch eine Melodie drunter gefummelt, und der Oktoberklub war dermaßen begeistert, dass sie es gleich in ihr Repertoire aufnahmen. Ich wollte das erst selber singen, aber dann haben die gesagt: „Nee, nee, mit deiner Stimme kannste Briketts zählen, aber nicht auf die Bühne.“ Na gut, hab ich mir gesagt, is ja auch nicht so wichtig. Ich wollte mich auch nicht vordrängeln. Und dann fiel Jörn Fechner mal aus, der Schönling mit der schönen Stimme, das war während einer Tournee auf Rügen … Das Lied war aber im Programm und mittlerweile auch ziemlich bekannt. Und weil ich der einzige war, der es konnte, bin ich dann auf die Bühne und hab da rumgeschrieen, weil ich dachte: Je intensiver, desto besser. Aber das ist natürlich ein Lernprozess, so ’n Lied zu interpretieren.
Wie oft fanden solche Oktoberklub-Tourneen statt?
Jedes Jahr. Immer in den Semesterferien, wir waren ja Studenten. Und die Veranstaltungen fanden in irgendwelchen Theater- und Kulturhaussälen statt und waren immer proppenvoll. Weil wir auch immer viele deutsche Volkslieder gesungen haben und internationale Folklore, gefiel das den Leuten. Das waren schöne Abende, es gab immer viel zum Mitsingen, da war eine unheimliche Stimmung. Und zwischenhinein wurden immer ein paar politische Lieder gestreut. Der „Oktobersong“ und solche Sachen … (…)
Was kam denn am besten beim Publikum an?
So Scherzlieder wie „Jedermann liebt den Samstagabend“. Oder ungarische und finnische Lieder, da konnte man zwar keinen Text verstehen, aber die waren recht flott. Und es war ja für die Leute auch ein neuer frischer Ton und ein ungewohntes Bild: zehn Leute auf der Bühne mit drei bis fünf Instrumenten; eine sparsame Gitarre, ein Banjo dazu und ein Bass höchstens noch ’ne Rassel. Und es war kein steifer Chorgesang, es war auch nicht die große Kunst, manchmal gab es eine zweite Stimme dazu, aber das war ’s. Ich meine, musikalisch war das in Ordnung. Unser Gitarrist Fred Krüger studierte Gitarre an der Musikhochschule, der Bassist studierte auch Bass. Also, das war keine ganz plumpe Laiengeschichte, sondern das war zum Teil schon halbprofessionell.
Hatten Sie Vorbilder?
Nein, eigentlich nicht. Wir haben uns natürlich schon die Originaltitel angehört. Wir haben ja auch englische und amerikanische Lieder gesungen, Lieder von Bob Dylan und Pete Seeger, „We Shall Overcome“, Antikriegslieder wie „Sag mir, wo die Blumen sind“ und was weiß ich alles. Einmal hat uns sogar Pete Seeger besucht, da hießen wir noch Hootenanny-Klub. Der fand das prima, was wir machten. Da hab ich noch eine Fernsehaufzeichnung hier, der kriegte hier irgend so einen Preis vom Friedensrat. Jedenfalls hat Pete Seeger dann mit uns einen Singeabend in dem Kulturpalast in der Stalinallee gemacht, und anschließend haben wir gezeigt, dass wir auch ein paar Lieder können. Das Fernsehen hat das aufgenommen. (…) Einmal sind wir auch mit Ernst Busch zusammen aufgetreten, das war in der Kongresshalle, glaube ich. Da war der Busch schon recht alt, er hat vor dem Auftritt, als sich ihm jemand in der Garderobe vorstellte, gefragt: „Welche Zelle bist ’n du?“ Das war die alte Einteilung in der KPD, er hielt das nicht mehr so ganz auseinander.
„Man hat sich ’n bissl was vorgemacht“ – Verfälschte Wahrnehmung
Im Booklet zur Oktoberklub-CD, die bei Barbarossa erschienen ist, erzählen Sie von einer Autofahrt in den frühen 70er Jahren mit einer Bäuerin, die zu Ihnen gesagt hat, dass sie die Folklore gerne mag, die der Oktoberklub singt. Die politischen Sachen fände sie weniger gut. Noch später haben sie dann herausgefunden, dass es geheime Fragebögen gab, die diese Aussage auch in Bezug auf die Jugend der DDR bestätigten. Waren die politischen Songs vielleicht doch nicht so zündend, wie Sie dachten?
Das ist richtig. Man hat sich da ’n bissl was vorgemacht. Fünf Prozent der Leute waren Fans dieser Lieder, fünfundneunzig Prozent haben sich nicht dafür interessiert. (…) Die Resonanz, die wir beim Oktoberklub kriegten, war natürlich zustimmend. Diejenigen, denen das nicht gefallen hat, sind halt aus dem Konzert raus gegangen oder sind gar nicht erst gekommen.
War das Agitprop, was Sie gemacht haben mit dem Oktoberklub?
Ja, natürlich. Die Motive der einzelnen Mitglieder waren natürlich unterschiedlich. Aber mein Motiv damals war Agitprop.
Welche Rolle spielten die Vorläufer aus den 20er, 30er Jahren?
Eigentlich war uns diese Art des Agitprop wenig vertraut. Man wusste, dass es so was gegeben hatte. Aber man hatte wenig Ton- und Filmbeispiele. Außerdem war uns das meiste auch zu direkt und zu hölzern. Wir wollten mehr von hinten durch die Brust ins Auge. Das sollte mehr indirekt passieren. Aber wir wollten die Leute schon überzeugen von unserer Weltanschauung. Und diese offizielle Vermittlung unserer Weltanschauung, des Marxismus-Leninismus, war viel zu spröde und ging auch an den Sprachgewohnheiten der Leute vorbei. Das gefiel uns nicht. Und wir dachten: Die ist doch gar nicht so volksfeindlich, diese Weltanschauung, ganz im Gegenteil; das müsste man nun auch sprachlich und musikalisch versuchen, zum Ausdruck zu bringen … Dazu gehörte auch der Gedanke: „Wer stark ist, kann auch über sich selber lachen.“ Humor empfanden wir als Ausdruck der Stärke.
Sind Sie mit dem Oktoberklub auch im Ausland aufgetreten?
Selten, ich gehörte ja nicht zur Kerngruppe des Oktoberklub.
War der Oktoberklub auch im Westen?
Ja, bei DKP-Geschichten, Pressefesten und so. Da war ich aber nie mit.
„Ich war der Lieder-Papst!“ – Die Weltjugendfestspiele 1973
Wie ging es dann mit Ihren eigenen Liedern weiter? In den Klappentexten Ihrer Bücher steht: „Seit ’73 freischaffender Schriftsteller und Liedermacher.“ Wann haben Sie beschlossen, das professionell zu machen?
Naja, nach dem „Lied vom Klassenkampf“ merkte ich, dass das gar nicht so schwer war: Lieder zu machen. Und dann hab ich eins nach dem andern gemacht. Erst für den Klub und dann mehr für mich. Ich hab dann mit Solo-Geschichte angefangen. Freischaffend war ich aber erst ab ’73, weil ich bis dahin für die FDJ gearbeitet habe. Und zwar habe ich im Frühjahr ’71 geheiratet, und zu meiner Hochzeitsfeier kamen die Chefs der FDJ und überredeten mich, hauptamtlich bei der FDJ anzufangen und ihnen bei den Vorbereitungen für die 10. Weltfestspiele zu helfen. Günther Jahn war damals erster Sekretär des Zentralrats der FDJ, und der machte mich zum Leiter der Liedgruppe im Organisationskomitee der Weltfestspiele. Ich wurde kooptiert, so nannte man das, bekam ein Büro, konnte vier, fünf Leute einstellen und kriegte das Gehalt eines Abteilungsleiters im Zentralrat. Ich habe mich also freistellen lassen von der Hochschule, wo ich Dozent war, und hab das bis zu den Weltfestspielen ’73 gemacht. Danach hatte ich einfach keine Lust mehr, in meinen alten Beruf zurück zu gehen, weil ich in diesen anderthalb Jahren durch diese Arbeit unheimlich bekannt geworden bin. Ich hatte für kurze Zeit eine wahnsinnige kulturpolitische Macht: Ich hab bestimmen können, was im Fernsehen und im Rundfunk für politische Lieder laufen. Ich war also der absolute Papst, der Lieder-Papst! (lacht) Und die kamen alle angerannt zu mir – mir wurde zwischendurch ganz himmelangst vor dieser Machtfülle, die ich plötzlich hatte. Ich hatte auch einen unheimlich guten Draht zu Leuten im Politbüro, vor allem zu Werner Lamberz, der ja als Thronfolger Honeckers gehandelt wurde.
Wie kamen Sie zu diesem guten Draht?
Durch Veranstaltungen, an denen die als Offizielle teilnahmen. Ich war ja nun der Chef aller großen Singe-Veranstaltungen, ich machte das Programm und war der Ansager. Und die mochten das, wie ich das aufzog. Ich hatte auch gute Kontakte zu Paul Dessau und allen möglichen Leuten. Weil ich vorher schon Lieder geschrieben hatte, die von Dichtern und Komponisten der DDR akzeptiert worden sind, hab ich die auch alle besucht und gebeten, ob sie nicht Lieder für die Weltfestspiele schreiben können. Das haben die auch alle gemacht, also ich hatte einen guten Stand bei den Künstlern, auch bei Rock-Leuten wie Renft. Für mich war das damals eine prima Zeit.
Kamen Sie im Vorfeld der Festspiele überhaupt zum Lieder-Schreiben vor lauter Organisieren?
Ja, natürlich. Die wesentlichen Weltfestspiel-Lieder habe ich selber geschrieben. Allerdings alle anonym oder mit der Angabe „Kollektiv“ oder so, denn das hätte ja sehr albern ausgesehen, wenn da überall mein Name dabeigestanden hätte, wo ich doch die Macht über das Liederprogramm hatte. Bei der Hymne der Weltfestspiele „Wir sind überall auf der Erde“, die hundertprozentig von mir ist, habe ich zum Beispiel den Hartmut König als Texter angegeben, damit das nicht so aussieht, als würde ich meine Macht missbrauchen. Das Lied wurde in zehn Sprachen übersetzt und bei der Abschlussveranstaltung von 10.000 Leuten hier drüben auf dem Platz (zeigt aus dem Fenster) gesungen.
Was war das für ein Gefühl, das eigene Lied bei dieser Massenkundgebung zu hören?
Das war sehr eigenartig … (…)
(Exkurs über Hartmut König und den Internationalen Studentenbund in Prag sowie den Weltbund der demokratischen Jugend in Budapest)
Wie sah denn das Musikprogramm aus, das Sie für die Weltfestspiele entwickelt haben?
Wir hatten drei Kategorien von Liedern. Die erste enthielt Lieder, die bei uns entstanden waren und die etwas über die DDR erzählten, so nach dem Motto: „So sehen wir unser Land“. Das war als Visitenkarte für unsere ausländischen Gäste gedacht. Die zweite war internationale Folklore, und die dritte Kategorie waren Lieder, die direkt für die Weltfestspiele gemacht waren wie „Wir treffen uns auf jeden Fall“. Darüber hinaus gab es natürlich Künstler aus dem Ausland, die bei den Festspielen auftraten wie Miriam Makeba aus Südafrika oder Dieter Süverkrüp aus der Bundesrepublik. Es gab innerhalb der Festspiele auch so ’ne Art Festival des politischen Liedes, da traten die auf.
Welche politische Funktion hatten die Weltfestspiele 1973, und welchen Stellenwert hatten speziell die Lieder?
Die Weltfestspiele fanden alle vier Jahre wie die Olympischen Spiele statt, und die wurden immer von einem anderen Land ausgerichtet. Und ’73 waren wir eben dran, zum zweiten Mal übrigens, nachdem sie ’51 auch schon hier waren. Und dass Musik eine große Rolle spielt, wenn sich die Jugend trifft, ist ja klar. Und die Lieder, die wir extra für dieses Ereignis gemacht haben, waren dazu da, den Gedanken der Weltfestspiele in die DDR-Öffentlichkeit zu tragen. Das waren so was wie Werbelieder, wir wollten Propaganda machen für dieses Ereignis: „Passt auf, im Sommer ’73 wird die Jugend der Welt hier in Berlin zu Gast sein, stellt Euch drauf ein, das wird ’ne prima Sache!“ Dieser Gedanke sollte unters Volk gebracht werden mit anständigen Liedern, die, wenn ’s geht, einigermaßen locker und lustig sein sollten. Das war die Funktion. (…)
„Über Kopp und Herz zum Mund“ – Beliebtheitsgrad der Lieder
Mit dem Ende der Weltfestspiele ’73 endete auch Ihre Mitgliedschaft im Oktoberklub …
Ich hatte mich schon vorher allmählich verabschiedet und hab dann ’73 offiziell Schluss gemacht. Weil der Einfluss der FDJ auf die ganze Singebewegung, den ich ja zum Teil mit verschuldet hatte während dieser anderthalb Jahre, wo ich für die Weltfestspiele gearbeitet habe, immer größer wurde. Wobei ich immer Obacht gegeben habe, dass dieser Einfluss nicht schädlich war. Ich hab gesagt: „Redet den Leuten nichts ein! Lieder, die sie nicht singen wollen, sollen sie auch nicht singen. Das, was über ihre Lippen kommt, muss vorher übern Kopf und übers Herz, und wenn sie ’s dann gut finden, dann sollen sie ’s singen. Aber alles andere nicht!“ Das war der große Zwiespalt, den ich damals hatte, und ich hab mich in dieser Frage auch mit dem Zentralrat der FDJ überworfen. Und war der einzige, der zum Schluss keine Medaillen oder Orden kriegte, während alle Leute mit Klunkern vollbehangen wurden. Dabei hatte ich gute Arbeit geleistet. Kultur-Soziologen aus Leipzig haben festgestellt, das die 10. Weltfestspiele das einzige Treffen dieser Art war, wo Lieder entstanden sind, die von den Jugendlichen freiwillig und gern gesungen wurden. Bei den anderen Weltfestspielen war das nicht der Fall. Da wurden die Lieder den Leuten reingedroschen, und die mussten sie sich unter großen Mühen aneignen.
1951 wurde, so hat man mir erzählt, Buschs „Ami, go home“ gerne gesungen …
Ja, aber das war ja, anders als unsere Lieder, nicht extra für dieses Ereignis geschrieben worden. (…)
Woran lag es, dass die von Ihnen ausgesuchten und geschriebenen Lieder 1973 so gut angenommen wurden?
Wir haben das vorher ausprobiert. Wir haben Stichproben bei Veranstaltungen im Vorfeld gemacht und die Wirkung getestet.
Moderne Marktforschungsmethoden …
Freilich, wir waren ja auch nicht blöd. Wir haben auch mit einem Soziologen im Funk zusammengearbeitet, haben uns genau überlegt, in welcher Art man die Lieder machen müsste. Wir haben schon versucht, das wissenschaftlich anzugehen.
Worauf kam es an? Politik und Emotion zusammen zu bringen?
Die Politik spielte dabei, zumindest offensichtlich, keine Rolle. Im Vordergrund stand Lebensfreude und Lockerheit, es sollte Spaß machen.
Haben Sie auch Schlagerprofis angesprochen?
Nee, die kamen von selber. Die musste man nicht anstoßen. Die waren alle dabei, weil sie das große Geschäft witterten. (…)
„Er verkörperte, was er sang.“ – Ernst Busch und die Singebewegung
Seit 1970 gab es in Ost-Berlin das Festival des politischen Liedes, das durch die Singebewegung entstanden war und bei dem auch Sie immer wieder mitgewirkt haben. Ich habe eine Radiosendung von Erwin Burkert aus dem Jahr 1970 gehört, in der Sie über Ihre Erwartungen an dieses Festival sprechen. Sie sagen da auch, dass Ernst Busch als Leitbild taugen würde für die Singebewegung und dass Sie hoffen, dass Busch bei der Eröffnungsveranstaltung auftritt. Erinnern Sie sich noch daran?
Ich glaube, Busch ist nie auf dem Festival aufgetreten. Der ist wie gesagt mal separat mit uns aufgetreten, aber wann das war, weiß ich nicht mehr. Kirchenwitz weiß das, der hat doch auch promoviert über die Singerei … Im Übrigen war diese Formulierung mit dem „Leitbild“ weniger musikalisch als charakterlich gemeint. Der Busch hatte zunächst für mich eine historische Patina und er verkörperte schon von seiner Biografie her das, was er sang. Also, er hat das auch gelebt. Von daher war er für mich, wenn man so will, ein Vorbild. (…)
Von den Liedern her und musikalisch haben Sie sich eher weniger an Busch orientiert …
Anfänglich haben wir in dieser Hootenanny-Bewegung im Grunde alles eingesogen, was es an Liedern gab, selbst das ganz traditionelle Zeug. Da kam zum Beispiel Hermann Hähnel, Dozent an der Hanns Eisler-Hochschule, der mit Stimme und Klavier alte Arbeiterlieder dargeboten hat. Von der Ästhetik her eigentlich furchtbar! Mit einer Wahnsinns-Röhre und einer operettenhaften Haltung … Das gefiel uns irgendwie nicht auf die Dauer, und da haben wir ihn nicht mehr eingeladen … Bei Busch war das ganz anders. Da konnte man einfach nichts dagegen sagen! Bei Busch kam alles zusammen: der Nimbus, also diese Aura, die er hatte, und dann auch die Klarheit und gleichzeitige Rauheit seiner Stimme. Die war ja nicht so geschliffen und fein wie bei ausgebildeten Sängern, die man sich ja nicht anhören konnte. Das kam uns entgegen, diese Laienhaftigkeit in der Stimme. (…)
(Exkurs zu Ronald Paris und dessen Busch-Gemälde; Andert über Buschs Reaktion auf das Bild: „Er war da überhaupt nicht souverän.“ Busch habe natürlich auch seine menschlichen Schwächen gehabt, aber darüber wisse er zu wenig. In jedem Fall sei es notwendig, im Hinblick auf mein Buch, Busch vom Sockel zu holen und mit dem „religiösen Verhältnis“, das manche zu Busch – dem Heroen und „Barrikaden-Tauber“ – hätten, aufzuräumen)
„Niemand wusste, dass der verboten war“ – Ein Lied für Busch
Können Sie sich noch erinnern, was Sie damals, um 1970, für ein Bild von Busch hatten?
Wissen Sie, mit dem Busch war das folgendermaßen: Wir wussten gar nicht, dass der verboten war beziehungsweise seine Bänder mit einem Sperrband versehen waren und dass er nur bei Brecht Schauspielerei machte, weil er nicht mehr singen durfte. Den ganzen Knatsch hatten wir nicht mitgekriegt. Der Busch selber hat die Klappe gehalten und das nicht rumerzählt, und die Partei hat erst recht die Klappe gehalten. Keiner wusste Bescheid. Und dann kam ’78 der Erwin Burkert, ich hab das ja in meinem Buch beschrieben („Nach dem Sturz“; JV), knallte mir eine Biografie über Busch hin und sagte: Mach mal ’n Lied über den Busch, ich will ’nen Film machen!“ Erst wollte ich nicht, weil ich dachte: „Es ist doch alles bekannt über den Barrikaden-Tauber.“ Ich fand auch, dass das kein geeigneter Stoff für ein Lied war, schon gar nicht für ein Loblied, ich war also skeptisch. Jedenfalls sagte der Erwin, er wolle einen Film machen über Busch, ihn selber könne er aber nicht mehr aufnehmen. Busch lag damals schon im Krankenhaus, also wollte Erwin alle Leute interviewen, die irgendwie mit Busch zu tun hatten, also den Tonmeister von Amiga und diesen und jenen, um daraus dann mosaikartig ein Bild entstehen zu lassen. „Und du machst ’n Lied über Ernst Busch als Krönung!“ – Da hab ich gesagt: „Nein, mir fällt da nichts ein.“ Erwin wollte dann, dass ich diese Biografie aus der DDR lese, was ich auch gemacht habe. Und da merkte ich, dass da was fehlte in dieser Biografie. Ich hab mich dann bei Erwin erkundigt, und erst dann erfuhr ich, dass es in den 50er Jahren zwischen Busch und der Partei Knatsch gegeben hatte. Das wusste vorher niemand von uns. Wir dachten immer, Busch hätte sich einfach zurückgezogen wegen seiner Kriegsverletzung und weil er den ganzen Rummel nicht mehr haben wollte. Der Gedanke, dass es da irgendwelche Unstimmigkeiten gegeben haben könnte, war mir vorher nie gekommen. (…) Dabei war ich ja relativ nah an der Szene dran, die anderen wussten das schon gar nicht. Niemand wusste das – nur ein paar Eingeweihte!
Sie haben sich dann anders entschieden und das Lied für Burkert geschrieben. War das sein Vorschlag, die „Jarama-Front“ als Grundlage zu benutzen?
Nee, das war meine Idee.
Warum ausgerechnet diese Lied? Hat Sie das speziell beeindruckt?
(Pause)
Oder war es wegen des Versmaßes?
Nee, nee. Aber diesen Gedanken „Es gab eine Schlacht, es gab einen Sieg“ – den konnte man wunderbar umdrehen.
„Der Andert soll das an meinem Grab singen!“ – Die Trauerfeier
Ist das Lied damals auch auf Platte erschienen?
Nein, gar nicht. Das Ganze hatte auch noch ein dummes Nachspiel. Ich hab das auch geschildert (in dem Buch „Nach dem Sturz“; JV). Also: Busch hat diesen Film von Erwin gesehen und auch mein Lied gehört. Und zu Irene, die bei ihm war, hat er gesagt: „Prima, was der Andert da gemacht hat. Das ist wenigstens mal einer, der diese Sache nicht untern Teppich kehrt. Sag dem Andert ’nen schönen Gruß, und er soll das Lied an meinem Grab singen!“ Das hat er zu seiner Frau gesagt, und die Irene hat das dann dem Akademiepräsidenten Konrad Wolf gesagt. Denn Busch starb ja wirklich bald darauf, und der Wolf wurde beauftragt, die offizielle Trauerfeierlichkeit für ihn an der Akademie der Künste zu inszenieren. Der hat sich also mit der Irene zusammengesetzt, und Irene hat gesagt: „Ich lege Wert darauf, dass der Andert dieses Lied singt. Weil das dem Ernstl so gut gefallen hat.“ Also haben sie das Programm zusammengestellt, alle möglichen Leute waren dabei, darunter auch sein Freund aus der Sowjetunion, Grigori Schneerson. Nun mussten die aber, da der Honecker kam, das Programm einreichen und absegnen lassen …
(Ende der zweiten Seite der ersten Kassette)
Reden wir jetzt von der Trauerfeier oder von der Beerdigung?
Von der Trauerfeier. Ich sing doch nicht am Grab. Bei der Beerdigung wird nicht gesungen, jedenfalls nicht von mir, das ist doch Schwachsinn! (lacht) Jedenfalls kam das Programm zurück, und alles war in Ordnung, nur mein Lied war durchgestrichen. Da hat Konrad Wolf die Irene angerufen und gesagt: „Alles in Ordnung, nur das Lied vom Andert ist raus.“ Sagt sie: „Schönen Gruß an Herrn Honecker, dann komm ich nicht. Ernst hatte sich das Lied gewünscht!“ Konrad Wolf hat versucht, sie umzustimmen, aber sie hat nicht nachgegeben. Also hat er das dem Büro Honecker mitgeteilt, und da hieß es dann: „Naja, dann nehmt das Lied wieder rein.“ (Lachen) Und fünf Minuten vor meinem Auftritt bei dieser Trauerfeier, ich stehe schon mit meiner Klampfe hinterm Vorhang und warte das Ende der vorherigen Nummer ab, kommt Wolf zu mir und spricht mich an. Ich war ziemlich angespannt, denn so eine Trauerveranstaltung ist ja Mist. Du stehst auf der Bühne und alles ist schwarz, keiner klatscht und du hast überhaupt keine Rückkopplung. Und in dem Moment sagt der zu mir: „Weißt du überhaupt, was wir für ’n Ärger mit deinem blöden Lied hatten?“ Und erzählt mir im Telegrammstil das Hin und Her. Fünf Minuten, bevor ich da raus muss, so was darf man nicht machen. Aber er war halt kein Bühnentyp, der Wolf … Ich bin also da raus und war wie gelähmt. Es funktionierte nichts mehr. Ich muss bei diesem Lied ja die Melodie der „Jarama-Front“ spielen, das ging natürlich gar nicht. Also hab ich nur so ’n paar Akkorde geschrummt und hab das mehr gesprochen als gesungen. Mir war ’s dann auch egal, Beifall gab ’s eh nicht … Hinterher war dann ein kleiner Empfang, und da kam Lin Jaldati zu mir, die legendäre Sängerin, und hat mich umarmt und gesagt: „Reinhold, so gut wie heute hab ich dich noch nie erlebt! So ergriffen vom Tod von Ernstl warst du …“ Dabei war ich gar nicht ergriffen, ich konnte bloß nicht anders vor Aufregung. (Lachen) Auch die Gisela May fand meinen Vortrag ganz prima, die dachten alle, das sei Absicht und eine ganz reife Leistung gewesen …
Wie haben Sie das empfunden, als Sie von Erwin Burkert erfahren haben, dass Busch Ihr Lied so sehr mochte?
Dass ihm das gefallen hat, hat mich sehr gefreut.
Sie loben in Ihrem Lied für Busch nicht nur die Stimme des Sängers, sondern auch sein Schweigen. Wie ist das zu verstehen? Steckt in dem Lied auch eine Kritik an den Zuständen in der DDR drin?
Kann man so sehen. Es gab nach Buschs Tod oder jedenfalls im Umfeld dieser Trauerfeier noch eine andere Veranstaltung in der Akademie der Künste, die was mit Busch zu tun hatte. Da kam Egon Krenz zu mir und sagte: „Also, Reinhold, ich hab da diesen Film mit deinem Lied drin gesehen und muss sagen: ganz großartig!“ Und dann kam er nach einer halben Stunde wieder, hatte sich inzwischen mit Hartmut König unterhalten, und sagte: „Ich muss mich korrigieren, das Lied ist doch nicht so gut.“ – „Warum?“ – „Naja, das mit dem Schweigen, was meinste denn damit?“ Ich sag: „Du hast das Lied wahrscheinlich nicht verstanden. Lass dir das nicht von Hartmut mies machen, der hat schon lange keine Lieder mehr gemacht …“ (lacht) Das war ja auch der Trick dabei, dass viele nicht so recht was anzufangen wussten mit dem Text. Busch verstand schon, was ich meinte, kluge Menschen verstanden das. (…) Für mich war das schon wichtig: Es gab so viele Künstler, die sich aufzuwerten versuchten, indem sie ihr Süppchen auf diesem Ost-West-Spannungsfeuer kochten. Der Kalte Krieg war diesen Leuten nützlich. Und wer dann noch schnell die Fronten wechselte, wurde besonders bekannt. Denn beide Seiten arbeiteten ja auch mit Künstlern, die zum Teil dadurch erst namhaft wurden. Das beste Beispiel ist natürlich diese Biermann-Geschichte und die sich hieraus ergebenden Folgen. Das hatte eigentlich mit Liedern oder mit Kunst gar nichts zu tun, sondern das war ein ganz anderes Schlachtfeld, wenn man so will. Plötzlich wurden Leute berühmt, und zwar nicht durch ihre künstlerische Arbeit, sondern indem sie sich irgendwie ge- oder missbrauchen ließen für politische Dinge, die sie eigentlich gar nichts angingen. (…)
(Exkurs zu Anderts Position im Fall Biermann)
(Exkurs über die Weltfestspiele und die Frage, warum sowohl Busch als auch Biermann nicht einbezogen wurden in die musikalische Vorbereitung)
Erinnern Sie sich noch an die Schlagzeile im ND nach Biermann Ausbürgerung „Wir sind es gewohnt mitzudenken“ und die zustimmenden Stellungnahmen von prominenten Künstlern, ganz oben Ernst Busch?
Ja, klar. Das kam aus der Abteilung Agitation und Propaganda vom ZK, die war verantwortlich fürs ND. Und diese Sonderseite wurde direkt von oben konzipiert. Da ist dann wahrscheinlich einer zu Busch gefahren, hat mit ihm geredet, und dann haben die das auf die Schnelle gemeinsam formuliert. Und am selben Abend wurde das gleich in die Druckerei gegeben. Zu mir sind ja auch Leute gekommen und haben mir klar zu machen versucht, dass es gut wäre, wenn ich da mit erscheinen würde. Das dauerte ziemlich lange, die saßen zwei Stunden bei mir in der Wohnung.
Was haben Sie denen gesagt?
Nichts. Ich erscheine da nicht. (…)
„Schweigen lernen“ – Künstler und Intellektuelle in der DDR
Nachdem Ernst Busch gestorben war – wie würden Sie seine Bedeutung beschreiben?
Ich kann ihn nicht objektiv beurteilen, weil ich im Grunde nur ein paar Episoden mit ihm und von ihm kenne, und die meisten aus zweiter Hand.
Dann sagen Sie doch , was er für Sie bedeutet hat …
Für mich war er ein unheimlich ehrlicher, aufrechter Typ, der aus Überzeugung Kunst gemacht hat. Dass er Handwerkszeug hatte, dass er musikalisch war und eine besondere Stimme hatte, dafür kann ein Mensch ja nichts. Das kriegt er mit in die Wiege oder nicht. (Pause) Für mich war er ein Ausnahmekünstler, der seiner Überzeugung von einer sozialistischen Gesellschaft bis zur bittersten Konsequenz treu geblieben ist und damit auch sich selbst. Das fand ich phänomenal. Und deshalb hab ich in diesem Lied für ihn geschrieben, dass man von ihm auch Schweigen lernen kann, sich selber zurückzunehmen für seine innere Überzeugung, auch mal auf was zu verzichten … (…)
Das heißt, Sie rechnen Busch hoch an, dass er solidarisch geblieben ist und sich nie öffentlich negativ über die DDR geäußert hat.
Ungeheuer. Der hätte sonst was erzählen können über das Unrecht, das ihm widerfahren ist in der DDR. Die West-Journaille wäre doch unheimlich geil darauf gewesen, das aufzugreifen. Munition gegen den Ulbricht war doch willkommen. Und dem Busch wäre ja auch nichts passiert, der hätte nach Belieben Interviews geben und ein paar Dinge erzählen können. Aber er wusste, das wäre überhaupt nicht produktiv gewesen, ganz im Gegenteil. Das meine ich mit dem „Schweigen“. Und er konnte sein Leben lang in den Spiegel gucken , ohne erblassen zu müssen. (…)
Man kann es auch anders sehen und sagen: Er hätte seinen Bekanntheitsgrad doch nutzen können, um was Produktives zu sagen, das zur Veränderung beiträgt …
Das ist der große Vorwurf generell an die Künstler und Intellektuellen der DDR, dass sie ihren Einfluss nicht geltend machten für einen anderen Weg oder eine andere Art der Verwaltung der Macht.
Den teilen Sie offenbar nicht, diesen Vorwurf …
… den teile ich nicht, weil er die tatsächlichen Verhältnisse der DDR nicht berücksichtigt, vor allem die Abhängigkeit der DDR-Politiker von der Sowjetunion. Honecker hat mir viel erzählt über diese Abhängigkeit, und es ist sicher richtig, dass diese Politiker selber nicht souverän waren. Der Vorwurf ist auch relativ unhistorisch, weil man dann fragen muss, wann der Einfluss der Künstler und Intellektuellen überhaupt so groß gewesen wäre, dass man noch was hätte machen können. Sie waren natürlich auch mit Illusionen behaftet, genau wie die Politiker auch. Ich habe es ja auch im Rahmen meiner Möglichkeiten versucht … Wer weiß, was ich damit erreicht habe, wahrscheinlich auch viel zu wenig. Ich hätte vielleicht mehr erreichen können, wenn ich in die Politik gegangen wäre. Aber ich hab das nicht gemacht, weil ich gesehen hab: Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Außerdem ist es immer problematisch, in der Geschichte zu fragen, was gewesen wäre, wenn … Jedenfalls wäre es ein relativ oberflächliches Urteil zu sagen, Busch hätte mal den Mund aufmachen sollen.
Der Jauchefahrer von der LPG – „Spaniens Himmel“ bei der Armee
In dem Interview, das ich vorhin angesprochen habe, nennen Sie drei Lieder von Busch, die sie besonders gern mögen: Solidaritätslied“, „Einheitsfrontlied“ und „Seifenlied“. Sind das heute immer noch Ihre Lieblingslieder von Busch?
Eigentlich gefallen mir diese Spanienlieder von der Stimmung her am besten. Aber ob das meine Lieblingslieder sind … Die „Jarama-Font“ ist mir natürlich sehr deutlich in Erinnerung, weil ich die damals andauernd gehört habe. Klar, es ist auch wunderbar, wie Busch „Spaniens Himmel“ singt. Obwohl ich dieses Lied zum Kotzen finde, weil wir das immer bei der Armee singen mussten im Gleichschritt auf dem Weg zum Frühstück. Und wenn das dem Feldwebel, das war so ein Jauchefahrer von einer LPG, nicht gefiel, mussten wir wieder durch die ganze Kaserne zurück und das noch mal singen. Damals, das war ’76, hab ich Hass entwickelt auf einiges, was wir da singen mussten. Die Armee hat wirklich die DDR zu Grunde gerichtet. Und sie hat diese mir so heiligen Lieder dermaßen kaputt gemacht, das tat mir in der Seele weh. (…)
Eine Überdosis „Spaniens Himmel“ haben ja einige abgekriegt. Wofür stand das Lied in der DDR?
Das stand in jedem Liederbuch. Klar, dieser ganze Spanienkampf wurde bei uns etwas religiös zelebriert. Als ich dann nach der Wende das erste Mal in Spanien war und dort auch mit Leuten redete, stellte sich das ganz anders dar. Das war nicht so schwarz-weiß, wie uns das erzählt worden war. Da gingen ja teilweise Risse durch die Familien, das war alles nicht so politisch eindeutig … Aber diese Lieder hatten natürlich ihre religiöse Funktion in der DDR. Aber es sind ja auch schöne Lieder, da kann man nicht meckern … Der Dessau hat mir das mal erklärt: „Junge, wenn du ein Marschlied oder ein Massenlied machen willst, darfst du nicht mit komplizierten Melodien kommen. Es muss bequem zu singen sein. Der erste Ton muss die Sprachtonhöhe übernehmen. Dann kannst du anfangen, Melodien zu entwickeln. Es darf nicht sein, dass erst gefragt wird, wer jetzt anstimmt, und das dann jemand eine Stimmgabel nimmt und sucht (singt eine Tonfolge): Ba-ba-ba-baaa, das müsste er sein, baaa … – Das ist schon Mist! Das muss sofort losgehen.“ (Lachen) Und dann hat er mir das gleich vorgemacht mit „Spaniens Himmel“. (…)
(Exkurs zu Anderts schriftstellerischem und sängerischem Werk in der DDR, u. a. „Lieder aus dem fahrenden Zug“ von 1978; Anekdote zur Entstehung des „Pionierliedes“, das Andert auf Bestellung schrieb, wobei er sich den Spaß machte, den Beschluss des Politbüros über die Erziehung der Kinder und Jugendlichen zu sozialistischen Persönlichkeiten quasi komplett im Text abzuarbeiten. Denn man hatte zu ihm gesagt: „Es wär schön, wenn alles drinne wär.“)
Ihre eigenen Liedertexte waren zum Teil sehr ironisch, mitunter auch kritisch. Ich frage mich, wieso diese Texte so problemlos veröffentlicht wurden. War das repressive Toleranz, dass so was durchging oder wie nennt man das? Oder war dieser Ton damals üblich?
(Pause) Wenn Sie solche Texte heute gedruckt lesen, ist das ja nur die eine Seite. Wenn ich die Texte aber zum Beispiel in der Kongresshalle am Alex vor, sagen wir mal: tausend Leuten gesungen habe, und die haben sich gekrümmt vor Lachen, dann konnte man schlecht was dagegen machen. Dieses Lachen war ja nicht gegen die DDR gerichtet. Sondern es war ein Lustigmachen über sich selbst.
Das war aber nicht die große Stärke der SED, sich über sich selbst lustig zu machen.
Das ist wahr. Die Lieder waren aber auch nicht so böse vom Ton her. Die Haltung war wirklich: Wir machen uns über uns selber lustig. Die SED an sich hat sich natürlich nicht über sich selbst lustig gemacht – diese Stärke hatte die Partei nicht … (…)
(Exkurs über Anderts Rausschmiss aus der SED, der von Konrad Naumann, Mitglied des Politbüros der SED und erster Sekretär der Berliner SED-Bezirksleitung, und vor allem von dessen Ehefrau, der Schauspielerin Vera Oelschlägel, aus persönlichen Motiven initiiert wurde; Ende der ersten Seite der zweiten Kassette)
Hatten Sie dann in den 80er Jahren regelrecht Berufsverbot?
Das ist nicht offiziell ausgesprochen worden, ich habe nie, wie andere, die Auftrittserlaubnis entzogen bekommen. Sondern das wurde auf kaltem Weg gemacht. Ich war seit ’79 oder ’80 kein Parteimitglied mehr und sollte darüber hinaus auch nicht mehr auftreten. Die ganze Sache wurde dann allmählich vom ZK „durchgestellt“, wie das in der DDR hieß. Das ging nicht von heute auf morgen. Ehe diese Botschaft „Den Andert lassen wir nicht mehr auftreten“ die ganzen Ebenen durchlaufen hatte und in den letzten Dörfern ankam, verging viel Zeit. Es gab keinen schriftlichen Vermerk dazu; es gab lediglich Listen von Organisationen wie dem Kulturbund, auf denen Leute standen, die zu Veranstaltungen nicht eingeladen werden durften. Da war Wegner (die Liedermacherin Bettina Wegner; JV) drauf, Schlesinger (der Schriftsteller Klaus Schlesinger, zeitweise verheiratet mit Bettina Wegner; JV) war drauf, ich war da drauf und verschiedene andere … Diese Listen basierten auf mündlichen Mitteilungen an die Kulturfunktionäre der Kreise, die sich regelmäßig beim Bezirk trafen, wo sie angeleitet wurden und gesagt kriegten, wer nicht einzuladen sei. Das haben sich aber nicht immer alle notiert, manche haben das auch wieder vergessen, das versandete also manchmal … (…) Ich weiß, dass die Presse die Anweisung hatte: Der Name Andert darf nicht mehr erscheinen. Und auch die Verlage hatten vom Kulturministerium die Anweisung: Von dem wird nichts gedruckt. Als in den 80er Jahren jemand so ’n biografisches Buch über mich machen wollte, sagte Henschel (Henschelverlag Kunst und Gesellschaft in Berlin; JV): „Den Namen Andert streichen Sie mal lieber.“ Ich bin in dieser Zeit aber dennoch in kulturpolitisch verwahrlosten Gegenden aufgetreten. Zum Beispiel erinnere ich mich an die Fachhochschule in Mittweida oder an die Ingenieurhochschule in Glashütte. Bis dorthin hatte sich das noch nicht rumgesprochen, weil diese Studenten ’ne andere Informationsebene hatten. (lacht) Die luden mich ein und kriegten dann erst hinterher von oben den Ärger … Manche hatten sich schon im Konzert gewundert, denn die Lieder wurden natürlich zum Teil etwas bitterer und schärfer …
Wie lange dauerte dieser Zustand?
Das ging so weiter bis 1989, da hat mich dann die PDS rehabilitiert.
Sind Sie wieder eingetreten?
Nein.
Warum nicht?
Ach, ich muss keiner Organisation mehr beitreten und auch noch Beitrag zahlen. Man kann die ja anderweitig unterstützen.
„Das Parteibuch zerruppt“ – Erich Honecker und Ernst Busch
Lassen Sie uns zum Schluss noch kurz über Ihre Gespräche mit Erich Honecker reden, die Sie 1990 geführt und dann in dem Buch „Der Sturz“ veröffentlicht haben. Sie fragen Honecker sehr genau nach seiner Jugendzeit, Sie fragen auch nach seinen Lieblingsliedern in der Jugend. Warum?
Das gehört dazu, wenn man eine Persönlichkeit entblättern will: Lieblingsspeisen, Lieblingsfächer in der Schule, Lieblingslieder und so weiter. Das offenbart sehr viel über den kulturellen Stand und die Gefühlswelt. Das gehört zu einem soziologisch-psychologischen Fragespiegel, der einem hilft, eine Persönlichkeit aufzuknacken.
Sie reden mit ihm auch über die Schalmeienkapelle, in der er war. Auf diese Mitgliedschaft spielen Sie auch schon früher in einem Ihrer Gedichte an. Hatte das eine besondere Bedeutung, war das Allgemeingut in der DDR?
Die Schalmei ist das Kampfblasinstrument der Arbeiterklasse. Die KPD hat Schalmeienmusik gehabt, und bei der SPD wurde Mandoline gespielt. Willy Brandt war auch auf einem Plakat mal mit Mandoline zu sehen, obwohl er das Ding wahrscheinlich gar nicht spielen konnte. Aber das ist die Kulturtradition, wo das herkommt. Schalmeien sind eigentlich furchtbar, die haben ja keine halben Töne und klingen sehr schräg. (lacht) Sind aber kinderleicht zu spielen. Und wenn der Honecker sagt: „Schalmei zu lernen war mir zu kompliziert, sodass ich dann zur Trommel kam“, offenbart das einiges … (lacht)
Mochte der Honecker den Busch?
Ja. Der war ein absoluter Busch-Fan.
Hatte er auch Platten zu Hause?
Ja, natürlich, das sagt er ja in dem Buch. Sämtliche Platten von Busch hat er gehabt und dann noch ein paar Tonbänder, die Busch ihm persönlich geschenkt hatte.
(Exkurs zur Ohrfeigengeschichte Busch/Honecker)
In der Passage, in der Sie mit Honecker über Ernst Busch reden, stellen Sie auch die Frage, warum Busch in den 50er Jahren aus der Partei ausgeschlossen wurde. Ist er denn aus der Partei ausgeschlossen worden?
Naja, das ist eigentlich ein Zirkelschluss. Busch ist bei diesem Dokumenten-Umtausch – das weiß ich aber nur von Erwin (Erwin Burkert; JV), ’n andern Zeugen als ihn hab ich nicht – von so einem jungen Kerl befragt worden, ob er schriftliche Beweise für seine biografischen Äußerungen hätte. Denn das gab es ja massenhaft, dass Leute behaupteten, im Widerstand gewesen zu sein, obwohl sie bei den Nazis waren. Die haben diesen Prüfern teilweise die Tasche voll gelogen, deshalb war das schon in Ordnung, dass der so was fragte. Nur den Busch darf man halt nicht fragen, wo das doch so bekannt ist. Da wurde eben formal dieser Fragebogen abgearbeitet, und Busch war natürlich sauer und hat wohl sein Ding (sein Parteibuch; JV) hingeknallt oder zerrissen. Und das gab es in der Partei nicht: dass man selber austritt. Sondern die Partei schließt dich aus. Du darfst nicht austreten, (lacht) sondern du wirst ausgeschlossen. Eigentlich ist das ja egal, aber formal ist es natürlich so, dass er ausgeschlossen wurde.
Diesen Schritt haben Sie offenbar mitgedacht, als Sie Honecker gefragt haben: „Warum ist Busch damals ausgeschlossen worden?“ Ich bin gar nicht sicher, dass dieser Schritt tatsächlich stattgefunden hat …
Doch, doch, der hat mit Sicherheit stattgefunden.
Gehen Sie davon aus, weil Erwin Burkert das gesagt hat?
Nee. Wenn der Busch sagt „Leckt mich am Arsch, hier habt ihr die Pappe! Ich trete aus eurem Verein aus!“, dann ist die notwendige Folge laut Parteigesetz, dass er ausgeschlossen wird. Das kommt wie das Amen in der Kirche. Das war so. Denn man durfte ja nicht selber austreten. Wenn man den Wunsch geäußert hat, da auszutreten, hatte das automatisch zur Folge, dass man ausgeschlossen wurde.
Das heißt, Sie glauben auch Honecker die Antwort, dass er Busch eines Tages ein neues Partei-Dokument gegeben hat und ihn damit wieder aufgenommen hat?
Ja, freilich. Das war ja auch so. Der Busch hat in den 70ern einen Termin bei dem gehabt. Ich kann das ja noch mal nachlesen im wörtlichen Interview-Protokoll.
(Exkurs über den 70. Geburtstag Buschs, bei dem auch Andert war und mit dem Oktoberklub ein Ständchen darbot; Anmerkungen zu Biermann, der ebenfalls anwesend war)
Im Vorwort Ihres Buchs „Der Sturz“ heißt es: „Wir fragten (…) aus der tiefen Betroffenheit einer Generation heraus, die vor den Trümmern ihrer Ideale steht und nach der Verantwortung dafür nicht nur bei den Interviewten (den Honeckers; JV), sondern auch bei sich selbst sucht.“ Und an anderer Stelle schreiben Sie, die Fragen an Honecker seien „die eindringlichen Vorhaltungen einer Generation, die unter sozialistischen Bedingungen aufwuchs, anfangs so große Hoffnungen hegte, mit der Zeit aber bitter enttäuscht wurde und sich schließlich so vehement auflehnte.“ Waren es bei Ihnen die 80er Jahre, in denen Sie Ihren Beruf nur unter erschwerten Bedingungen ausüben konnten, die diese großen Hoffnungen zerstörten?
Naja, das ist alles etwas dramatisch formuliert, da hat sich der Herzberg durchgesetzt … (Koautor Wolfgang Herzberg; JV) Aber im Wesentlichen stimmt es schon. Meine persönliche Erfahrung ist: Da wollte man eine menschenwürdige Gesellschaft aufbauen, zumindest wurde das verbal verkündet, und setzte dabei Mittel ein, die so menschenverachtend waren. Das beziehe ich jetzt nicht nur auf dieses Berufsverbot, sondern auch auf meine Erfahrungen bei der Armee. Das war ja keine sozialistische Armee, das waren Nazis hoch vier. Was mir mein Vater vom Barras, also von der Wehrmacht, erzählt hat, das fand ich dort in verschärfter Form wieder. Also, es hatte mit Sozialismus nichts zu tun. Und wie man mit mir in diesen zehn Jahren umgesprungen ist, war natürlich nicht in Ordnung. Andrerseits muss ich sagen, dass ich in dieser Zeit – ich hab das neulich festgestellt, als ich meine Rentenunterlagen zusammenkratzen musste – pro Jahr mehr verdient habe, als in den sieben Jahren von 73 bis 80, wo ich ja auch frei schaffend aber nicht verboten war. Das lag an der Solidarität der Leute, die dann einsetzte. Ich hatte zwar dann keine großen Solokonzerte mehr, aber ich war eingebunden in die Volksbühne, mit der ich dann übers Land tingelte. Wenn ich da zwischen all den Schauspielern auftrat, konnte mich keiner rausholen – das war ja vorher nicht bekannt, wer dabei war. Das hieß dann „Ein Künstlerensemble der Volksbühne kommt und macht einen literarisch-musikalischen Abend“. Und ich konnte immer mitmachen. Herrlich! Außerdem bekam ich durch die AWA, das war die GEMA im Osten, jährlich 10.000 Mark Ausgleichszahlung, weil meine Lieder nicht gespielt wurden im Funk. Das war keine politische Kategorie, sondern eine künstlerische: Die Zahlung kriegten zum Beispiel solche Künstler, die ein Jahr lang ein Streichquartett oder eine Symphonie zusammenbastelten. Das betraf vor allem Moderne Musik, die relativ selten aufgeführt wurde. Für so eine Aufführung im Funk gab es meinetwegen vier Punkte, was ja nicht besonders fair war, wenn man sich überlegt, dass so ein Werk nur zweimal im Jahr läuft, ein Schlager aber fünftausendmal und deswegen auch viel mehr Punkte bekommt. Also gab es so eine Art Ausgleichszahlung. Den Schlagerleuten wurden von ihren 40.000 Mark dann 30.000 weggenommen, und die wurden umverteilt auf diejenigen, die große Kunst machten, aber davon nicht leben konnten. Und ich fiel nun auf einmal unter die klassischen Musiker …
Wurden Ihre Lieder vor 1980 viel im Radio gespielt?
Ja. Kann man schon sagen. Und nach ’80 wurden sie eben gar nicht mehr gespielt.
Was waren die meistgesendeten Lieder, Ihre Hits sozusagen?
„Vaterland“, „Hausgemeinschaft“, „Treptower Park“ – die liefen schon öfter. Also jetzt nicht ständig, aber auf dem Jugendsender DT 64 spielten sie schon auch Sachen von meinen beiden Soloplatten. Die erste Platte wurde sogar übers Ministerium für Volksbildung allen Schulen zugeleitet, und die setzten das dann im Musikunterricht ein und in Staatsbürgerkunde.
Das heißt, Sie sind sogar im Lehrplan gelandet?
Genau. Und in Schulbüchern auch. Einige Texte kamen sogar ins Schulbuch für den Deutschunterricht in der 6. Klasse.
Hat Sie das gefreut?
Natürlich. Mehr kann man doch nicht erreichen im Leben, als dass man in einem Schulbuch auftaucht. (lacht) (…)
Interview: Jochen Voit
Foto: Pressefoto Reinhold Andert
(Textfassung autorisiert von Reinhold Andert am 30. 3. 2006)

Lisa Behn
über ihre Schwester Lotte und Ernst Busch, den Widerstand gegen den Nationalsozialismus und das kommunistische Ideal des Ungebundenseins
„Immer wenn er mal keine Frau hatte, wollte er meine Schwester heiraten - aber sie wollte nie“
(Gespräch am 1. Juni 2004 in Berlin)
Lisa Behn ist Jahrgang 1908. Sie wächst in einem sozialdemokratischen Elternhaus in Kiel auf und hat zwei Geschwister. Der Vater arbeitet auf der Werft, die Mutter ist gelernte Erzieherin. 1918 wird Lisas Bruder Hans-Günther geboren; er fällt 1941 im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront. Lisa Behn (damals noch Lisa Attenberger) tritt wie ihre Schwester Lotte (1905-1993) in die Sozialistische Arbeiterjugend (SAJ) ein. Dort lernen die beiden auch Ernst Busch kennen; Lotte, die Ältere, bleibt Zeit ihres Lebens mit Busch in Kontakt. 1925 schließt sich Lisa Attenberger dem Kommunistischen Jugendverband Deutschlands (KJVD) an und beginnt sich verstärkt politisch zu engagieren. Sie spielt Agitprop-Theater und hilft beim Organisieren von Veranstaltungen. Als sie volljährig ist, wird sie Mitglied der KPD. Nach Hitlers Machtübernahme geht sie nach Berlin und setzt ihre politische Arbeit in der Illegalität fort. Zunächst lebt sie in wechselnden Quartieren, manchmal schläft sie unter einer Bank am Nollendorfplatz. 1934 findet sie Arbeit bei Woolworth und lebt zusammen mit ihrem Freund Werner Steinbrinck in einer Wohnung in der Hasenheide 9, wo sie 1936 als Mitglied der Widerstandsgruppe um Herbert Baum verhaftet wird. Sie wird im Polizeigefängnis am Alexanderplatz eingesperrt, dann in Moabit, schließlich zu zwei Jahren und sechs Monaten Zuchthaus verurteilt, die sie in Jauer, im heutigen Polen, absitzt. Nach ihrer Entlassung wohnt sie bei ihrer Schwester Lotte und deren Mann Fritz Büssenschütt in Berlin. In der Weinhandlung ihres Schwagers kann sie vorübergehend als Verkäuferin arbeiten. 1938 lernt sie den Journalisten Robert Behn kennen, der sich als Buchhändler und Bibliothekar durchschlägt. Ein Jahr später, seine Einberufung in den Krieg steht unmittelbar bevor, heiraten die beiden. Lisa Behn findet Arbeit als Lohnbuchhalterin bei der Firma Lorenz in Tempelhof, einem Betrieb, der von Radiogeräten auf Rüstung umgestellt hat. Lisa Behn setzt auch hier ihre illegale politische Arbeit fort, schreibt Berichte und hält Kontakt zu Mittelsmännern. 1940 kommt ihre Tochter Susanne zur Welt, 1941 folgt Sohn Michael. Kurz vor Kriegsende kommt es zur Trennung von Robert Behn, der starke Alkoholprobleme hat. Lisa Behn geht nach Kiel zu ihrem Vater, das dritte Kind, Tamen, wird 1945 geboren.
Nach dem Krieg beginnt die alleinerziehende Mutter sogleich wieder mit politischen Aktivitäten. Zusammen mit einer Roma-Familie gründet sie die KPD-Ortsgruppe in Hennstädt (Schleswig-Holstein). Erst 1946 erfährt Lisa Behn, dass die Gruppe Baum, der sie bis zu ihrer Verhaftung angehört hat, versucht hat, die Berliner Schmähausstellung „Das Sowjetparadies“ in Brand zu stecken und dass man ihre Freunde gefasst und hingerichtet hat. Sie zieht nach Berlin und fängt an, sich in der Jugendarbeit zu engagieren. Von 1947 bis 1949 leitet sie das Kinderheim Chorin in der SBZ, danach diverse andere ähnliche Einrichtungen, die Kriegswaisen aufgenommen haben. Von Robert Behn hat sie sich inzwischen scheiden lassen. In den 50er Jahren übersiedelt sie nach Eisenhüttenstadt, wo sie Fraueninstrukteurin der Kreisleitung der SED wird und den ganztägigen Schulhort der neuen Stadt übernimmt. Sie wird Kreissekretärin für Jugendweihe im Kreis Eisenhüttenstadt und versucht möglichst viele Familien vom Nutzen dieses sozialistischen Ritus‘ zu überzeugen. Schließlich erreicht sie in ihrem Kreis eine Teilnahmequote von 100 %, was auch im ND gewürdigt wird. Bis 1980 arbeitet Lisa Behn weiter im Jugendbereich. 1994 zieht sie dann zu ihrer Tochter Tamen Zimpel nach Berlin, Prenzlauer Berg. In deren gemeinsamen Wohnung findet auch unser Gespräch statt.
Nachträge: Die Lebenserinnerungen der Lisa Behn sind in einer sehr lesenswerten Broschüre mit dem Titel „Ein Spaziergang war es nicht“ nachzulesen. Herausgegeben wurde die Publikation im Jahr 2002 von Michael Kreutzer und Tamen Zimpel.
In der Nacht vom 12. auf den 13. April 2008 ist Lisa Behn gestorben.
Jochen Voit: Wie haben Sie Ernst Busch kennen gelernt?
Lisa Behn: Busch ist wie ich in Kiel geboren. Er war in der gleichen Zeit wie meine Schwester und ich in der SAJ. Er hat sich schon singend, wie man so sagt, in der SAJ berühmt gemacht – das war damals der Urkeim seiner späteren Popularität. (…) Er ist damals schon in Kiel bekannt gewesen als Sänger, nicht nur in der SAJ.
Haben Sie ihn auch als Sänger erlebt?
Ja, ja. Aber so wie man sich das vorstellt, ist das nicht gewesen. Er hat gut gesungen, ist aber zunächst nicht über unseren Rahmen hinaus gekommen. Er hat immer in kleinen Chören gesungen, die sich selbstständig organisierten. Und er hat innerhalb der SAJ dann schnell einen Namen gehabt.
Haben Sie auch gerne gesungen?
Nein, ich habe damals nicht mitgesungen, meine Schwester schon. (…) Ich hatte keine Singstimme für den Chor. Ich hab mich aber auch nicht bemüht darum. Er ist ja auch älter als ich, und meine Schwester war drei Jahre älter als ich. (…) Ja, ich kann mich noch gut an ihn erinnern.
Was für einen Eindruck hat er auf Sie gemacht?
Wissen Sie, wie das so ist: Da fällt zunächst keiner auf, und doch hat jeder seine persönliche Note, nicht.
Und was hatte Busch für eine persönliche Note?
(lacht) Ja, das ist gar nicht so einfach. Er sah gut aus. Meine Schwester ist mit ihm befreundet gewesen. Wir haben dann auch außerhalb Kiels gewohnt, und ich erinnere mich, dass er sie und uns da öfter mal besucht hat …
Wo war das?
In Kiel-Kronsburg, das ist eine Siedlung gewesen, die nach dem Ersten Weltkrieg gebaut wurde. Damals ist das Umfeld von Kiel besiedelt worden, und da hat mein Vater mit uns den Anfang gemacht. Wir haben da in einer Holzbaracke gewohnt, die Siedlung wurde ja gerade erst aufgebaut. Wir haben da aber nicht so lange gelebt. Meine Mutter ist 1922 gestorben, und da sind wir nach Kiel in die Stadt gezogen in die Hopfenstraße 4.
Haben Sie dort länger gewohnt?
Ja, da haben mein Vater, meine Schwester und mein Brüderchen zusammen gewohnt. (…) Nach dem Tod meiner Mutter hat sich alles geändert. Wir haben eine kleine Wohnung genommen, und meine Schwester ist dann bald nach Bremen zu meinen Verwandten. Vorher hatte sie eine Schneiderlehre angefangen, aber nicht zu Ende gemacht.
Dann hat die Freundschaft mit Busch wohl nicht lange gehalten …
Nein, die Freundschaft mit Busch hat nicht lange gehalten. Das lag aber an ihr. Sie ist ’n bisschen … – das ist in ihrem ganzen Leben so gewesen, wenn dann einer …
Warum ist die Freundschaft auseinandergegangen?
Da ist eigentlich gar keine richtige Freundschaft entstanden. Er hat sich so ’n bisschen bemüht um sie, nicht.
Und sie hat ihn auf Abstand gehalten?
Ja.
Wie würden Sie Ihre Schwester Lotte beschreiben?
Die war ’n bisschen passiv, sie war politisch nicht ganz so stark interessiert.
Sie war aber in der SAJ?
Ja, das ging eher von meiner Mutter aus und ist dann beibehalten worden nach ihrem Tod. Und mein Vater war auch ein SPD-Mann. (…) Aber ich bin ja dann in die kommunistische Jugend gegangen, und meine Schwester ist dann mehr ins Bürgerliche gegangen. Also, sie blieb jedenfalls in der SAJ.
Hat sie sich dann noch für Busch und seine Kunst interessiert?
Nein, sie hat politisch keine große Verbindung mit ihm gehabt. (…) Er hat sich als Mann für sie interessiert. (…) Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, als wir außerhalb von Kiel wohnten. Da musste man lange durch den Wald marschieren, bis man zu uns kam. Da hat er sie zwei-, dreimal besucht – aber sie war wohl sehr ablehnend. Sie wusste nicht so recht, wo sie hingehörte. Sie hatte mehr Interesse für ’s bürgerliche Tanzen und so. Sie ist gerne ausgegangen, was mein Vater gar nicht gerne sah. Sie ist aber dann, nachdem sie nach Bremen zu unseren Großeltern gegangen war, in unserem Fahrwasser geblieben, kann man wohl so sagen.
Was meinen Sie mit Fahrwasser?
Naja, links, links, links (lacht). (…) Aber als meine Mutter gestorben war und wir wieder nach Kiel umgezogen sind, Poppenbrügge hieß die Siedlung, ist sie mehr im bürgerlichen Milieu gewesen. Also, das mit dem Busch hat nicht geklappt. Sie war ’n Mensch, der ohne viel Theater leben wollte. Der Busch, der war eben schon zu berühmt für sie – da hat sie im Leben immer Angst vor gehabt. Deshalb hat sie ja auch so ’n Koofmich geheiratet. (Lachen)
Einen was?
’n Koofmich, einen Kaufmann.
Aus Bremen?
Ja. Sie hat einen Mann geheiratet, der nur das Geschäft im Sinn hatte. Und nur ihr zuliebe manches mitgemacht hat. (…) Das war ein ewig Anbetender, den sie schließlich, um ihn loszuwerden, geheiratet hat. Das kann man wohl so sagen. Verstehen Sie das?
Ich glaube schon. Und Sie haben ihn nicht besonders gemocht?
Och, nicht gemocht ist zu viel gesagt. Er hat sich der ganzen Sache untergeordnet. Er war auch in der Kommunistischen Partei wie wir. Die haben ’nen Schnapsladen gehabt in Berlin. Er kam ja von Bremen, und in Berlin haben sie geheiratet. Es war auch keine ideale Ehe, kann ich nicht sagen. Das ist die Zwiespältigkeit bei meiner Schwester gewesen, sie hat sich nie getraut, sie hat dem Schicksal nie getraut. (…)
Wie hat sie denn den Kaufmann kennen gelernt?
Mein Onkel hatte ’n großes Schnapslager in Bremen. Das war ein Laden mit Verkauf, flaschenweise, aber auch mit Belieferung von Läden. Dort ist der junge Mann beschäftigt gewesen als Lehrling. Und der hat sich nun sehr in Lotte verknallt und ließ nicht mehr los. Der hat Sachen gemacht, da hat halb Bremen Kopf gestanden, solche Mühe hat der sich gegeben. (…) Meine Schwester ist ganz ganz anders gewesen als ich. Sie fand das gar nicht so interessant, dass er so viel Aufhebens um sie machte.
Hat Ihr das nicht gefallen?
Na, sie wurde ja von vielen Männern umschwärmt. Sie war ’n hübsches Mädchen und hat sich auch immer mit sehr viel Geschick selbst Hüte gemacht. Dann ist sie aber doch in der KPD gelandet, auch durch diesen Mann, der da drin war. Es war sicher auch aus einer gewissen Lebensangst, dass sie diesen Büssenschütt geheiratet hat. (…) Sie hat auch keine Kinder gehabt.
(Tamen Zimpel: Ja, aber nicht, weil sie nicht wollten. Lotte war nicht gesund. Als sie schwanger war, haben sie ihr die halbe Lunge rausgenommen. Und dadurch hat sie das Kind nicht ausgetragen. Sie hat ja geraucht wie ’n Schlot.)
Sie war sehr selbstständig. Sie brauchte keinen Menschen, der sie förderte. Sie hat ihre eigene Linie gehabt. (…) Um auf Busch zurückzukommen: Der Busch hat sie, nachdem das ganze Theater mit dem Krieg und alles vorbei war, wieder aufgesucht. Die Verbindung war wiederhergestellt, aber sie haben nicht zueinander gefunden. (…)
Das war ja dann in Berlin. Wann sind Sie eigentlich nach Berlin gekommen?
Ich bin zuerst in Berlin gewesen, das war 1933. Dann hat man mich verhaftet. Ich war ja in der KPD. Ich habe da bei Woolworth gearbeitet und dort politische Arbeit gemacht. Verhaftet worden bin ich 1936. Habe zweieinhalb Jahre gesessen. (…) Nachdem ich wieder auf freiem Fuß war, durfte ich aus konspirativen Gründen nicht mehr in die Widerstandsgruppe „Baum“ zurück. Ich hab dann versucht, Kontakt zu anderen aufzunehmen. (…) Lotte ist 1936 nach Berlin gegangen.
(Tamen Zimpel: Hier gibt es ein Buch mit den Einzelheiten, das hat ein Historiker geschrieben.)
Wie war das nach dem Krieg, als Busch wieder Kontakt aufnahm zu Ihrer Schwester?
…
(Tamen Zimpel: Ich glaube, jetzt ist Schluss mit der Konzentration …Lotte muss damals mit Fritz in der Potsdamer Straße gewohnt haben. Die beiden hatten Ende der 30er geheiratet. Hier gibt es auch ein Foto von Busch, das er Lotte geschickt hat, mit einer Widmung vorne und einem Brief auf der Rückseite.)
Frau Behn, hier in dem Brief ist von einem Heiratsangebot die Rede. Dass Busch so großes Interesse an Ihrer Schwester hatte, haben Sie ja gar nicht gesagt …
Ja, ja. Immer wenn er mal keine Frau hatte, dann wollte er sie wieder heiraten. Und sie wollte nie. So ungefähr war das.
Klingt beinahe so, als sei sie seine große Jugendliebe gewesen …
Ja. Sie war so ’n Typ: unnahbar, schön war sie und unnahbar – diese Mischung gefiel dem Busch.
Hat Ihr das nicht auch geschmeichelt? Sie hat ja auch diese Briefe aufgehoben …
Doch, sicher. Aber sie hatte keinen Mut dazu. Er hat ihr schon gefallen. Aber sie hatte eine bestimmte Angst: „Das hat keinen Sinn! Das schaff ich nicht mit dem Mann!“ – Das hatte nichts mit Liebe zu tun, das war für sie zu groß. (…) Er ist ja dann, wie seine Frau gestorben war, noch mal wiedergekommen. (…) Man kann vielleicht auch sagen: Busch war für sie ’ne Nummer zu groß. Ob sie jemals richtig in ihn verliebt war, kann ich nicht sagen.
(Tamen Zimpel: Also, über Lottes Liebesleben kann ich nichts sagen – ich kenn sie nur als Tante.)
Haben Sie selbst gerne Ernst-Busch-Platten gehört?
Ja. Ich habe die mir auch gekauft, die Schellacks. Auch später die von Paul Robeson.
Haben Sie Ernst Busch auch in der Nazizeit in den 30er Jahren gehört?
Ja, sicher. Den haben wir auch in der Nazizeit gehört. Wir haben ja heute noch teilweise die alten Platten. (…) Wir haben damals auch die Songs aus der Dreigroschenoper gehört, die kannten wir alle in unserem Kreis und haben auch die Texte gekonnt. Natürlich mochten wir auch andere Musik: Chopin und Beethoven zum Beispiel. Auch Hans Albers gefiel mir. (…) Eines meiner Lieblingslieder war „Ja mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht …“ von Brecht.
Sie haben ja vor der Nazizeit selbst auch politisches Theater gespielt. Können Sie ein wenig davon erzählen?
Ich habe in einer Agitprop-Gruppe gespielt. Hat damals jede kommunistische Partei gehabt. (…) Ich hab immer die unangenehmen, die negativen Rollen gehabt: die Kapitalisten oder Faschisten. Wir sind mit dem LKW in die Dörfer gefahren und haben vom Wagen runter Stücke gespielt, gesungen haben wir auch. (…) Die Leute sind stehen geblieben und haben ’n bisschen zugehört. Aber das war nicht so befriedigend, wenn man so durch die Straßen fuhr. Bei den Stücken hatten wir dann einen Standplatz. Und da sind wir immer beschützt worden von den Rotfrontkämpfern, um faschistische Störenfriede abzuhalten. Wir sind ja von Anfang an bekämpft worden, nicht unbedingt nur von Faschisten, aber man konnte doch zusehen, wie es immer faschistischer wurde.
War das, nachdem Sie von der SAJ zur kommunistischen Jugend gewechselt waren?
Ja, das war beim kommunistischen Jugendverband in Kiel. Die hatten auch fertige Stücke da, die wir spielen konnten. Da gab es das Stück zum Thema Abtreibung, zum Paragrafen 218. Und ich hatte immer die hässlichen Rollen: Ich war die Ärztin, die das empörend fand, dass Frauen sich Kinder abtreiben lassen wollen.
Haben diese Rollen nicht auch Spaß gemacht?
Naja, sicher. Die waren ja provozierend, diese Rollen. Bei dieser Gruppe war übrigens Klaus Fuchs der Leiter, der später Atomphysiker wurde. Der hat da auch mitgespielt. Der wurde später in England wegen Verrats technischer Geheimnisse an die SU zu 11 Jahren Haft verurteilt, er musste sie aber nicht ganz absitzen. Mit dem war ich gut befreundet. (…) Sein Vater wollte unbedingt, dass ich mit ihm zusammen bleibe. Nun hatte Klaus aber einen Seelentröster, als er weg war. Deswegen hatte er mit seinem Vater eine schreckliche Auseinandersetzung gehabt. Das habe ich alles aber erst später erfahren. (…) Ich hab mit Heiraten nie was am Hut gehabt. Das war meistens das Ende.
Ein bürgerlicher Irrtum?
Ja, das ist eigentlich gegen unser Prinzip. Von der Idee her ist die Heirat, überhaupt sich fest zu binden, im kommunistischen Sinne überflüssig!
Haben Sie mal geheiratet?
Ja, ich war verheiratet.
Warum, wenn es doch überflüssig ist?
Es hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Ich hab, nachdem ich aus ‚m Zuchthaus raus war und nicht mehr für die Gruppe Baum arbeiten konnte, ’nen Mann kennen gelernt, der mir im Zuchthaus von einer Mitgefangenen empfohlen worden war… Das ist direkt zum Totlachen … Ich fuhr ja ’n paar Tage nach meiner Haftentlassung nach Bayern. Und die Gestapo hat mich nicht weiter verfolgt. Die hat überhaupt in meinem Fall so viele Fehler gemacht, das ist nicht zu glauben …
(Tamen Zimpel: Erzähl doch mal, wann und warum du geheiratet hast …)
Warum ich geheiratet habe?
(Tamen Timpel: Ja.)
Das weiß ich gar nicht mehr.
(Tamen Zimpel: Soll ich’s erzählen?)
Hm.
(Tamen Zimpel: Sie war schwanger. Und sie war ja politisch vorbestraft. Das war ’39, und Robert Behn, der Vater des Kindes, musste in den Krieg. Er hat gesagt, sie würden ihr als Vorbestrafte eventuell das Kind wegnehmen und in ein Heim stecken. Und deswegen haben sie geheiratet – sagt sie.)
Ich bin dem Tod ’n paar Mal von der Schippe gehupft. Sehr weh tut mir, dass mein Freund Werner Steinbrinck, der auch in dem Buch erwähnt ist, hingerichtet wurde. Er war Mitglied der Gruppe Baum. Genau wie ich.
Interview: Jochen Voit
Foto: privat
(Textfassung autorisiert von Lisa Behn und Tamen Zimpel am 17. Januar 2006)

Christian Bleyhoeffer
über seine Ausbildung an der Staatlichen Schauspielschule Berlin in den 50er Jahren und drei für ihn prägende Begegnungen mit Ernst Busch
„Er wollte immer populär sein, das heißt: immer verständlich sein!“
(Gespräch am 28. Juni 2004 in Berlin)
Christian Bleyhoeffer ist Jahrgang 1933. Bei Hannover geboren wächst er ab seinem dritten Lebensjahr in Berlin auf. Da seine Mutter Lieselotte Bleyhoeffer Schauspielerin ist, kommt er früh in Kontakt mit dem Theater. Er steht bereits als Kind auf der Bühne, ist ab 1945 Sprecher für Film und Rundfunk. Von 1952 bis 1955 ist er Student an der Staatlichen Schauspielschule in Berlin (die später nach Ernst Busch benannt werden wird), „um das Handwerk zu lernen“, wie er heute sagt. Danach arbeitet er als Schauspieler und Regisseur an verschiedenen Theatern der DDR, assistiert am Berliner Ensemble bei Manfred Wekwerth und Dario Fo und lehrt an der Dépendance der Berliner Schauspielschule in Rostock. Seit 1964 ist er Mitglied der SED, tritt allerdings 1987 wieder aus. Seine Theaterinszenierungen werden in der DDR zum Teil verboten und man gestattet ihm nicht, in der Bundesrepublik zu inszenieren. Seit der Wiedervereinigung arbeitet Christian Bleyhoeffer vor allem als Regisseur und Dozent.
Jochen Voit: Wie kam es, dass Sie in den 50er Jahren von West- nach Ost-Berlin gegangen sind?
Christian Bleyhoeffer: Meine Mutter arbeitete im Osten am Theater. Und für West-Berliner, die im Osten arbeiteten, gab ’s damals einen Umtausch: Im Osten bekam man ja Ost-Geld, was dann vom Senat eins zu eins, 60 %, in West-Geld umgetauscht wurde. Denn man musste ja zum Beispiel seine Miete bezahlen. (…) Meine Mutter hatte ’nen festen Vertrag mit dem Theater und bekam monatliche Gage. Und auf einmal wurde die nicht mehr umgetauscht – das betraf mal dieses Theater, mal jenes. (…) Ich weiß nicht im Einzelnen, welche politischen Umstände da im Spiel waren, wenn die Gelder gesperrt wurden. Aber es konnte passieren, dass man drei oder vier Monate kein West-Geld bekam. Und damals waren die Umtauschquoten zwischen eins zu sechs und eins zu zehn, also für zehn Ost-Mark bekam man eine West-Mark. Irgendwann konnte meine Mutter dann die Miete nicht mehr bezahlen. Und als sie eine Wohnung in Ost-Berlin angeboten bekam, sind wir rübergezogen. Das war alles kein Problem, weil man ja hin und her konnte. Ich hatte ja meine ganzen Freunde, Bekannten und Verwandten in West-Berlin. Aber es war ’ne schöne Wohnung und die war bezahlbar.
War Ihnen die politische Tragweite dieser Entscheidung bewusst?
Nein. Es änderte sich ja nicht viel. Ich arbeitete weiter im RIAS, machte weiter mein Synchron auch im Westen. Bis ich dann auf die Busch-Schule ging …- also die hieß damals noch nicht Buschschule, sondern Staatliche Schauspielschule Berlin.
Was haben Sie beim RIAS gemacht? Sprecher?
Ja, Kindersprecher und jugendlicher Sprecher im Hörspielbereich. Ich war einer der ersten Sprecher als „RIAS-Kind“ bei „Onkel Tobias“. Aber die Arbeit war sehr vielfältig. (…)
Ab wann gingen Sie auf die Schauspielschule?
Ab 1952.
„Sie war schon eine sehr begehrenswerte Schule!“
Hatte die Schule damals auch schon diesen guten Ruf?
Sie hatte noch nicht diesen sehr guten Ruf, den sie später hatte und den sie jetzt noch hat. Aber sie war schon eine sehr begehrenswerte Schule. Heute gibt es natürlich andere Schauspiel-Erkenntnisse, andere Lehrmethoden – das ist sicherlich besser als damals. Aber wir hatten schon auch sehr gute Dozenten.
Gab es Schauspieler, an denen man sich im Unterricht orientiert hat? Vorbilder sozusagen?
Ja. Es war gang und gäbe, dass man sich alte Filmaufnahmen ansah. Es gab Schauspieler, an denen man sich orientiert hat. Das war zum Beispiel Willy A. Kleinau, das war auch Ernst Busch.
Wurden auch Theaterbesuche von der Schule organisiert?
Nein, das brauchte man nicht. Man ging ins Theater. Das kostete für Studenten 50 Pfennig. Und ich war sehr sehr viel im Theater. Es gab dann allerdings eine Zeit, da wurde es nicht gern gesehen, wenn man ins Brecht-Ensemble ging; ’52, ’53 war das, ’54 wurde es schon anders. Das hatte auch mit Stanislawskij zu tun. ’53 war ja die große Stanislawskij-Konferenz, und die einen waren für ihn, die anderen gegen ihn. Stanislawskij war eben russisch, und dieses Durchdrücken eines russischen Geschmackes, was immer das auch sein sollte, dieser stalinistische Naturalismus, der auch gelehrt wurde, das war schon ganz schön schlimm.
Wofür stand Stanislawskij?
Er war einer der ersten Regisseure des 19. Jahrhunderts, der eine durchdachte wissenschaftliche Arbeit für den Schauspieler geleistet hat. Seine große Zeit war die Zeit von Tschechow, von Ibsen. Also der beginnende Realismus beziehungsweise Naturalismus. Und die Genauigkeit ist was Wunderbares: zu fragen, warum einer so dasitzt und warum einer so spricht. Hier wurde sowohl geschichtlich eingeordnet, als auch biografisch und charakterologisch; das Schauspiel wurde interpretierfähig. Das war gegenüber den alten Barden, die wussten, dass eine Königin so und nicht anders dazusitzen hat, ein großer Fortschritt. (…) Das Übertriebene, das Opernsängerhafte sollte verschwinden. (…) Und damit war Stanislawskij ein sehr angefeindeter und gleichzeitig sehr begeistert aufgenommener Mann. Dann hat man einen großen Fehler gemacht …Ich habe schon sehr früh von Stanislawskij gehört, da war ich sieben Jahre alt. Meine Mutter hatte das Buch „Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst“. Naja, da hab ich, dann öfter drin rumgeblättert. Es ist wirklich gut – aber was wurde gemacht? In der DDR wurde es zum Standardwerk erhoben. Und was macht man, wenn man in der Schule gezwungen wird, etwas zu lesen? Man liest es nicht. Da kommt dieser natürliche Trotz. (…) Und das Brecht-Theater war für uns etwas sehr Neues, nicht immer Begeisterndes, weil es auch sehr ernüchternd sein konnte. Es schien etwas zu fehlen, also Klassikeraufführungen am Deutschen Theater waren schon etwas anderes, aber Brecht war für uns prägend.
Wie verhält sich Stanislawskij zu Brecht?
Das waren Gegensätze. Stanislawskij ist zwar bereits 1938 gestorben, aber die Auswirkungen seiner Lehre waren noch deutlich zu spüren. (…) Er hatte viele Jünger, die das zum Teil sehr streng ausgelegt haben, hinzu kamen schlechte Übersetzungen. (…) In meiner Ausbildung gab es aber mitunter beides: Es kamen auch Lehrer zu uns, Schauspieler und Regisseure, die klar zu Brecht tendierten. Die haben uns auch dementsprechend unterrichtet. Und wir gingen, privat jedenfalls, ins BE. Wir hatten Wissenschaftsdozenten wie Heinar Kipphardt, Götz Friedrich und Wolfgang Langhoff, die diese Linie vertraten und auch liebten. Wobei Langhoffs Ansatz fast so ein Zwischending zwischen Brechts und Stanislawskijs Lehre war.
Wo lag denn der größte Gegensatz zwischen Brecht und Stanislawskij?
Sie waren sich nicht einig in den Grundanschauungen. Für Stanislawskij spielte der Begriff des Charakters eine große Rolle, der für Brecht keine Rolle spielte. Für den kam es auf die Frage der Haltung an und auf die Verhaltensweise eines Menschen in bestimmten Umständen. Also: Die Figur war immer eingeordnet in das Ensemble gesellschaftlicher Kräfte. Bei Stanislawskij war es, sagen wir mal, Gefühltheater, starkes echtes Gefühl. Was wichtig zu seiner Zeit war, also um 1890, weil da eben ein, aus heutiger Sicht, schlimmes Theater gespielt wurde. (…) Bei Brecht ging es immer auch um die Zeit. Typisch für ihn ist, was auch bei „Mutter Courage“ am Anfang steht: Wann es spielt, wo es spielt, wie die Umstände sind.
Gehört das auch zum Lehrhaften bei Brecht?
Ja. Aber bei allem Didaktischen war Brecht, glaube ich, ein großer Spieler. Das gilt übrigens auch für Manfred Wekwerth, dem man auch zuschrieb, dass er didaktisch sei. Ich habe ihn bei der Arbeit anders kennengelernt; der war manchmal nicht zu halten, weil er selbst auf die Bühne gehen und vorspielen wollte. Das ist interpretatorisch oft subjektiv. Aber das ist der grundlegende Unterschied. Leider wurde das in der DDR hochstilisiert, da gab es die Stanislawskij-Dogmatiker, und das kam ja auch aus dem großen Russenland … Und Brecht war ja nun auch in den USA gewesen – war der überhaupt Kommunist? Es war kompliziert mit ihm. Sein größter Trick ist ja gewesen, dass eben die Helene Weigel als eingetragene Intendantin das Berliner Ensemble geführt hat und nicht er. Das war ein geschickter Schachzug. Aber wenn man das Ganze mal zurückverfolgt: Natürlich kannte Brecht in den 20er Jahren seinen Stanislawskij – ich weiß nicht, ob sie sich persönlich kannten. Die Gastspiele des Moskauer Künstlertheaters mit den Stanislawskij-Inszenierungen haben ja in Deutschland Riesenbeifallsstürme ausgelöst, wenn man den Kritiken glauben darf. Das war damals noch was Neues. (…) Die Weiterentwicklung fand dann in den USA statt bei Strasberg. (…)
„Ich hatte drei für mich wesentliche Begegnungen mit Busch.“
Welche Rolle hat nun Ernst Busch für Sie gespielt? Haben Sie ihn erst an der Schauspielschule wahrgenommen oder schon früher?
Schon früher. Ich hatte, wenn ich ’s mal kategorisiere, drei für mich wesentliche Begegnungen mit Busch. Bei der ersten war ich 12 Jahre alt, das war kurz nach dem Kriege im Künstlerklub Die Möwe. Ich erinnere mich noch, dass ich mit meiner Mutter dorthin ging. Die Möwe war in der Luisenstraße, die Russen hatten diese Einrichtung gegründet und nach Tschechows Stück benannt. In der Anfangszeit war das auch ein Hort für hungernde Künstler. (…) Da sah ich einen Mann, der mit ’nem merkwürdigen, heute würde man vielleicht sagen: Trenchcoat rumlief und ’ner Baskenmütze auf, und ich weiß noch, dass ich dachte: Was will denn der hier in einem Künstlerklub? Der sieht ja aus wie ’n Kumpel aus ‚m Werk. Und dann hörte ich und sah ich, dass der sehr allgemein geachtet schien und dann wurde mir gesagt, wer das ist. (…) Dann bemerkte ich auf einmal die Stimme, dieses Metall in der Stimme. Dieses Durchdringende hatte seine Stimme nicht nur, wenn er sang. Das war nicht nur angreiferisch, er konnte auch ganz zart dabei sein. Und die Begegnung war jetzt, dass er zu uns kam und mit meiner Mutter sprach, die ihn schon kannte, weil sie in einem Stück mitarbeitete, wo er spielte. Das war im jetzigen Gorki-Theater, das war damals das Theater im Haus der Kultur der Sowjetunion.
Busch sagte: „Ich bin nichts Besonderes – warum soll ich was Besonderes zu fressen kriegen?“
Wissen Sie noch, welches Stück das war?
Das weiß ich nicht mehr … „Nachtasyl“ war es nicht, das war ja im Prater, weil die Volksbühne noch sehr kaputt war. Jedenfalls bekam Busch damals Pajok, das sind Fresspakete gewesen von den Russen für ausgesuchte Leute. In den Westzonen waren ’s die Care-Pakete, hier hieß es Pajok. Und Busch, und das habe ich später noch mal erlebt auf einer Probe, verteilte seine Pakete an andere Leute. Er wollte nichts haben und sagte: „Ich habe was zu essen, ich brauch das nicht.“ Und er hat mir und meiner Mutter was gegeben und hat auch dazugesagt warum, ganz simpel: „Ich bin nichts Besonderes – warum soll ich was Besonderes zu fressen kriegen? Während die anderen nichts zu fressen haben und hungern müssen.“ So hat er denen, die er kannte und die bedürftig waren, was gegeben. Und das geschah öfter. Und das war ein Grundzug seines Charakters, den ich immer bei ihm, auch später, wieder entdeckte: offene Augen für andere Leute haben und auf sie zugehen …
„Sein Reden hatte immer etwas Behauptendes und zugleich etwas Überzeugendes.“
Bekam Ihre Mutter kein Pajok?
Nein, das bekamen nur die ersten Leute sozusagen. Ich bin mir nicht sicher, es kann sogar sein, dass es damals in der Möwe ausgegeben wurde. (…) Meine Mutter kannte Busch vom Theater, sie war Schauspielerin und Souffleuse. (…) Das war ganz merkwürdig, da haben sich anscheinend zwei getroffen … Meine Mutter wollte als Kind immer, durfte aber nicht, zu Albert Schweitzer und Missionarin werden. Und das, was Busch machte, fand sie groß und gleichzeitig selbstverständlich, weil sie es auch gemacht hätte, wenn sie gekonnt hätte. Also, da traf sich etwas, ein solidarisches Verhalten. Nennt man es Urchristentum? Oder Urkommunismus, was ja ähnlich ist? Dieses scheinbar Keinen-Unterschied-Machen, also nicht: „Ich bin großer Künstler, du bist kleiner Künstler!“, sondern dieses selbstverständlich Kollegiale, weniger Kumpelhafte, ich würde eher sagen: dieses solidarische Verhalten. Er konnte also ausgesucht höflich sein im Umgang. Er war kein Rülps. Aber er konnte auch sehr deftig sein. (…) Sein Reden hatte immer etwas Behauptendes und zugleich etwas Überzeugendes. (…)
Das fiel Ihnen aber nicht alles bei Ihrer ersten Begegnung auf …
Nein, aber es gab kurz darauf ein Wiedersehen, gewissermaßen ein Nachklang dieser ersten Begegnung. Da festigte sich mein Eindruck, den ich als Kind von ihm gewann und den man als Bewunderung bezeichnen kann. Es war so, dass ich mit 14 Jahren in einem Stück mitspielte und Busch im selben Haus zu tun hatte. Er spielte in der „Optimistischen Tragödie“, und ich ging immer, wenn ich nichts zu tun hatte, hinüber zu dieser Produktion und schaute zu. Dabei bemerkte ich etwas: Er stand immer auf der Bühne, wenn er zu spielen hatte, und er saß immer im Zuschauerraum, wenn er nicht dran war, und zwar hinter der Reihe des Regisseurs. Das heißt, dass er auch als Schauspieler immer genau beobachtete und sich in die Regie-Perspektive hinein versetzte. (…) Auch sein Umgang mit dem Regisseur gefiel mir, das war Wolfgang Langhoff. Die beiden kannten sich von früher und sprachen auch öfter miteinander – dabei hat sich Busch, so weit ich sehen konnte, nie in den Vordergrund gespielt, sondern er hat Beobachtungen mitgeteilt. Das war für ihn wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit.
Wie fanden Sie Busch als Schauspieler?
Ich hab ihn schon sehr früh gesehen in „Nachtasyl“ im Prater. Ich hab ihn im Deutschen Theater als Julius Fucik gesehen, und das war für mich ein ganz merkwürdiges Erlebnis: Es hatte den Anschein einer Lebenswahrheit und trotzdem war ’s Kunst. Hätte ich damals schon geschrieben, hätte ich den Versuch gemacht, diesen Eindruck so mal aufzuschreiben. Es hatte teilweise auch mal was Langweiliges, wie es auch das Leben hat, und dann packte es einen wieder … Durch Busch ist mir eine politische Haltung in einer Rolle klar geworden … nein, stimmt gar nicht, nicht klar geworden, ich habe sie bemerkt – klar geworden hieße ja, dass man drüber nachdenkt. Obwohl ich ihn kurz zuvor noch ganz anders gesehen habe, etwa in „Nachtasyl“ in einer lustigen Rolle als Baron. (…)
Diese Bewunderung für Busch wurde bei Ihnen also mit der Zeit immer größer …
Ja. Er wurde als Vorbild ja auch an der Schule genannt. Aber da wurde vor allen Dingen das politische Verhalten betont.
Das hat Sie aber doch eher genervt. Vorhin haben Sie gesagt, dass einen gerade der Schulstoff nicht sonderlich interessiert …
Genau, aber ich hab ’s ja selbst gesehen.
„Dessau hat schon mal angeboten, einem den Flügel in die Schnauze zu schieben.“
Die Schule konnte Ihnen den Spaß an Busch nicht verderben?
Nee. Aber nun hatte ich auch drei Jahre lang Unterricht bei Paul Dessau. (…) Und Dessau hat auch über Busch gesprochen, sehr positiv und sehr kämpferisch. Kann mir vorstellen, dass die beiden sich oft angeschrien haben, so wie ich Dessau kennengelernt hab, wie der getobt hat. Dessau war Choleriker. Wenn man nur ganz leise zu ’nem Mitstudenten ’ne Bemerkung machte, dann donnerte er los und hat spontan angeboten, dass er einem den Flügel in die Schnauze schiebt. Oder einem was abreißt, fing sich dann wieder und fügte hinzu: „aber nicht das, was Sie denken“ und so. Er hatte schon auch Humor. Er kannte auch die unterschiedlichen Theaterströmungen vor ’33 und natürlich auch Busch. (…)
Busch hingegen war auf Dessau nicht gut zu sprechen nach der Affäre um Brechts „Herrnburger Bericht“, zu dem Dessau die Musik geschrieben hatte …
Das stimmt. Busch war eben ein Gerechtigkeitsfanatiker und er war gleichzeitig auch selbstgerecht. Wenn er etwas meinte, hat er es gesagt und behauptet und nicht groß abgewogen: vielleicht oder vielleicht nicht – so etwas gab ’s nicht. Er hat alles nur in einer Richtung dargestellt, und dann musste man ihm das Gegenteil beweisen, aber richtig. (…) Ob Dessau tatsächlich feige war, wie Busch geglaubt hat? Ich weiß es nicht. Dann war Eisler auch feige. Wo fängt das an? Die Oper „Das Verhör des Lukullus“ ist verboten worden, und sie waren deswegen bei Wilhelm Pieck. Und Dessau hat uns gesagt, er bittet uns, ihn nicht danach zu fragen. Er sei Bürger dieses Staates und erkenne das an, was der Präsident gesagt hat.
„Eisler wurde durch den Schmutz gezerrt.“
Er war loyal?
Ja, vielleicht auch berechnend. Dessau ist nicht durch den McCarthy-Ausschuss gegangen, aber Brecht und Eisler. Bei Eisler hat sich gezeigt, dass er sich nicht verteidigen konnte, man konnte Eisler sehr angreifen, das hat sich hier in der DDR ein zweites Mal gezeigt. Durch das BE, durch Wekwerth kenne ich die ganzen Akten um den Eisler-Prozess, der ja praktisch hier 1953 stattgefunden hat, da gab ’s bis zum 17. Juni die sogenannten Mittwochsgespräche in der Akademie, wo auserlesenes Publikum kam. Und da hat Ernst Fischer, der Philosoph aus Österreich, über einen Text von Eisler gesprochen, und zwar über „Faustus“, aus dem Eisler ’ne Oper machen wollte und sollte. Und es war ein ganz anderer Faus als der Goethe’sche Faust, Eisler befragt den deutschen Wissenschaftler. Damit war eine Diskussion ausgelöst, die sehr gut gemeint war, die aber das Gegenteil bewirkte: Jetzt wurde sich mit dem „Faustus“ beschäftigt. Und da traten Leute auf … das war, ich hab die ganzen Dokumente gelesen, teilweise entsetzlich, wie die Eisler angegriffen haben. Das landete dann in der Zeitung. Eisler, der immerhin die Nationalhymne der DDR komponiert hatte, wurde in einem Leitartikel im Neuen Deutschland aufgefordert: „Go home, Ami!“ – Er wurde durch den Schmutz gezerrt wegen seinem „Faustus“. Er wäre ein Verräter und so weiter. Es wurden in so einem Fall dann immer Arbeiter vorgeschickt, die das behaupteten.
Die Vorwürfe lauteten: Formalismus …
… natürlich Formalismus, und es ging konkret auch um das Antlitz der Klassik: Der deutsche Faust ja, „wer immer strebend sich bemüht, den werden wir erlösen“! Und hier ging es eben um das Versagen des Faust, um die dunkle Seite des Faust. Diese Auseinandersetzung war schlimm damals. Ich weiß nicht, wie Busch sich da verhalten hat. Das lässt sich aber vielleicht im Akademie-Archiv nachschauen. Es müsste dort stehen, wer alles gesprochen hat bei diesen Mittwochsgesprächen. Felsenstein war auch dabei, der Intendant der Komischen Oper. Felsenstein ist aufgestanden und hat sinngemäß gesagt: „Ich dachte, unter Genossen arbeitet man produktiv, aber hier wird ja nur gehetzt!“ – Er hat angeboten, Eislers Stück sofort zu bringen, wenn ’s fertig ist. Das Stück war aber dann sehr lange verboten. Aufgeführt wurde es schließlich in der Bundesrepublik und dann am Berliner Ensemble, und da war ich bei der ganzen Erarbeitung mit dabei.
Das Stück ist aber Fragment geblieben …
Ja. Es war keine Oper, Eisler hatte nicht mehr weiter komponiert, er hatte ja noch nicht viel zusammen. Ich fand ’s sehr interessant, weil alles zur Oper drängt: Die ganzen Texte sind, wenn sie vom Schauspieler nur gespielt werden, zu opernhaft. Sie haben Metaphern, die man in der Oper verwenden kann, auch Erkenntnisprozesse, wie das auch in der Oper „Einstein“ ist von Paul Dessau – so auch hier. (…) Eislers Text orientierte sich an der historischen Faustfigur und am Puppenspiel vom Doktor Faust. Und es ging um das Versagen der deutschen Wissenschaft, das wurde ihm angekreidet. Und Eisler ist ja dann frustriert abgehauen nach Österreich, hat dann sogar einen Bettelbrief geschrieben an die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, dass man ihm erlauben möge, wieder hier zu leben.
Die zweite Begegnung mit Busch
Aber man hatte ihn ja nicht direkt rausgeschmissen …
Aber man war, glaub ich, ganz froh, dass er weg war. Weil er auch ein Unruhestifter war – ähnlich wie Busch. Busch war immer aufräumend, aufgeräumt, Unruhe stiftend. Das konnte durchaus sachlich sein, aber es gab immer Dinge, auf die er aufmerksam machen wollte. Damit komme ich zu meinem zweiten Eindruck von Busch, eine eigentlich indirekte Begegnung, das ging über andere Studenten an der Schauspielschule. Diese Studenten sangen 1952 bei seinen Plattenaufnahmen mit. Ich glaube, es war in den Weihnachtsferien. Busch mochte Studenten und wollte die auch da drin haben. Ich nehme an, dass er bewusst Schauspielschüler genommen hat. Er wollte immer populär sein, das heißt: Er wollte immer verständlich sein. Und das ist bei Sängern nicht immer gegeben, da ist es halt ein schöner Gesang. Ich meine, er konnte singen und er konnte schön singen, aber es war auch immer hart und schneidend, was er sang. Und er wollte die Brecht’sche Haltung dazu haben, und da hat er Schauspielstudenten genommen. Und dafür wurden einige Studenten von der Leitung bestraft.
Warum?
Weil sie mit Herrn Busch, der im Brecht-Ensemble war, nachts (!) Aufnahmen gemacht haben. Heute wäre das halt irgendein Job. Damals aber gab es Strafen, für einige sogar Verweise von der Schule. Es traf die Abgänger, die zwei Klassen über mir waren. Ich war damals gerade ’n Vierteljahr in der Schule. Ich glaube, Lizzy Tempelhof, hat es getroffen, sie war später Schauspielerin am Deutschen Theater. Anne Dessau wurde auch deswegen suspendiert, sie ist später Journalistin und Theaterkritikerin geworden.*
War das ein richtiger Skandal?
Ja, natürlich, aber wir hatten öfter Skandal. Ruhig war es da nie. Und Paul Dessau trug einiges dazu bei. Busch hat man dagegen nie gesehen in der Schule zu der Zeit. (…)
War das der Grund für die Bestrafung, dass es um Busch ging?
Man durfte einfach nicht nebenbei arbeiten, es herrschten strenge Regeln wie auch heute am Reinhardt-Seminar. Aber es ging auch um Busch und die Arbeiterlieder. Und hinzu kam noch, was ich damals nicht wusste, der Vorbehalt gegenüber Busch als Kapitalist, weil er ja eine eigene Firma hatte und Geld bezahlte für solche Dienste. (…) Die Schüler wollten gerne mit Busch singen und als Chor mit ihm auf der Bühne stehen. Aus Sicht der Schule sollten die Schüler aber erst fertig sein mit der Ausbildung und dann auf der Bühne stehen. (…)
(Ende der ersten Kassettenseite)
Erinnern Sie sich noch, ob Busch beliebt war bei Ihren Mitstudenten?
Ja. Er war beliebt, er war bewundert.
Wurde er nicht auch kontrovers diskutiert?
Nicht von uns.
Das heißt, Sie waren alle Fans?
(Pause) Ja, das hatte auch was mit Brecht zu tun. Wir waren für Brecht, obwohl wir ihn vielleicht damals gar nicht so richtig verstanden haben, weil wir nicht unbedingt für Stanislawskij sein wollten und das, was die Schule so bestimmte. Aber wir haben ja Busch nun gesehen und haben die enorme Vitalität, die enorme Künstlervielfalt gesehen. Ihn zu sehen als Jago, am nächsten Abend als Julius Fucik, dann als Galileo Galilei oder in der „Mutter“ als den Arbeiter Lapkin – das war schon immer wie ein Wunder. Einmal haben wir ihn erlebt in einer Vorstellung von „Othello“, Willy A. Kleinau spielte den Othello, Busch den Jago. Und da gibt es ein Bild, wo einer von der Seite kommt und einer von der anderen Seite kommt. Und ich saß bei einer Vorstellung drin, da kommen die aufeinander zu, gucken sich an, fangen an zu lachen und gehen wieder ab. Der Vorhang fiel. Der Vorhang ging wieder auf. Die kamen, sind nicht mal bis zur Mitte gekommen, prusteten und gingen ab. Das ist das dritte Mal versucht worden, da kamense kaum mehr raus vor lauter Lachen. Das Bild wurde an dem Abend nicht mehr gespielt. (…) So etwas macht auch sehr menschlich.
Die dritte Begegnung mit Busch
Haben sich die Leute im Publikum auch amüsiert?
Naja (lacht), erst war die Reaktion „Was is’n da los?“, manche fanden ’s empörend, wir fanden ’s natürlich sehr sympathisch. (…) So, und dann haben wir Studenten unser Praktikum im „Faust“ gemacht. Und da hab ich Busch als Mephisto in unterschiedlicher Art proben sehen. Ich habe gesehen, wie er probiert hat. Erstes hervorstechendstes Merkmal: immer da, ob das morgens um zehn war oder bei der Abendprobe, er war immer da. „Nee, ich hab heut keine Lust“ – so was gab s nicht. Nein, volle Energie! Dann auf den Proben: sehr kritisch, wie eine Kamera beobachtend, nie aussteigend dabei; hinterher darüber sprechend, sich mitbeteiligend am Fertigungsprozess. Dann hat er auch uns Ratschläge gegeben. (…) Wir hatten mit manchen Sachen Schwierigkeiten. Wir glaubten, wir wären sehr gut ausgebildet, aber Wolfgang Langhoff bewies uns, dass das noch längst nicht ausreichte, was wir konnten. Und Busch hatte vollstes Verständnis für die Entwicklung von jungen Leuten, hatte ich den Eindruck. (…) Wir waren beim Osterspaziergang drin, wir waren in der Walpurgisnacht drin und bei den Geistersachen dabei. Es war spannend, die Proben waren immer spannend. Busch hatte einen Partner als Faust, der leider nicht so gut war; aber auch wie er mit dem sich kurzerhand abgesprochen hat, das haben wir alles beobachtet; wie solche Stars, würde man heute sagen, miteinander umgehen – das war schön zu sehen. Auch weil Busch sich selbst nie geschont hat, immer Hinweise gab und nie beleidigend wurde. Wenn irgendjemandem was passierte – eine Studentin ist umgeknickt – half er sofort, erkundigte sich nach dem Arzt. Also, er war einfach da und hatte eine solidarische Haltung auch uns gegenüber. Das war für uns auf einmal auch ein politisches Verhalten, diese sehr menschliche Haltung.
Sie sagen, sein Partner sei nicht so stark gewesen. Hat er die Neigung gehabt, Kollegen auch an die Wand zu spielen?
Das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht eher sich gegenseitig hochzuspielen – das kam vor. Ich glaube, er hatte mal was mit Hans Albers am Hebbel-Theater zu spielen … Ob er andere an die Wand gespielt hat … sicherlich, wenn sie nicht stark genug waren. Aber ich habe ihn so nicht erlebt. Ich habe erlebt, dass er teilweise unter wahnsinnigen Schmerzen litt, dass er eigentlich nicht richtig sprechen konnte. In einer Vorstellung ging er mit einem Mal ab von der Bühne, wo wir wussten, er musste noch nicht abgehen. Er stand dann an der Seite mit einer Bürste und hat seine Backe gebürstet und ist dann wieder rausgegangen und hat weitergespielt. Also, diese Lähmungserscheinungen oder Taubheitserscheinungen waren offenbar ständig da. Trotzdem kümmerte er sich um andere, das fiel mir auch in der Kantine auf. Ich fand, er war Star, aber immer sehr kameradschaftlich und kollegial.
„Busch hasste Schluderei.“
Ausfallend wurde er nie?
Ich hab ihn laut erlebt. Ich glaube, er konnte ausfallend werden, wenn etwas nicht klappte, wenn er meinte, dass etwas verschludert worden war. Er hasste Schluderei. Da konnte er, das weiß ich auch von meiner Mutter, sehr bedingungslos werden. Da sagte er einem die Meinung, da wurde auch nichts entschuldigt. Ob mit Recht, oder ob der Ton dann immer recht war, ist sicher zu hinterfragen. Aber vom Prinzip her hatte er Recht: Wenn etwas Schlamperei ist, dann ist es Schlamperei. Ich weiß von mir selber, dass ich als Schauspieler in einer Hauptprobe einem Techniker ’nen Eimer an den Kopf geworfen hab. Ich hatte ’nen Monolog und die quatschten! Die quatschten laut! Die störten mich, ich konnte mich selber nicht mehr hören. Ich verlangte einfach, das man weiß, dass das kein Musiktheater ist, wo das Orchester auch mal was zudeckt und wo es laut sein kann … Dadurch könnte ich verstehen, dass er in gewisser Weise unduldsam war.
Haben Sie aber nie erlebt?
Fordernd habe ich ihn erlebt. Sehr fordernd. (…) Ich hab ihn auch nie besoffen gesehen. Er war auch immer pünktlich. Für uns war er ein Vorbild. Für mich speziell waren es diese drei Begegnungen, die mein Bild von Busch ausmachten. Durch ihn erfuhr ich, zunächst unbewusst, dass eine politische Haltung und Erfahrung mit in eine Rolle hinein wirken können. Warum? Auf Grund von Nachdenken, von Erlebtem, von Erkenntnissen. Erst später, erst als ich auf der Schule war, habe ich gehört, dass er im KZ war und habe den Film „Kuhle Wampe“ gesehen. Ich wusste vorher nichts davon. Ob meine Mutter das wusste, weiß ich gar nicht. Busch hat übrigens auch zu Weihnachten, der „Faust“ hatte erst am Feiertag Premiere, uns allen etwas in die Hand gedrückt – völlig unaufwändig, sehr selbstverständlich. Also nicht so: „Kommt Kinder, ich geb euch mal einen aus!“
Diese „Faust“-Proben und Auftritte haben Sie in sehr guter Erinnerung …
Ja, in einer blendenden Erinnerung. Auch weil er als Mephisto nicht der Böse war, sondern der Verführer. Das war damals für mich eine neue Sicht.
Hat Gründgens den Mephisto nicht auch als Verführer dargestellt?
Ja, aber ganz anders. (…)
Wenn ich mir Gründgens anhöre, wie er singt „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“, dann hat das für mich was sehr Diabolisches. Und ich habe das Gefühl, dass da ein begnadeter Schauspieler singt, der extrem wandlungsfähig war, der ganz ganz viel spielen konnte. Bei Busch habe ich das Gefühl, dass er vielleicht nicht so viele Register ziehen konnte … oder ist das ein falscher Eindruck?
(Pause) Na, es ist erst mal ein Eindruck. Ob der richtig oder falsch ist – wer will das beurteilen? (…) Gerade weil Sie das Lied aus dem Film „Tanz auf dem Vulkan“ erwähnen: Hat der Gründgens da nicht auch etwas Metallisches in der Stimme ähnlich wie ein Busch?
Ja.
Aber es sind Grund legende Unterschiede. Ich weiß nicht, ob man es das Proletarische nennen kann bei Busch. Bei Gründgens ist es dann das Hyperintellektuelle. (Exkurs zu Gründgens und seinen Hilfeleistungen für jüdische Künstler im Nationalsozialismus)
Halten Sie es für diffamierend, was Klaus Mann über Gründgens geschrieben hat?
Ich glaube, da war viel Eifersucht dabei. Ich meine, dieses Metallische bei Gründgens hat ja auch was Schwules.
Er war nun mal schwul.
Ja, natürlich. Es gab ja damals den Spruch: „Hoppe, hoppe Gründgens / Kriegen keine Kindgens / Kriegen se doch mal Kindgens / Sind se nich von Gründgens.“ Das hat sich ja bewahrheitet. Naja, das kam natürlich auch in seiner Stimme raus. Seine Stimme war intellektueller, ja Oscar Wilde’scher Natur. (…) Seine Rollen sind schon, wenn man sich seine Diktion anhört und dann mit dem Text vergleicht, intellektuell herausgearbeitet. Und bei Busch ist eben das Wesentliche der politische Gehalt.
Würden Sie Parallelen sehen zwischen den beiden, was politische Verführbarkeit angeht?
(Pause) Weiß ich nicht. Ich glaube, dass Busch kompromissloser war. Dass er gegen etwas angeht oder sich eben zurückzieht. So wie er später in der DDR gelebt hat … man hörte ja ’ne Weile nichts von Busch. Was war da? Er hat sich ja selber teilweise zurückgezogen von bestimmten Anlässen und wollte nicht immer als Kultfigur vorgezeigt werden. Bis man ihn dann irgendwann wieder ausgekramt hat. Dann wollte man, dass er wieder auftritt. Vorher wollte man nicht, dass er stört. Er störte wirklich. Aber ’ne Störung muss man ja nicht immer als was Negatives und Schädigendes sehen. Wenn ich ’nen Gleichlauf durch ’ne Frage oder durch eine andere Erkenntnis störe, muss ich doch nicht schädigen wollen. Ich glaube schon, dass der Busch ein, würde ich heute sagen, beweglicher Kommunist war.
Inwiefern? Hat er sich denn bewegt als Kommunist?
In den Verläufen der Zeit. Wenn sich Dinge verändern – im Gegensatz zur politischen Seite, wo man es zum Teil mit Betonköpfen zu tun hatte. Ich glaube, er war für viele ein Unruhestifter. Wie Brecht auch. Wobei der auch zwei Gesichter hatte, wie seine Haltung zum 17. Juni zeigt. Aber Busch hätte sich ja kaufen lassen können. Das hätte er können. (…)
„Man kam an ihm nicht vorbei: Wenn man ein Lied von Tucholsky sang, spukte einem Busch im Kopf rum.“
Wie haben Sie Busch als Sänger wahrgenommen? Haben Sie sich seine Platten gekauft?
Ja, ich habe ihn auch als Sänger geschätzt. Und ich habe mir natürlich die Platten gekauft – wenn sie erhältlich waren. Ich mochte die Ironie, die in vielen seiner Lieder war, vor allem, wenn er Tucholsky sang. Ich fragte mich: Wie macht man das? Singen und dabei ironisch sein. Es war schon etwas zum Studieren. Gleichzeitig war er aber auch störend. Man kam an ihm nämlich nicht vorbei: Wenn man ein Lied von Tucholsky machte, spukte einem Busch im Kopf rum. Er war für eine Zeit lang so prägend gewesen, so wie für viele Gisela May prägend war, dass man sich als Interpret schwer davon lösen und selbst eine Haltung zu dem Lied entwickeln konnte. Man musste sich richtig lösen, und das war nicht einfach. (…) Es färbte zwangsläufig ab.
Haben Sie selbst auch diese Lieder gesungen?
Ja, zum Teil. Lieder aus der „Mutter“ habe ich gesungen, auch einige Tucholsky- und Spanienlieder zu Programmen und Gedenkveranstaltungen. Das waren Programme, die sich mit der Zeit vor ’45 beschäftigten. Ich habe auch mitgewirkt an politischen Revuen in den 60er Jahren, Paul Dessau hat mit uns solche Dinge einstudiert. Das hat mich auch musikalisch sehr interessiert. Ähnlich wie mich später die „West-Side Story“ interessiert hat. Diese Kombination aus Spielen und Singen, das fand ich reizvoll. (…)
(Exkurs zum Galilei)
Hatten oder haben Sie ein Lieblingslied von Busch?
Ja, das heißt eigentlich sind es drei: „An den deutschen Mond“, „Linker Marsch“ und „Freiheit und Democracy“.
Welche Musik mochten Sie am liebsten, als Sie 18, 20 Jahre alt waren? Außer Busch, meine ich …
Das waren sehr unterschiedliche Sachen: die Wassermusik von Georg Friedrich Händel und den Bolero von Maurice Ravel. Ich hörte auch gerne Jazz, das Eje Thelin Quintett aus Dänemark und Benny Goodman, aber auch Schlager von und mit Rita Paul. (…)
Gingen Kunst und Propaganda zusammen bei Busch und seinen Liedern?
Ja, klar. Ich glaube, da hätte man sogar sein großes Einverständnis, dass er Propagandist für den Kommunismus war. Das hatte auch zur Folge, dass er mit bestimmten real existierenden Umständen nicht einverstanden war. Aber er hat natürlich auch gesungen für den Genossen Stalin und von Johannes R. Becher „Dank Euch, Ihr Sowjetsoldaten“. Das mag ja ganz hübsch sein, aber man kann die nicht mehr hören, diese Hymnen. (…) Wenn ich jetzt versuchen sollte, all das einzuordnen und erklären sollte, warum er so war, wie er war …Bei allem, was er machte, merkte man, dass er das, was er für Unrecht hielt, nicht leiden konnte. Und diese Haltung kam, glaube ich, aus seiner Zeit der 30er Jahre, als es auf die Unterscheidung Freund – Feind extrem ankam. Es gab damals nur schwarz – weiß. Vielleicht ist Busch davon doch nie ganz weggekommen.
Interview: Jochen Voit
Foto: Barbara Braun
(Textfassung autorisiert von Christian Bleyhoeffer am 12. Februar 2006)
* Eine telefonische Nachfrage bei Anne Dessau am 16. Januar 2006 ergab ein etwas anderes Bild von den Hintergründen der Suspendierung: Anne Dessau (Jahrgang 1934) berichtet, dass Busch im Sommer 1952 Mitwirkende für Platten- bzw. Probeaufnahmen gesucht habe. „Muh-Gruppe“ habe man das genannt, sagt Anne Dessau, „das waren die Stimmen, die im Hintergrund zu hören waren“. Die Gruppe, die sich dann während der Schulferien in den Räumen der LIED DER ZEIT-GmbH einfand, um verschiedene Busch-Titel zu singen und aufzunehmen, habe aus sechs bis acht Personen bestanden; es seien allerdings keine Schauspielschüler gewesen – sie habe lediglich Lizzy Tempelhof von der Schauspielschule zu den Terminen mitgenommen. Anne Dessau erzählt, dass ihr Kontakt zu Busch bis dahin rein privat gewesen und dass dies letztlich auch der Grund für die Suspendierung gewesen sei. Buschs Lebensgefährtin Tete habe wahrscheinlich an höherer Stelle dafür gesorgt, dass die Schulleitung von der Nebenbeschäftigung der Schülerinnen erfuhr. Der von der damaligen Schuldirektion (Otto Dierichs war der Leiter) genannte Grund für die Disziplinarmaßnahme sei dann auch die Tatsache gewesen, dass man Geld für die Aufnahmen angenommen habe.
Anne Dessau musste zur Strafe für ein halbes Jahr „in die Produktion“, wie es hieß. Sie konnte ihren Arbeitsplatz selbst wählen und arbeitete in Dessau als Punktschweißerin in einer Fabrik für Heizgeräte. Anschließend ging sie zurück auf die Schauspielschule, wo man ihr ein halbes Jahr Ausbildungszeit erließ. Ein Diplom erhielt sie am Ende ihrer Studienzeit nicht. (Vgl. das Interview mit Anne Dessau)

Ingo Boxhammer
über den Pläne-Verlag in Dortmund, die Ostermarschbewegung im Ruhrgebiet und die Pflege des sozialistischen Erbes in der Bundesrepublik
„Bei uns hat mal Udo Jürgens angefragt, ob es nicht Zeit wäre, dass er Arbeiterlieder singt. Da haben wir gesagt: Tu das lieber nicht!“
(Gespräch am 14. Februar 2004 in Castrop)
Ingo Boxhammer ist Jahrgang 1943. Er wächst in Dortmund auf, absolviert eine Lehre als Großhandelskaufmann und studiert anschließend Sozialpädagogik. Als junger Mann tritt er in die Deutsche Friedensunion (DFU) ein und engagiert sich in der Ostermarschbewegung. 1970 gibt er seinen Beruf als Sozialarbeiter auf, um als Geschäftsführer beim bis dahin erfolglosen Pläne-Verlag in Dortmund einzusteigen. Boxhammer ist mittlerweile aus der DFU ausgetreten und Mitglied der DKP geworden. Bis 1976 leitet er den seit 1957 bestehenden Pläne-Betrieb, professionalisiert die Arbeitsabläufe, stellt auf EDV um und kümmert sich um Künstler wie Hans Dieter Hüsch, Dieter Süverkrüp und Ernst Busch. In dieser Zeit wird Pläne zu einem der bekanntesten linken Plattenlabels in der Bundesrepublik. Als Boxhammer aufhört, hat der ehemalige Ein-Mann-Betrieb 25 Angestellte und gute Geschäftszahlen. Ins Verlagsgeschäft ist Ingo Boxhammer seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Bis heute arbeitet er als Sozialarbeiter, Supervisor und Familientherapeut. Politisch engagiert er sich in der Linkspartei.
Unser Gespräch findet im lichtdurchfluteten Wohnzimmer Ingo Boxhammers statt. Viel Weiß, schöner Blick ins Grüne. Es gibt Wasser und Kaffee. Im Hintergrund läuft Klassik-Radio.
Jochen Voit: Als Chef des Pläne-Verlags hatten Sie mit ganz verschiedenen Künstlern aus dem linken Spektrum zu tun. Unter anderem auch mit Ernst Busch …
Ingo Boxhammer: Ja, wir hatten Kontakt zu sehr vielen namhaften Sängern, Kabarettisten und Gruppen. Das ging von Joan Baez bis Ernst Busch. Das waren zum Teil ganz schwierige Leute. Und einer der schwierigsten war der Busch. Das hatte mit seinem Gesundheitszustand zu tun. Er ließ ja die eine Seite so ’n bisschen runterziehen, da war so ’ne Restlähmung im Gesicht. Und er hatte so ’ne Tendenz, zu so ‚m bösen alten Mann zu werden.
Wann haben Sie Busch persönlich getroffen?
Das muss 1973 gewesen sein. Damals waren die Weltjugendfestspiele in Ost-Berlin, und Ulbricht starb genau mittendrin. Da hieß es dann, Ulbricht hätte sich gewünscht, erst nach den Spielen beigesetzt zu werden, und die Spiele sollten nicht gestört werden. Irgend so ’n Zauber wurde erzählt. Und ich bin damals nach Ost-Berlin gefahren als Leiter der sogenannten Transportkommission, ich hatte alle Busse und alle Autos unter mir. Dann kamen die ganzen Vögel und machten Bitte-Bitte, ob sie ’n Auto haben könnten: Gerhard Schröder, Carsten Voigt und wie sie alle hießen. (…) Die konnten gar nicht nah genug rankommen an Erich Honecker und Willi Stoph, um da so ’n bisschen an der Jacke zu ziehen. Schröder vorneweg. (…)
Also, die West-Linken haben versucht …
… die waren nie links! Die waren nie links! Nie! (…) Es ging um Nähe, um Reputation, um Bedeutung. Die gingen ja ganz vorsichtig mit diesen hohen Funktionären um – also, links waren die nie. So wie der Schröder heute nicht links ist, so war der das damals auch nicht.
Sind Sie heute noch links?
Ja, ich denke schon. Das bin ich immer noch.
Was ist denn „links“ für Sie?
Also jedenfalls links von der SPD.
Kann man Links-Sein immer nur definieren, wenn man sagt …
Den Begriff „links“ können Sie immer nur unsauber verwenden. Und links ist immer nur jemand, der sagt: „Was ist mein Interesse? Mein Interesse ist, dass es den tragenden Kräften der Gesellschaft besser geht.“ – Ich sag mal: mindestens so gut wie mir, denn mir geht ’s nicht schlecht.
Heißt das, wenn Sie die „tragenden Kräfte“ ansprechen, dass Links-Sein für Sie untrennbar mit der Arbeiterschaft verbunden ist?
Unbedingt, unbedingt! Das hat sich nie geändert unabhängig von den realpolitischen Entwicklungen. Die waren übrigens schon damals nicht ideal. Zum Teil lief man ja so (hält sich die Hände vor die Augen) durch die DDR.
Waren Sie öfter in der DDR?
Was ist oft? Ich bin drei-, viermal da gewesen zu Verhandlungen mit dem VEB Deutsche Schallplatten. (…)
Die agitierende Putzfrau: Elternhaus und Politisierung
Herr Boxhammer, lassen Sie uns über Ihre Herkunft reden. Können Sie zunächst ein wenig über Ihren beruflichen Werdegang erzählen?
Nach der Schule stand für mich relativ früh fest, dass ich in irgendeiner Weise mit der Jugendarbeit zu tun haben will. Das war aber undifferenziert und unklar, weil ich keine Ahnung hatte, was das wohl für Berufe sein könnten. Irgendwann bin ich dann an Sozialarbeit geraten und bin ans Sozialpädagogische Seminar in Dortmund gegangen.
Haben Sie einen proletarischen Hintergrund?
Nee. Das ist ja oft so bei Linken. Ich komme aus dem Dortmunder Süden, mein Vater war im mittleren Management bei der Dortmund-Hörder Hüttenunion. Er war Chef der Hammerwerke 1 und 2 in Dortmund-Hörde. Gibt ’s heute alles nicht mehr …
War Ihr Vater links?
Nein. Gut, er war später einer der Bezirksvorsitzenden der DFU (Deutsche Friedensunion, JV), aber er kommt ursprünglich aus der rechten Ecke. Mütterlicherseits waren meine Verwandten meist Bauern, sind es zum Teil noch heute: früher arme Leute und heute steinreich, weil sie alle ihr Ackerland zu Bauland gemacht haben. Und da wurde immer deutschnational gewählt bis hin zu dieser Hugenberg-Clique. Nach ’33 waren das ja die Nazi-Wähler. (…) Mein Vater ist ’35 auch in die NSDAP gegangen und war dann auch Waffenträger. Grund waren die vielen Zwangsarbeiter – daher wurde das mittlere Management mit Waffen ausgestattet. Das war auch ein Vertrauensbeweis der Nazis, verstehen Sie? Da kriegte der ’ne 08 und russische Kriegsgefangene. Mein Vater war entsetzt, als er sah, was da passierte: Die waren 14 Tage da, dann waren die tot. Die kriegten ja nichts zu essen, nur Wassersuppe. Aber das war ein Nichtsehenwollen, wobei man das natürlich damals beobachtete und sich fragte: „Was geschieht da mit den Juden? Da werden Geschäfte gestürmt und angesteckt! Und wo sind denn die Barks aus Dortmund-Hörde geblieben?“ Das war ein jüdisches Bekleidungskaufhaus gewesen. Ja, hieß es, die sind weg, die sind in ein Lager gekommen. Man wusste also durchaus, dass es Lager gab. Und dann kam ’45. Der Russlandfeldzug, wie man damals sagte, also der Überfall auf die Sowjetunion, war längst gescheitert. Und plötzlich wurde die Angst groß. Und mein Onkel sagte immer auf Platt: „Wie fett noch Hälse atte Krückstöcke kriegen!“ Also: Wir werden noch Hälse wie Spazierstöcke kriegen.
Was sollte das heißen?
Wir werden hungern und kaputt gehen, sodass unsere Hälse so dünn werden wie …
Haben Sie als Jugendlicher kritische Fragen nach dieser Zeit gestellt?
Das ergab sich nachher ganz von alleine. Ich muss dazu sagen: Wir hatten immer Personal, wir hatten ’n Kindermädchen und ’ne Putzfrau. Und nach ’45 hatten wir ’ne Putzfrau, das war ’ne Kommunistin. Die hat immer agitiert, immer agitiert! Als sie uns von den KZs erzählte, haben wir ihr zuerst nicht geglaubt. Dann kam aber jemand zu uns, den sie wohl kannte, der selbst in Buchenwald und in Dachau gewesen war. Und der erzählte grauselige Geschichten. Meine Mutter, ich seh sie noch vor mir, die hielt sich den Kopf und konnte es nicht fassen. Das war plötzlich real, das war kein Kino-Bericht über die Nürnberger Prozesse, Fernsehen gab ’s damals ja noch nicht, das berichtete jemand, der es erlebt hatte. Das war zu Beginn der 50er Jahre.
Wie hat sich Ihr Vater nach ’45 verhalten?
Es ging ja nach der alten Strategie weiter. Die alten Nazis waren in Amt und Würden. Mein Vater auch, wobei das relativ harmlos war: Der hat Lebensmittelkarten verkauft. Die anderen waren in der Verwaltung, in der Justiz, überall. Und das kriegte mein Vater mit. Dass zum Beispiel der frühere Propagandaredner, Opa Baumann genannt, auf einmal Leiter des Sozialamtes der Stadt Dortmund und eifriges SPD-Mitglied war.
War Ihr Vater dann auch in der SPD?
Nee, aber das hatten sie ihm angeboten. Dann hätte er noch heftigst Karriere gemacht, das hat er aber abgelehnt. Er ist also auf seiner Position geblieben. Und als dann das KPD-Verbot kam, sagte mein Vater: „Geht das jetzt schon wieder los?“ Es hat ja dann politische Sondergerichte gegeben, eigene Strafsenate, wo nur Kommunisten und alles, was links und linksradikal war, und was es da an Titulierungen gab, verurteilt wurden. Eigene Senate am Landgericht in Dortmund und in allen möglichen anderen Städten! Das ging ungefähr bis 1960. Und dann gab ’s die sogenannten unabhängigen Kandidaten, das waren natürlich auch alles ehemalige Kommunisten – die KPD war verboten. Es war also gefährlich, auf diese Weise zu kandidieren. Da konntense wegen Förderung einer verbotenen Organisation in den Knast gehen. Aber nicht auf Bewährung!
Waren Sie in dieser Zeit schon politisiert?
Ja, da war ich eindeutig schon politisiert. Ich war in der DFU, das war eine Abspaltung der SPD, die war acht Wochen vor dem Mauerbau gegründet worden. Wir waren kaum auf ‚m Markt, da waren wir schon fertig. (lacht) Herbert Wehner wusste, wie man das macht. Er nannte die DFU „Die Freunde Ulbrichts.“ Da hätten wir den Laden eigentlich zumachen können. (…) Ich war da Mitglied bis Ende ’60. Nach der Gründung der DKP war da nicht mehr viel los, da liefen alle wieder weg.“
Sie haben also nicht ’68 gebraucht, um ein Linker zu werden?
Nein! ’68 hab ich mit Schlips und Kragen auf ’n Schienen gesessen! (…) Ich musste ja für das Sozialpädagogische Seminar, das war so vorgeschrieben in der Ausbildungsordnung, einen abgeschlossenen Beruf haben und drei Jahre berufsmäßig geleistete Arbeit vorweisen können. Die Idee war: Wir wollten in die Sozialarbeit nur Leute bringen, die auch Ahnung haben von dem, was im Arbeitsprozess vorgeht. Deshalb musste ich ’ne Lehre beginnen. Die hab ich bei einem Elektrogroßhandel gemacht, wo es vom Kabel bis zum Tiefkühlschrank alles gab. Das dauerte zweieinhalb Jahre, denn man durfte bei entsprechender Schulbildung die Prüfung etwas früher machen. Da hab ich übrigens meine Frau kennen gelernt, die war da auch Lehrling. (…) Dann hab ich noch ’n halbes Jahr im Innendienst bei der Volksfürsorge gejobbt; ich musste ja diese drei Jahre voll kriegen. Als ich die zusammen hatte, bin ich zum Sozialpädagogischen Seminar gegangen. Und dann war ’68, und dann ging die Post ab! Plötzlich wurden all die Fragen gestellt, die ich schon längst gestellt hatte.
Schneeverwehungen im Thüringer Wald: Pläne und die DDR
Wie und wann wurden Sie Geschäftsführer beim Pläne-Verlag?
Warten Sie mal, das war entweder ’70 oder ’69. Ich könnte das höchstens in dem Zeugnis nachsehen, ich hab ja ein Zeugnis (lacht, steht auf und geht das Zeugnis suchen) …
Ich habe hier einen Artikel aus der Frankfurter Rundschau aus dem Jahr ’73, darin heißt es: „Der Dortmunder Pläne-Verlag besteht bereits seit zehn Jahren.“ Gab es den Verlag nicht schon vor ’63?
Das kann gut hinkommen. Ist das der Artikel, wo drinsteht: „Box wie Be, O, Ix und Hammer wie Sichel“? (…) Mich rief in den 70ern mal ein Redakteur der Frankfurter Rundschau an. Und die Rundschau hatte ja den Anspruch, ein bisschen links zu sein. Dieser Redakteur jedenfalls befragte mich per Telefon zur Geschichte des Pläne-Verlags. Dann hab ich dem bissl was erzählt. Und dann sagt er: „Hörn se mal, wie is das denn mit den Geldern aus der DDR?“ Diese Frage fand ich so was von lächerlich! Die war ja nicht neu, und ich konnte sie nicht mehr hören. Da hab ich gesagt: „Ach, wissen Sie, der Scheck vom Erich Honecker, der is wegen Schneeverwehungen im Thüringer Wald stecken geblieben!“ – Pause. Also, man konnte dem nur noch begegnen mit Häme und Ironie, das war einfach dämlich. Als wenn die einem ’nen Scheck schickten und sagten: „Hier, für Eure gute Arbeit!“ – solche Vorstellungen gab es damals. Der Redakteur fragte dann: „Darf ich mir noch mal Ihren Namen notieren?“ – „Ja!“, sag ich, „Boxhammer. Be, O, Ix und Hammer wie Sichel!“ – „Darf ich das wörtlich zitieren?“ – „Wenn Sie ’s wörtlich zitieren, ja.“ Und das schrieb er genau so rein. (…) Damit war für mich ausreichend dagegen gehalten.
Was war denn der Tenor des Artikels? Wurde der Pläne Verlag als fünfte Kolonne Moskaus dargestellt?
Ja, natürlich. Aber mit Sympathie, war ja ’ne linke Zeitung. Und wir feierten Jubiläum …
Gegen atomare Bewaffnung: Die Ostermarschbewegung
Zurück ins Jahr ’63. In diesem Jahr war der Pläne-Verlag noch klein und wenig bekannt, und Sie waren noch in der Ausbildung. Wie kommt nun der Sozialarbeiter zum Schallplatten-Label?
Das will ich Ihnen sagen. Irgendwann sind die auf mich zugekommen. Ich bin ja einer der Gründer des Ostermarsches Ruhrgebiet–West, das ist ein Riesengebiet.
Wann ging das los?
Beim ersten Ostermarsch ’59 in Lünen war ich noch nicht dabei. Es ging damals gegen die Atomraketen. Das war ja das Thema, Strauß war ein Befürworter der atomaren Bewaffnung der Bundeswehr. Die Ostermarsch-Tradition allerdings kam aus England. (…)
Gab ’s nicht auch in der Bundesrepublik, gerade hier in dieser Region, bereits Vorläufer, etwa die Proteste gegen die Wiederbewaffnung zu Beginn der 50er Jahre?
An diese Veranstaltungen kann ich mich sogar noch erinnern. Aber das war was anderes. Das war eher die Ohne mich-Bewegung.
Es waren zum Teil sehr große Demonstrationen mit großem Polizeieinsatz. In Essen ist 1952 bei einer Kundgebung auch ein Demonstrant zu Tode gekommen.
Ja, der Müller.
Genau, Philipp Müller. Im Osten wurde er zum Märtyrer, und Ernst Busch hat auch ein Lied auf ihn gesungen.
Ja. Das war ein FDJ-Mann, ein ganz junger Mann. Wurde von der Polizei erschossen. Wie Ohnesorg ist der umgekommen.
Hat aber im Westen nicht diese breite Öffentlichkeit bekommen …
Er war doch Kommunist!
Ja, aber er war ein Unschuldiger, der umgebracht wurde …
Aber er war doch Kommunist! Verstehen Sie? Benno Ohnesorg kam im Gegensatz zu Philipp Müller aus der Mitte der Gesellschaft. Außerdem war das 15 Jahre später unter anderen politischen Vorzeichen. Den Müller kannten nur die Leute aus der FDJ. Und die FDJ war ’51 im Westen verboten worden, das geschah nach dem Sturm auf den Petersberg bei Bonn, wo der Sitz der Alliierten Hohen Kommission war. So was ging natürlich nicht, das war ja Revolution, also hat man die FDJ verboten. Ein paar Jahre später, 1956, dann auch die KPD.
Die Ostermarschbewegung war also Ihrer Ansicht nach keine Neubelebung dieser linken Bewegung?
Nein, nicht direkt. Die Ostermarschbewegung war keine linke Bewegung. Sie stand wohl in Opposition zur Adenauer-Politik, aber sie links zu nennen, greift zu kurz. Das war ’ne sehr breit angelegte Bewegung. Wir hatten zum Beispiel unendlich viele Pfarrer – wenn Sie die alle als links bezeichnen wollen, mein Gott, dann haben wir nur noch Linke hier rumlaufen. Das gilt auch für diese Brüder-Bewegung aus der Bekennenden Kirche … „Kampf dem Atomtod!“ hieß übrigens die alte Bewegung, die noch von der SPD gesteuert wurde. Die war ’57, ’58 zu Ende mit einer letzten großen Demonstration auf dem Alten Markt in Dortmund. Und dann kam ’59, so weit ich weiß, der erste kleine Ostermarsch.
Wissen Sie, auf wessen Initiative der Ostermarsch entstand?
Wenn ich das richtig erinnere, kam nicht einmal die Idee aus der kommunistischen Ecke. Dass die sich nachher mit drauf gesetzt haben, ist klar. Aber ich glaube, dass das viel breiter angelegt war. Und da wurde auch immer für gesorgt, dass das breit blieb. Es war ’ne linksliberale Bürgerbewegung. Es waren ja auch FDP-Leute dabei, die kann man ja nun nicht als links bezeichnen. (…)
War diese Region hier, das Ruhrgebiet, prädestiniert für eine solche Bewegung?
Na gut, es war immer eine sozialdemokratisch geprägte und in den 20er Jahren auch stark kommunistisch geprägte Region. In Dortmund hatten die Kommunisten sogar mehr Stimmen als die Sozialdemokraten. Aber das war nach ’45 ja nicht mehr so. Da wurde der Anti-Kommunismus, den die Nazis zur Begründung ihres ganzen Verbrechertums benutzt hatten, ohne Unterbrechung fortgesetzt. Dann kam diese Berlin-Blockade, und dann war der Kalte Krieg im Gange. Die Kommunisten waren noch einmal kurz im Bundestag, und dann waren sie weg. Die Hetze hörte deswegen nicht auf! Das war unglaublich! Sie können sich die Atmosphäre nicht vorstellen! Ich sehe das noch genau vor mir. Das war eine Atmosphäre von Hass, von Intoleranz.
Intoleranz gegenüber Kommunisten?
Gegenüber allem, was „Anti-“ war. Sie brauchten nur zu sagen: „Das ist doch nicht in Ordnung!“ Schon kam: „Sie sind wohl Kommunist? Dann gehen Sie doch in die Zone!“ (…)
Haben Sie, als Sie 1960 mit den Ostermärschen anfingen, dann bewusst vermieden, Parteizugehörigkeiten zu formulieren?
Offiziell gab ’s diese Zugehörigkeiten ja nicht mehr. Klar hieß es dann: „Ja, der Sowieso is doch ’n alter Kommunist!“
Wer waren denn die tragenden Organisationen?
Zunächst gar keine, das waren Einzelpersonen. Wir waren der Ostermarsch-Regionalausschuss West oder so. Aber das war kein Verein, das wäre schon problematisch gewesen. Das war ’ne Bewegung, da trafen sich Leute, und da wurde gesagt: „Du machst das und du machst das“ Und so ging das los. Ich bin einer der Gründer mit Frank Werkmeister zusammen. Das war einer der Gesellschafter beim Pläne-Verlag.
Frei sein und nackend: Die Bündische Bewegung
Sie sagten mir am Telefon, dass der Pläne-Verlag nicht so sehr aus einem linken Spektrum gekommen sei, sondern aus dem Bündischen. Erklären Sie doch mal, wie Sie zum Pläne-Verlag gekommen sind.
Wie das im Einzelnen gewesen ist, kann ich nicht mehr sagen. Ich glaube, Frank Werkmeister hat mich Mitte der 60er Jahre angesprochen und zu mir gesagt, man müsste mal was mit dem Verlag machen. Neben Frank Werkmeister war noch Arno Klönne einer der Gesellschafter, in späteren Jahren auch noch Dieter Süverkrüp. Jedenfalls ging es darum, dass der Verlag nur im eigenen Saft kochte, so kleine Heftchen rausbrachte und sein Spektrum erweitern wollte. Der Verlag war hauptsächlich mit diesen bündischen Stämmen befasst. Die Stämme hatten alle Namen, also zum Beispiel dj1.11. Das war der Stamm, aus dem auch der Berliner Harro Schulze-Boysen kam, der Widerstandskämpfer, der ’42 in Plötzensee gehängt worden ist – angeblich zur „Roten Kapelle“ gehörig, was ja ein Begriff war, den die Nazis erfunden hatten.
Wie muss man sich diese bündischen Stämme vorstellen? So etwa wie Pfadfinder?
Ja, so was ähnliches. Das kam aus dem Bürgerlichen und war ursprünglich eine Reichsbewegung, also eine Bewegung des Deutschen Reiches. Und die brachte Leute zusammen, die diesen Mief nicht mehr ertrugen. Dieser Mief war immer Thema! Das war auch nach dem Kaiserreich so, als man das Bedürfnis hatte, sich nicht mehr in allem konform zu verhalten. Die wollten frei sein und nackend, und die lasen sich Gedichte vor und machten Gedichte. In dieser Tradition stand Pläne. Die druckten Gedichte, machten Blättchen – alles in diesem Beritt. Und dann Mitte, Ende der 60er Jahre ging das los mit Schallplatten.
Kästner, Tucholsky, Süverkrüp: Die ersten drei Schallplatten
Wie sah das Programm aus?
Kästner war im Programm; Tucholsky war im Programm, immer interpretiert von Hanns Ernst Jäger. Und Dieter Süverkrüp mit „Ça ira – Lieder der Französischen Revolution“. Das waren die drei Platten, die sie damals rausgebracht haben. Die befanden sich nach ihrem Selbstverständnis irgendwie noch in der Tradition der Bündischen Bewegung.
Waren Frank Werkmeister und Arno Klönne in einer Partei?
Nein. Ob Frank Werkmeister später in einer Partei war, kann ich Ihnen nicht sagen. Das waren junge Leute in meinem Alter, ganz bürgerliche Herkunft. (…) Klönne ist bald nach ’68 weg gewesen und ist ja dann einer unserer bedeutendsten Soziologen geworden.
Wie kamen diese jungen Männer drauf, ausgerechnet diese Musik, diese Texte rauszubringen?
So wie zu allen Zeiten Leute drauf kamen, sich im Mief nicht mehr wohl zu fühlen. Dieses Bedürfnis: Wir wollen frei sein, eins mit der Natur, kurze Hosen tragen und nackend baden. Das waren ja zum Teil abstruse Geschichten, wie sich das äußerte. Man lehnte sich auf gegen Mief, gegen Verengung und gegen Hartherzigkeit. Und man lebte kulturvoll, also druckte man Gedichte und las Gedichte. So …, das hatte auch ein bisschen was Abgedrehtes …
Schön, aber man hätte ja auch Hermann Hesse verlegen können …
Nee, nee, nee.
… oder Thomas Mann …
Nein, nein, nein! Was glauben Sie, wie das Verlagsgeschäft geht! Das ist vorbei, da gehen Sie am Stock! Sie können nicht mit Lizenz arbeiten, das kann ’n kleiner Verlag nicht bezahlen! Die hatten doch alle bei Suhrkamp, oder weiß der Teufel wo, ihre Rechte.
Kästner und Tucholsky nicht?
Doch, die auch. Aber Tucholsky, Kästner, Brecht und Busch hatten alle Sonderstatus. Die hatten zwar einige Rechte abgegeben, sich abkaufen lassen, aber für einen Teil hatten sie und ihre Erben die Rechte behalten. Das war freie Masse.
War das dann kostenlos oder billig?
Nix kostenlos! Aaah, was meinen Sie, was das für Geschäftsleute sind! Also nicht von wegen: Wir kommen doch alle aus einer Ecke oder was … Sondern: Geld auf ’n Tisch, oder es passiert gar nichts! So war das.
Aber es war günstiger für den Verlag, als wenn man sich zum Beispiel um Hesse bemüht hätte …
Da gab ’s keine Erben, so weit ich weiß. Da waren die Rechte bei Suhrkamp, und da brauchten Sie gar nicht erst hinzuschreiben. Verstehen Sie, die wollen so viel Lizenzgebühren haben, das lohnt nicht. Sie müssen das immer ins Verhältnis setzen zu dem, was Sie verkaufen können. Und ich kann das ja nur verkaufen in meinem Beritt, wo ich sozusagen bekannt bin. Und wer kannte denn damals den Pläne-Verlag?
Diese drei Platten, von denen Sie jetzt sprechen, waren also der Beginn …
Genau, das war der Aufbruch. Da ging man schon zaghaft über diese alte Geschichte hinaus, da wurde man breiter. Und als die draußen waren, hieß es: „Hörma, wir müssen da jetzt was tun – die Platten laufen zwar, aber wir wollen das ausbauen und brauchen jetzt ’n guten Mann.“ Die kannten mich ja, Frank Werkmeister war einer meiner Kollegen im Ruhrgebiet-West in der Ostermarschbewegung. Ich hab mir das dann überlegt, ob ich da einsteige. War ja nicht gerade mein Beruf. Ich war zwar Kaufmann, hatte aber ein Diplom als Sozialarbeiter und auch bei der Berufsberatung und bei der Arbeiterwohlfahrt gearbeitet. Als die mich ansprachen, war ich gerade bei der Berufsberatung tätig. (…) Die wollten mich als Geschäftsführer. Ich hab mir überlegt, was ich da verdienen kann; ich hatte ’n kleines Kind, und meine Frau war nicht berufstätig. Die fragten: „Was verdienste denn jetzt?“ – Ich sag: „Ich verdiene jetzt BAT 4b, und das möchte ich auch mindestens haben.“ Und das hab ich auch bekommen.
Baggerführer Willibald: Progressive Kinderlieder bei Pläne
Was hat Sie abgesehen vom Geld gereizt?
Die Arbeit. Das war schon interessant. Und auf einmal ging die Post ab. Ich sagte: „Wat hab ich für Geld? Ich brauch Geld, weil ohne Geld läuft hier nix!“ Ich hatte gleich ’ne Menge Ideen, um den Laden in Schwung zu kriegen. (…) Den Job hab ich dann bis ’76 gemacht. Dann war ich weg.
(Ende der ersten Seite der ersten Kassette)
Wie ist die Idee entstanden, den Ernst Busch einzukaufen?
Erst mal haben wir uns gefragt: Wie kriegt man Breite? Wie kommt man auch an Kinder ran? Das war ja mein Gebiet, da komm ich ja her. Das heißt, wir wollten progressive Kinderlieder unter die Leute bringen. Sachen, die auch vermitteln, wie es in der Welt zugeht – also nicht diese grauseligen und brutalen Geschichten, die ja durch Märchen und sonst wie abgedeckt sind. Und wer könnte so was machen? Da kam Dieter Süverkrüp mit dem „Baggerführer Willibald“. (…) Achja, vorher gab ’s noch den Hüsch mit der „Carmina Burana“, auch ’ne kleine Platte. Süverkrüp und Hüsch kamen auch aus der Ostermarschbewegung, da traf sich alles.
Wie wurden die Entscheidungen getroffen, diese oder jene Platte zu machen?
Wir haben gefragt: „Wie kommen wir an Kinderlieder?“ – Da sagt Süverkrüp: „Dat find ich interessant!“ Das war ein Ergebnis von Diskussionen, es gab einen sogenannten Produktionsrat, da wurde das besprochen. Ich hab gefragt und angeregt und versucht, was auf den Weg zu bringen.
Sie waren ja durchaus ein Geschäftsführer im herkömmlichen Sinn. Gab es auch eine klare Hierarchie bei den Entscheidungen?
Oh ja! Im Produktionsbereich wurde demokratisch entschieden – was dann gemacht wurde und in welcher Reihenfolge, habe ich entschieden. Denn es ging um Geld, und da wurden keine Experimente gemacht.
Wieviele Platten haben Sie in den sechs Jahren gemacht?
Puh …, ich red jetzt mal über Langspielplatten, nicht über Singles: vielleicht 20 Langspielplatten. Aber wir hatten ja auch Singles, zum Beispiel den „Baggerführer Willibald“.
War der „Baggerführer Willibald“ ein Renner?
Einer der größten Hits, den Pläne je gemacht hat. Wir haben die Single, ich schätz mal, 100.000 mal verkauft.
Aus meiner Generation kennen das Lied sehr viele. Wer in den 70ern in linken oder linksliberalen Elternhäusern aufgewachsen ist, der hat das mitgekriegt …
Ja. Das konnten die Kinder schon im Kinderwagen vor sich her lallen. Das konnten die schon, bevor sie laufen konnten (mit Kleinkind-Stimme): „Is am Morgen kalt / Kommt der Willibald“ – Damit hat sich später der Pläne-Verlag saniert. Die haben das Lied nachher verkauft, um ihre Schulden abzudecken, und das hat die gerettet. (…)
Haben Sie das damals als eine Fortsetzung Ihrer Sozialarbeit empfunden – nur mit anderen Mitteln?
Ja, unbedingt. Und gleichzeitig entwickelte sich die Ostermarschbewegung immer weiter. Dann kam die Friedensbewegung mit dieser Riesenveranstaltung ’83 in Bonn. Und Pläne hat diese Bewegung sehr begleitet. (…) Wir hatten dann auch diese Weihnachtsliederplatte von Süverkrüp, auch ’ne Single: „Leise schnieselt der Re-aktionär seinen Tee“ – Wunderbare Platte, aber war nicht ganz so erfolgreich, weil es da auch gegen christliche Werte ging. Da wurde schon mal gezuckt, wenn dann so was kam. (…) Aus diesem Kinderlieder-Schwerpunkt ergab sich auch das Projekt einer Kinderoper, die wir mit Hans Werner Henze machen wollten. Wir hatten schon mit dem gesprochen, ist aber leider nie realisiert worden. (…)
Erziehung zu Klassenbewusstsein: Ziele der Verlagsarbeit
Ihnen lagen also besonders die Kinderlieder am Herzen. Wie kommt man nun auf Ernst Busch, der ja nicht gerade …
Mich interessierte alles, was Erziehung war. Sozialarbeiter sind nun mal Erzieher. Ich wollte nicht mehr und nicht weniger als erziehen. Gut, aber zu was? Ich wollte die Leute erziehen zu Selbstbewusstsein, zu Klassenbewusstsein, zu Sozialbewusstsein, zu Menschlichkeit, zu Humanismus. Gerade bei dieser Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, wo einem systematisch alles Kritische ausgetrieben wurde, wo zwar ständig auf VW geguckt wurde, aber nicht auf das, worum es wirklich ging. Und nach hinten sah man schon gar nicht, also Hitler und die ganze faschistische Barbarei interessierten nicht. Damit wollte man nichts zu tun haben, davon wollte man nichts gewusst haben. Nein! Es geht ums Vergegenwärtigen! Bertolt Brecht: „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.“ Und er ist heute noch fruchtbar, dat sehen se doch an der braunen Brühe, die gerade in Dresden aufmarschiert ist. So, das war ’n Erziehungsauftrag: diesen Schoß unfruchtbar machen, dass da nichts mehr rauskommt. Das war mein ganz bewusstes Anliegen.
Wie passt jetzt der Busch da rein?
Ganz einfach: Wenn man politisches Bewusstsein schaffen will, dann muss man auch Traditionen auffrischen, die verschüttet sind oder mit Verboten und ideologischen Vorbehalten zugekleistert sind. Alles was links war, vom Kommunismus ganz zu schweigen, war ja schlecht. (…) Was wir machten, war ein bewusstes Angehen gegen das politische Denken der damaligen Zeit.
Kannten Sie Busch?
Ja, ich hab Ihnen ja erzählt …
Ich meine: Kannten Sie die Musik?
Ja, natürlich.
Woher? Im Westen gab es doch kaum Platten.
Ja, aber man kannte doch die Lieder des Spanischen Bürgerkrieges. Die wurden sogar auf der Klampfe gespielt. In der Ostermarschbewegung setzte man sich hin und sang diese Lieder. Da wurde das „Einheitsfrontlied“ gespielt und das „Solidaritätslied“. Verstehen Sie, das konnten Sie hier nirgendwo kaufen, und trotzdem war es bekannt. Denn irgendeiner kannte das immer und spielte das. So lernte man das kennen, bisschen komische Musik, diese Eislerschen Melodien, aber das prägte sich ein: „Und links, zwei, drei.“ Auf einmal hatte diese Lieder auch Süverkrüp auf der Gitarre drauf. Der hatte die irgendwo gehört oder was weiß ich …
War Süverkrüp damals schon parteipolitisch engagiert?
Nein, das war später. In den 60er Jahren nicht.
In die Ostermarschbewegung hinein kamen Busch-Lieder vielleicht auch durch ehemalige Spanienkämpfer, durch VVN-Leute …
Ja, das ist gut möglich. Die VVN waren einer der Mitträger der Ostermarschbewegung, nicht die Initiatoren wohlgemerkt. Ich hab das ja vorhin gesagt, dass die Kommunisten später da miteingestiegen sind – die hatten ja den Anspruch, die Vorreiter der Arbeiterklasse zu sein. Die ham dann gesagt: „Klar, gegen Atomtod sind wir auch!“ Die Initiatoren waren bürgerliche Leute, und hier spielte das Bündische eine große Rolle. Denn die oppositionelle Haltung ist eine bündische Haltung. Die ist sehr diffus in vielen Dingen, aber sie ist eine oppositionelle. Ich sach mal: gegen Mief. Und jetzt sagen se mir, wat Mief is! (lacht)
Waren Sie damals auch in der Bündischen Bewegung engagiert?
Nein, nie.
Vertrag unter Sozialisten: Der Busch-Deal
Wie ist nun der Kontakt zu Busch 1970 zu Stande gekommen?
Das muss Anfang des Jahres gewesen sein. Das war eine der schnellsten Platten, die wir gemacht haben. Ich muss dazu sagen: Die haben wir nicht selber produziert. Wir sind zum VEB Deutsche Schallplatten hin und haben das Mutterband von denen bekommen. Deshalb konnte man die Platte relativ schnell pressen. Das Mutterband müsste heute noch bei Pläne liegen. Jetzt muss ich Ihnen sagen, das geht jetzt zeitlich immer ein bisschen vor und zurück, eine Langspielplatte herzustellen kostete damals normalerweise grob zwischen 10.000 und 20.000 Mark. Da ist die Vervielfältigung nicht mit drin, ich spreche von den reinen Produktionskosten: also vom Etikett übers Cover, über die Studiokosten bis hin zu den Berufsmusikern, die ja eigentlich Musikbeamten sind. Die können Sie einkaufen und dann legen Sie denen ’n Blatt Papier hin, und dann spielen die das fehlerfrei runter. Das war wichtig für uns, denn je kürzer die Zeit im Studio war, je weniger kostete das.
Das fiel ja in diesem Fall alles weg, weil alles schon eingespielt war.
Genau. Es ging also nur darum, was die für das Mutterband wollten. Und was haben wir bezahlt? Zweieinhalbtausend Mark pro Band, vielleicht waren ’s auch drei. Für uns war das günstig, für die DDR waren das Devisen.
Wie sind Sie an das Mutterband gekommen?
Ich glaube, wir haben damals überlegt: Busch ist in der DDR. So, wo produziert der? Beim VEB Deutsche Schallplatten. Da gab ’s ja diese kleinen Platten bei Aurora. Also, es war ganz einfach. Hinschreiben oder Hinfahren. Das Band zu kaufen, war unkompliziert. Dann hieß es aber: „Honorare müssen Sie mit Busch ausmachen.“ – Und dann ging die Post ab. Der Busch hatte natürlich ein Konto im Westen für Devisen. Das war der Trick. So machte der Brecht das doch auch. Der ließ sich 50 Prozent von Suhrkamp hier auszahlen …
In der Abrechnung von damals, die im Busch-Archiv liegt, steht, der Betrag würde an Busch gehen, allerdings „anteilig an die Akademie der Künste“ … War das eine ähnliche Regelung?
Das weiß ich nicht. Da müsste ich in ’n Vertrag gucken, den hab ich nicht mehr im Kopf. Normalerweise gab ’s pro verkaufte LP ungefähr ’ne Mark für den Künstler, pro Single 50 Pfennig. Und von den Busch-Platten haben wir schätzungsweise 10.000 Stück allein im ersten Jahr verkauft. Jedenfalls war der Busch an jeder einzelnen Platte beteiligt, und das Geld ließ er sich nicht in DDR-Mark bezahlen. Wobei es sein kann, dass der Akademie-Anteil auch an ihn ging. Nur zur Erinnerung: Damals verdiente ein Arbeiter 800 Mark netto im Monat.
Das war doch ein kleiner Coup auch für Sie, oder?
Das war ’n Vertrag unter Sozialisten. Ich fand das in Ordnung. (lacht)
Haben Sie den Vertrag noch?
Verstehen Sie, da ist kein Archiv geführt worden. Man ist immer froh, wenn man ’ne GmbH gründet, wo das gar nicht mehr geprüft wird vom Finanzamt. Nach zehn Jahren Aufbewahrungsfrist kommt das Zeug wacker in ’n Schredder. Ich glaub nicht, dass da noch was vorhanden ist.
Hatten Sie damals Mitsprache bei der Auswahl der Busch-Lieder?
Nein, wir haben genommen, was wir gekriegt haben. Das war fertig produziert. Klar wollten wir Spanienlieder dabei haben, wir wollten Lieder, die Widerstand gegen den Faschismus drin hatten. Das passte auch zu unserer Geschichte, Sie erinnern sich: dj1.11, und das konnten wir auch verkaufen. Dass da ’n Bürgerkrieg stattgefunden hatte, das wussten sogar die politisch dümmsten Menschen. Außerdem klapperten wir damit all diejenigen ab, die sozusagen aus dieser Ecke kamen, die beispielsweise Teilnehmer des Spanienkriegs waren, beziehungsweise deren Kinder, und diejenigen, die diese Lieder aus der Ostermarschbewegung kannten und sie vielleicht beim Wandern summten. (…)
Im Jahr 1968 besprach die Süddeutsche Zeitung eine Busch-Platte der Deutschen Grammophon, auf der Brecht-Sachen aus dem Theater drauf waren. Da ging es vor allem um die Lieder, weniger um den Interpreten. Nun kommen Sie zwei Jahre später mit den Kampfliedern. Ging es Ihnen dabei auch um den Busch selbst?
Das können Sie nicht trennen. Ernst Busch ist der Barrikaden-Tauber. Wo hat er denn auf den Barrikaden gestanden? Doch nicht in Berlin. (…) Die Barrikaden, mit denen er Massenwirksamkeit erreichte, waren die im Spanischen Bürgerkrieg. Und die Lieder, die Busch in diesem Krieg schuf, waren in einer bestimmten Klientel verbreitet. Die wollten wir bedienen.
Linke Lagerfeuerromantik: Werbemaßnahmen und Pressearbeit
War es eine Marktlücke?
Ja, sicher. Gab ’s ja nicht bei uns. Wir haben geschätzt: Wenn wir da 2000 Stück von verkaufen, haben wir nicht nur unsere Produktionskosten drin, die ohnehin recht gering waren, sondern sind bereits in den schwarzen Zahlen. Und schwarze Zahlen bedeutete Geld für neue Platten.
Heute macht man ja so Zielgruppenanalysen …
Aaach, um Gottes Willen! Wir haben das so gemacht (hält den Daumen schief vors Gesicht), also das war nix Professionelles. Aber natürlich haben wir uns gefragt: „Hat das ’ne Chance? Was können wir einnehmen?“ Und dann haben wir gesagt: Das funktioniert. Wir bedienen die Klientel, die den Spanischen Bürgerkrieg noch erlebt hat, deren Familien und die Leute, die diese Lieder in der Aktion, also in der Ostermarschbewegung, auch singen, auf der Klampfe spielen.
Haben Sie so eine Art Nostalgie-Faktor einkalkuliert?
Absolut. Denn die 68er Bewegung war gelaufen. Und da war ja ganz viel hochgekommen, da war ganz viel Revolutionäres da. Aber auch viel Chaotisches. (…)
In einem Zeitungsartikel ist die Rede von „linker Lagerfeuerromantik“ und „südländischer Folklore“. War Ihnen dieser Aspekt der Spanienlieder auch bewusst?
Ja, ja, absolut. Das war eindeutig so.
Fanden Sie das nicht despektierlich?
Doch. (lacht) Das fanden wir zur damaligen Zeit sehr despektierlich.
Haben Sie sich geärgert über solche Presse-Kritiken?
Wir haben uns geärgert. Aber ich hab immer gesagt: „Freunde, is doch egal, wat die schreiben! Hauptsache, die schreiben – die schweigen uns nicht mehr tot, wie se das 20 Jahre gemacht haben!“ Jede Provokation, die rein kam, war wichtig. Deshalb hab ich dem Redakteur doch auch diesen Spruch um die Ohren gehauen: „Be, O, Ix und Hammer wie Sichel.“ (…) Übrigens ist auch der Slogan von mir, den Pläne Jahre lang hatte: „Rot sehen kann jeder, hören Sie mal rot!“
Der ist von Ihnen?
Ja, ich hab den angeregt. Also, wir hatten ’nen Grafiker, der den in Reinform gebracht hat. Aber die Provokation stammt von mir.
Guter Spruch, erinnert mich ein bisschen an „Dreh nicht durch, dreh Dragon!“ …
Das war klasse. Auf der Buchmesse liefen sie alle mit unseren Einkaufstüten rum. Da war ein großer roter Punkt drauf, daneben stand „Pläne“ und der Spruch: Rot sehen kann jeder, hören Sie mal rot! – Es war der Knüller! Ich will Ihnen noch was erzählen: Als Werbegag machten wir eine Schallplatte nach der Kiesinger-Ohrfeige von der Beate Klarsfeld, übrigens ein ganz schwieriges Frauenzimmerchen … Jedenfalls stand auf dem Cover, das aussah wie eine Einkaufstüte aus Packpapier, in brauner Frakturschrift: „Kurt Georg Kiesinger: Rechtfertigungen eines Schöngeistes der Barbarei“ – So, und wissen Sie, was drauf war? (Pause) Das war eine Leerpressung. Eine Single, auf der nichts drauf war. (Lachen)
Haben Sie die verkauft?
Verschenkt. (…) Das dauerte bei manchen eine Weile, bis sich das gesetzt hatte. Wir haben die Platte auf der Buchmesse verschenkt, und da kamen Leute zurück zum Stand und sagten (mit schüchterner Stimme): „Da muss ’n Fehler passiert sein, da is gar nix drauf.“ (Lachen) Und da hab ich gesagt: „Könnte das auch Sinn machen?“ Und dann fing das an zu rattern, das konnten sie sehen, wie das ratterte. Ich sach: „Gucken Sie sich doch noch mal den Umschlag an!“ – Es gab keine Rechtfertigung bei Kiesinger, das war doch klar. Das war ein ganz übler brauner Vogel.
Das klingt alles so, als hätten Sie mit dem Verlag auch viel Spaß gehabt …
Ja, haben wir auch gehabt. ‚Ne Menge Spaß und ’ne Menge Reaktionen.
Das wollte ich auch fragen: Gab ’s Post?
Ich hab den Umsatz vertausendfacht …
… in diesen sechs Jahren …
… vertausendfacht!
Das ist ’ne Menge, aber es war wahrscheinlich auch nicht viel da gewesen an Umsatz, als Sie einstiegen …
Das ist wahr. Es ging aber am Schluss, als ich ging, in die Millionenumsätze.
Warum sind Sie dann gegangen?
Sag ich Ihnen gleich.
Busch und Baggerführer: Die Explosion der Verkaufszahlen
Gut. Noch mal zurück zu Busch: Im November 1970 schrieben Sie an Busch, seine Platte sei ein „Knüller“, und fügten hinzu: „Mit dem Verkauf sind wir sehr zufrieden.“ Das ging ja sehr schnell, wenn Sie im Frühjahr erst die Bänder bekommen hatten, wie Sie sagen …
Ja, der ging ja ab wie Wim (?). Wir konnten ja gar nicht so schnell liefern, wie die Leute gekauft haben. Wir hatten bestimmt schon die dritte Auflage im November. Die ersten Auflagen betrugen 1000 Stück, dann ging das hoch auf 2000 Stück. Bis Ende ’72 hatten wir acht Auflagen und 10.000 Stück verkauft. Sie müssen bedenken, dass das totes Kapital war, wenn sich eine Platte nicht schnell verkaufte. Eine Platte in der Nachauflage kostete uns etwa 5 Mark, davon waren 2,50 Mark Rohpreis und 2,50 Mark Gema. Verkauft haben wir sie für 20 oder 22 Mark. Kosten für Werbung und so kamen natürlich noch dazu. Aber immerhin: Wenn wir 2000 Stück pressen ließen, waren, bei 5 Mark Kosten pro Platte, gleich 10.000 Mark weg. Wenn sie die schnell umschlugen, war das okay. (…) Und bei Busch ging das sehr schnell. Wir hatten vorher vier Jahre lang an einer 1000er Auflage verkauft, also vielleicht 250 Stück pro Jahr von einer Langspielplatte verkauft. Und auf einmal verkaufen wir 10.000 Stück von einer LP in einem Jahr! Da ist der Pläne-Verlag geschossen wie ’ne Rakete! Und parallel kommt der „Baggerführer Willibald“ raus.
Busch war ein Verkaufsschlager?
Busch war der Verkaufsschlager! Da hat sich Pläne dran saniert. Und das zweite Standbein war Süverkrüp mit dem „Baggerführer Willibald“.
Waren Sie überrascht damals über den Erfolg?
Über beide. Und dann hörte es nicht mehr auf. Dann kam die Singebewegung in der DDR. Da haben wir ’ne Platte drüber gemacht. Und zwar mit ’ner DDR-Fahne drauf, das war eine Provokation sondergleichen (lacht). Hammer und Zirkel im Ährenkranz! Das war das Schlimmste, was Sie machen konnten. Und dann kamen diese Arbeiterlieder, die wir im Essener Saalbau aufgenommen haben. Von da an lief es. (…)
Brauner Wedding: Die persönliche Begegnung mit Busch
Was ist Ihnen von Ihrem persönlichen Zusammentreffen mit Busch in Erinnerung?
Ich kann mich nur noch an Ausschnitte erinnern, das liegt zu weit zurück. Ich merkte jedenfalls damals: Der hatte ein sehr gediegenes Verhältnis zur Regierung der DDR, ein sehr gediegenes Verhältnis. Der hasste den Ulbricht, wie man nur einen Menschen hassen kann. Der verachtete den! (…) Irgendwie kam Busch dann im Gespräch auf das Lied „Roter Wedding“. Und was hat der über dieses Lied geschimpft (polternd): „Alles Quatsch! Von wegen roter Wedding, das war brauner Wedding! Suchen sie sich doch mal die alten Wahlergebnisse vom Wedding raus!“ – Also, es war eindeutig, was er meinte, nach dem Motto: „Hab ich zwar immer gesungen, aber dass das von den historischen Mehrheitsverhältnissen her nicht so ganz stimmt, ist mir schon klar.“ (…) Er hat den Liedtext wohl irgendwie wörtlich interpretiert und hat den als Synonym für Überhöhungen gewertet, für Mythen schaffen und so etwas. (…) Er wusste, dass es viele Dinge gab, wo man zweimal hingucken musste, bevor man sie annahm. (…) Und er war mit vielen Dingen in der DDR nicht einverstanden.
Wissen Sie noch, in welchem Zusammenhang Sie ihn damals getroffen haben? War das am Rande der Festspiele?
Ja, ich vermute mal. Aber ich weiß das nicht mehr genau. Das war in einem Kreis von vielleicht zehn Leuten (…)
Busch kam ja im Gegensatz zu den Künstlern, mit denen Sie sonst zu tun hatten, nicht aus der westlichen Protestbewegung. Und er war mit dem Staat, in dem er lebte, auf sehr besondere Weise verbunden, er war eine Ikone. War das spürbar bei dieser Begegnung?
Dieses Besondere ist mir nicht in Erinnerung. Der hatte genau die gleichen bürgerlichen Macken drauf wie Therese Giese, wie Hüsch, wie Degenhardt … So ’n bisschen: „Was gibt’s heut zu essen? Was ham sie für ’n Wein?“ – Heute bin ich schon eher auf diesem Trip, aber das kann auch was mit dem Alter zu tun haben (lacht). Nein, aber auffällig war auch dieses Überhaupt-nicht-bedingungslos-eingehen-auf-irgendetwas, sondern sich immer was vorzubehalten: „Ja – aber …“, zum Beispiel: „Ja, Sie machen tolle Platten, aber meine sind die besten.“
Was bei Ihnen hängen geblieben ist, ist offenbar diese Geschichte mit dem „Roten Wedding“ …
Ja. Ich habe damals gedacht: „Warum sagst du so was? Wieso musst du so was sagen?“ Es ging in die Richtung: Hörma, ich bin doch gar nicht aus der DDR! Warum muss das jetzt sein? Oder: Erkennst du nicht: Wenn du das dem Falschen sagst, dass man das auch ausschlachten kann? Wir waren doch in einer besonderen Situation in Westdeutschland. Uns ging ’s doch darum, einen Gegenpol aufzubauen. Und dann kommt so einer und sagt (polternd): „Roter Wedding…“ – Es mag ja gestimmt haben, was er sagte. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ich hatte nicht nachgeguckt, es interessierte mich auch nicht. Ich wollte das nicht hören, für mich war klar: Wenn der das jetzt einem bürgerlichen Journalisten erzählt, schreibt die Frankfurter Rundschau oder die FAZ oder der Spiegel oder der Stern oder wer auch immer: „Busch bezweifelt seine eigenen Ideale“ oder so. Und dass der sich instrumentalisieren lässt. Er hat die Äußerung ja nicht öffentlich gemacht. Aber ich fand sie damals unangemessen.
Haben Sie Busch auch privat gehört?
Wir haben den damals auch privat gehört.
Haben Sie ’n Lieblingslied?
Was hat mir von ihm gefallen? Das „Beimler-Lied“ hat mich schon sehr beeindruckt. Überhaupt die Lieder des Spanischen Bürgerkrieges, ich muss sagen, da gab ’s größere Anteile … Und sonst? Da fragen Sie mich was …Verstehen Sie, ich hab nicht mal mehr ’n Schallplattenapparat, wo ich die Dinger abspielen kann. Ich hab sie aber unten noch liegen, die Platten. Achso, das „Seifenlied“ fand ich natürlich wunderbar, weil da der rechten Sozialdemokratie ordentlich eingeschenkt wurde. Das Lied hat übrigens kaum an Aktualität eingebüßt! (…)
Schnürschuhsozialisten und Chaoten: Die Vertriebswege
Was glauben Sie, welche Leute haben diese Busch-Platten gekauft?
Das ist schwer zu sagen. Wir haben ja nicht in erster Linie an Einzelpersonen verkauft. Verstehen Sie, wenn ich daran interessiert bin, einen ordentlich geführten Verlag zu haben, dann kann ich nicht Killefitt über Einzelversand machen. Wir haben 90 Prozent unseres Umsatzes über Wiederverkäufer gemacht und 10 Prozent über Direktbestellungen. Wir haben an Schallplattengeschäfte verkauft, an große Versandhäuser, an Buchketten wie Montanus, die vor allem an den Bahnhöfen stark waren. Bei uns bestellten auch die Gewerkschaften, die Büchergilde Gutenberg, die DKP und alle möglichen Buchhandlungen. Wir hatten auch sehr gute Kontakte zu den Naturfreunden und so weiter. Gut, wir haben auch Einzelversand per Nachnahme gemacht. Platte rausgesucht, Rechnung geschrieben, Packpapier drum, per Nachnahme, zack. Das führte übrigens zu bösen Briefen – weil Sie vorhin nach dem Echo der Kunden gefragt haben. Das ist interessant: Wenn es um die Versandart ging, meldeten sich die Leute und zwar sehr lautstark (keift): „Frechheit! So ’n linker Verlach erlaubt sich so kapitalistische Methoden!“ – Da hab ich immer gesagt: „Die können sagen, wasse wollen. Deren Verständnis heißt: Ihr könnt auch acht Wochen aufs Geld warten – in der Zeit sind wir pleite!“ Ich sach: „So nicht! Entweder Sie schlucken die Bedingungen, die wir diktieren, oder Sie hören sich die Schallplatten von Ernst Busch bei ihrem Nachbarn an, aber nicht direkt die eigenen!“ Also, da war ich knallhart! Und es gab damals ja die Chaotenbewegung, die Vereinigung des linken Buchhandels. Das waren die Chaoten-Buchhandlungen, also die Brüder Wolf in Frankfurt, Verlag Roter Stern und so weiter – die brachten ein Zeug raus! Die kauften natürlich bei uns und machten dann so Stände mit so Apfelsinenkisten auf der Straße. Und es gab die Asten, die vor den Unis Bücher und Schallplatten verkauften. Die haben natürlich auch immer Busch verkauft.
Hat Pläne auch auf Veranstaltungen direkt verkauft?
Ja, wir selber machten auch Stände auf den Gewerkschaftstagen, bei Konzerten, auf Ostermarsch-Abschlusskundgebungen und auf DKP-Veranstaltungen wie den Parteitagen. Bei der SPD kam man nicht so rein, die fassten uns mit spitzen Fingern an. Wir haben natürlich jede Chance genutzt, Umsatz zu machen. (…) Wir belieferten übrigens nicht nur Deutschland, sondern auch die bürgerliche Schweiz und die Schnürschuhsozialisten in Österreich. Das war ja noch ’ne Nummer schärfer. Das Tollste, was man sich in der Schweiz anhörte, war Hüsch. Hüsch war ja ein großer Star dort. Auch mit „Chant du Monde“ in Frankreich haben wir kooperiert. Mit denen haben wir die Chile-Platten rausgebracht.
Gingen die Verkaufszahlen der Busch-Platten in den sechs Jahren, in denen Sie Geschäftsführer waren, zurück?
Nein, das war gleich bleibend. Also ungefähr 10.000 pro Jahr würde ich sagen. Und das ist eine ungeheure Zahl. Ich weiß nicht, wie viel die heute davon verkaufen. Aber ich bin überzeugt, dass der auch heute noch einigermaßen geht. Das ist jetzt Erbepflege, das hat sich gewandelt. (…)
Wie erklären Sie sich den Erfolg des Pläne-Verlags in den 70er Jahren?
Eins muss klar sein: Es war nicht nur reinstes Klassenbewusstsein, was zum Umsatz der Platten beitrug. Links zu sein war ja auch eine Mode, es war schick. Und es war auch unser Begehr, das abzudecken, das mitzunehmen. Trotzdem haben wir versucht, eine klare Sprache gegen all diese sich links nennenden Fraktionen zu setzen. Was heißt das? Das fußte auf einer Tradition, die wir pflegen und weiter geben wollten. Und das war keine sozialdemokratische, das war eindeutig die antifaschistische und auch die kommunistische Tradition. (…)
Wie haben Sie diese anderen Fraktionen und Mitbewerber beurteilt?
Das waren Chaoten.
Warum Chaoten? Was hat die unterschieden von Ihrer Art des Linksseins?
Vom Weltbild her reichte das von Maoisten über Trotzkisten bis hin zu allen Fraktionen, die Sie sich denken können. Aber natürlich haben diese K-Gruppen-Leute auch Platten bestellt.
Hatten Sie Verbindungen nach Berlin, zum Beispiel zur SEW?
Nein, aber die haben auch Platten bei uns bestellt. Berlin war, das muss ich sagen, relativ weit weg von uns. Die Szene in West-Berlin haben wir uns immer beguckt wie ’n Zoo. Aber von da kam auch einer unserer besten Verkäufer: Peter Piffer. Der machte Touren für uns von Passau bis Ostfriesland und nahm sich die Plattenläden in der ganzen Republik vor. Der brachte jede Menge Aufträge mit. Der verkaufte Busch und alles Mögliche. Was hatten wir damals für Platten im Programm? „Kämpfendes Afrika“ mit ganz bestimmten Dialekten aus Südafrika, Nelson Mandela saß ja. Dann hatten wir Platten zur Chile-Bewegung, als ’73 Salvador Allende weggeputscht wurde und zu Tode kam: Quilapayun war eine große Gruppe im Wahlkampf von Allende, das Gleiche gilt für Inti Illimani. Nach dem Putsch schnellten die Verkaufszahlen dieser Gruppen stark in die Höhe. (…)
Antiapartheidbewegung, Lateinamerika-Solidarität, progressive Kindererziehung und mittendrin Ernst Busch. Es scheint so, als sollten seine Lieder in diesem Kontext wieder ihre ursprüngliche Funktion erhalten. Ging es darum, sie wieder zu Waffen im Klassenkampf zu machen?
Ganz richtig.
War das nicht total illusorisch und unmöglich?
Unsere Verkaufszahlen sagten was anderes. (…) Dass es unmöglich sei – auf so ’ne Antwort wären wir nie gekommen. Wir hatten den Eindruck, dass wir etwas wieder aufgegriffen hatten, verbreitert und an den Mann gebracht hatten. Verstehen Sie, es ging darum, die Wurzeln zu erhalten und auch daraus zu lernen. Und wenn Sie das Lernen als Kampfauftrag oder als Anleitung zum Kampf sehen – meinetwegen. (…)
Ehrlichkeit und Heroismus: Die Wirkung der Lieder
Wieso konnte der „Rote Wedding“ in Dortmund funktionieren?
Der „Rote Wedding“ ist ein Synonym für eine ganz bestimmte Geschichte, für eine Kampfsituation. So ähnlich wie „Die Arbeiter von Wien“, was Kittler gesungen hat beim Arbeiterliederfestival. Oder die „Schlacht um das Zeitungsviertel in Berlin“, das ist auch so ein Lied. Es geht also nicht primär um den Wedding. Das war eben ein in der Arbeiterklasse bekanntes Lied. Darum ging ’s. Und es war eben nur noch bei Eingeweihten da. Wenn Sie das Lied hören, also wenn Sie ’n bisschen Gefühl dafür haben, dann merken Sie, wie Ihnen was übern Rücken läuft. Das Lied hat was.
Was ist das? Können Sie das beschreiben?
Was ist das? Es spricht Emotionen an. Es überhöht Mut, es überhöht Treue, Ehrlichkeit, Einstehen für etwas bis zum Tod. Uns war ja schon bekannt: Die sind in den KZs erschlagen worden für ihre Meinung, ohne jemanden zu verraten oder zu gefährden. (…)
Hat das was Heroisches?
Das hat auch was Heroisches. Also nicht was Heroisches im Sinne von: Ich flieg zum Mond – halte ich für weniger heroisch, obwohl ich da auch das Leben gefährde. Sondern dieses Einstehen für Werte – völlig unabhängig, ob diese Werte jetzt von jedermann getragen werden. Aber dieses Einstehen: Der hat dafür gekämpft, ist auf die Straße gegangen, hat Arbeitslosigkeit in Kauf genommen, hat im KZ dafür gesessen für ’ne Meinung zu haben, für gewählt zu haben, für auf die Straße gegangen zu sein, für Funktionen gehabt zu haben – das hat schon was. (…) Das Problem ist, dass man ein bestimmtes Wissen braucht, um diese Lieder zu verstehen. Haben die uns heute noch was zu sagen? Ja, wenn erklärt wird, wo das alles herkommt. (…) Es gibt zwischen der Pflege des Erbes und dem, was ich aktuell damit erreichen kann, schon noch ’n paar Schritte. Nehmen Sie die Lieder des Spanischen Bürgerkriegs: Für uns damals äußerte sich darin internationale Solidarität und darin steckte viel Kraft. (…) Es ging auch darum, das war unsere feste Überzeugung, Kraft draus zu saugen aus diesen Geschichten.
Weil Sie die bewundert haben, die Kämpfer der Internationalen Brigaden?
Ganz genau.
Waren das Vorbilder?
Das waren auch Vorbilder. Ich bin übrigens heute noch der Meinung: Demokratie ist die Freiheit des Andersdenkenden – aber nicht der Faschisten. Das ist für mich ’n Straftatbestand, aber keine freie Meinung. (…)
(Exkurs zur Covergestaltung der Busch-Platten bei Pläne)
(Ende der ersten Seite der zweiten Kassette)
Schlagerfuzzies und Liedermacher: Die Musikszene der 70er
Was waren die am besten verkauften Platten bis zu Ihrem Weggang 1976?
Bei den Langspielplatten war Busch der Spitzenreiter. Wobei ich die Verkaufszahlen der chilenischen Gruppen jetzt nicht im Kopf habe. Der Mikis Theodorakis, den wir ja im Programm hatten, als der im Knast saß beim Putsch der Offiziere in Griechenland, der hat sich auch gut verkauft. Der Verkauf lag nur unwesentlich unter Busch. (…)
Und Degenhardt?
Der war bei uns ja nur im Rahmen des Arbeiterliederfestivals, sonst war der bei Polydor. Franz Josef Degenhardt war auch Geschäftsmann, der hat gesagt: „Was garantiert ihr mir? 20.000 LPs im Jahr?“ – Die hat der bei Polydor verkauft, der war zeitweise der Spitzenreiter vor Heino. Wir konnten ihm solche Garantien nicht geben.
Wer war denn die größte Konkurrenz für Sie?
Niemand. Polydor machte ja außer Degenhardt nichts, was uns betraf. Nein, es gab keine Konkurrenz, wir waren konkurrenzlos. (…) Und selbst Degenhardt hat ja nicht durchgängig ein rein linkes Spektrum bedient.
Was denn sonst? Das war doch Ihre Zielgruppe …
Nee! Haben Sie sich mal die „Wallfahrt zum Big Zeppelin“ angehört? Da hat er allenfalls die Kiffer-Zielgruppe im Auge. Der hat den Hohen Meißner (Anhöhe bei Kassel, hier fand 1913 das erste organisierte Treffen der Jugendbewegung statt; JV) oder weiß der Teufel wen, also eher die Bündische Jugend bedient. Das ging in Richtung Burg Waldeck-Publikum, das wir zwar auch bedient haben, das aber nicht direkt unsere Leute waren. Da ging ’s um die Blaue Blume und so ’n Kram. Verstehen Sie, der karrieregeile Reinhard May und die karrieregeile Katja Epstein kommen aus dieser Ecke. Und die haben nachher den Abflug gemacht, um richtig Geld zu verdienen. Es gab eben eine Zeit, da hat man mit so was kokettiert. Bei uns hat zum Beispiel mal der Udo Jürgens angefragt, ob es nicht mal Zeit wäre, dass er Arbeiterlieder singt. Da haben wir gesagt: „Tu das lieber nicht!“ Ich weiß nicht mehr, wie der Kontakt damals war, ob wir telefoniert haben oder ob wir den getroffen haben. Jedenfalls: Er kriegte das mit, dass das boomt. Dieser Teil der Gesellschaft wurde nicht bedient. Und das Seichte nahm ja ab, wenngleich die Verkaufszahlen noch einigermaßen hoch waren. Aber es war schon absehbar, dass diese ganzen Schlagerfuzzis, die in Wellen hochkamen, sich nicht mehr lange halten würden. Jürgens machte dann zum Beispiel „Griechischer Wein“ zur Zeit der Putschisten. Das war Kalkül, und das war ein Riesenerfolg.
Warum haben Sie die Anfrage von Jürgens abgelehnt?
Wir waren alle dagegen. Udo Jürgens und Arbeiterlieder – das konnten wir uns nicht vorstellen! (…) Der hatte damals ja schon den Grand Prix gewonnen. Ich glaube, selbst wenn wir ’ne Garantie gehabt hätten, dass wir auf einen Schlag 100.000 Platten von dem loswerden – wir hätten das nicht gemacht. Das war uns eine zu seichte Verwandtschaft. (…)
Der Piscator-Schauspieler Albert Venohr hat mal in einem Interview in den 70ern auf die Frage, wie man sich Buschs Popularität vor ’33 vorstellen müsse, gesagt, das sei so ähnlich gewesen wie bei Jürgens …
Für die damalige Zeit mag das zutreffen. Busch hieß ja „Barrikaden-Tauber“. Und das macht auch Sinn. Richard Tauber, der große Tenor, war der große bürgerliche und auch kleinbürgerliche Bediener. Der hatte ja auch Stimme, wobei er sich auch Stimmlagen umschreiben ließ, weil er bestimmte Lagen nicht packte. Bei Busch gab es auch ganz klare Grenzen … Eigentlich kann der ja nicht singen, wir wollen den ja jetzt nicht nachträglich zum Heldentenor machen … (…) Eines muss ich aber auch sagen: Wir haben bei Pläne nie das kommerzielle Niveau von Popmusik erreicht. Diese Produkte waren kein Massenphänomen. Das anzunehmen hieße auch die linke Bewegung selbst in den 70er Jahren zu überschätzen. (…) (Exkurs über die zahlenmäßige Größenordnung linker Protestbewegungen)
Wie würden Sie die Bedeutung des Pläne-Verlags in den 70ern nachträglich einordnen?
Das, was gelungen ist, war die Erbepflege. Das nehme ich für Pläne in Anspruch. Das ist ein wesentliches Verdienst. Aber daraus lässt sich keine Massenbasis ableiten. Das ginge zu weit, wir waren nicht der große Mufti! Wir waren auch was ganz Skuriles! Wir haben erfolgreich ein Segment besetzt oder eine Nische wenn Sie so wollen.
Was war das für eine Nische? Sie benutzen ja Begriffe wie Erbepflege, die in der Kulturpolitik der DDR eine große Rolle spielten …
Ja, das haben wir auch bewusst gemacht. Die DDR war ja kein Feindbild für uns. Das wurde uns ja auch vorgeworfen, als wir zum Beispiel die Singebewegung rausbrachten mit einem Lied über den Guillaume. (…) Ich fand diese Lieder zum Teil übrigens ganz erfrischend, weil die nicht so konzertant und perfekt produziert waren wie die Busch-Lieder mit diesen Chören und dem ganzen Drumherum. (…)
Würden Sie sagen, dass der Pläne-Verlag in Opposition zum gesellschaftlichen System der Bundesrepublik stand?
Absolut.
Klassik gegen Kampflieder: Die Gründe für den Ausstieg
Warum sind Sie ’76 bei Pläne ausgestiegen?
Es ging wieder um Erbepflege. Ich hatte ja auch Bildungsanspruch und hab irgendwann gefragt: „Was is denn mit dem klassischen Erbe?“ Abgesehen von einer Beethovenplatte für die DKP hatten wir so was nie gemacht. Da war die DDR uns weit voraus: Oper, Konzert, Theater – das ist eben auch Erziehungssache. Ich hab also gekämpft für gute klassische Schallplatten. Ich wollte auch das bürgerliche Erbe an die Arbeiterklasse heranbringen – nicht nur kämpferisches Liedgut. Das war nicht durchsetzbar. Die Kollegen wollten nicht. Dabei hätten wir Aufnahmen aus der DDR billig haben können.
Gab es Streit?
Nein. Ich hab einfach gesagt: „Wisst Ihr, Jungs, wenn ich mir nicht irgendwann mein Sozialarbeiterdiplom in die Toilette hängen will, das ist ja irgendwann nix mehr wert, dann ist das jetzt der Zeitpunkt, um wieder in den Beruf zurück zu gehen.“ Ich hab einen hochsolventen Verlag verlassen, der Not leidenden anderen linken Verlagen Darlehen geben konnte. Die sind ja alle kaputt gegangen: Pahl-Rugenstein, dann der Weltkreisverlag, wo die FDAJ-Zeitschrift erschien, dann der Röderberg-Verlag in Frankfurt. Wir haben bei diesen Verlagen schon mal ’ne Anzeige für 1000 Mark geschaltet, um die zu unterstützen, was ja eigentlich Quatsch war, weil wir damals gesagt haben: „Da werben wir wieder in der eigenen Suppe.“ Aber denen ging ’s halt schlecht. Der einzige, der überlebt hat, ist der Pläne-Verlag. (…) Uns ging es so gut, dass wir sogar im Spiegel inseriert haben. Das war eine der teuersten Anzeigen, die wir je gemacht haben. 50.000 Mark hat die gekostet, das war, glaub ich, ’ne fünftel Seite, so ’n Streifen am Rand. (…) Ich wollte das nur als Beispiel sagen: Ich hatte den Verlag wirklich nach oben gebracht, wir sind mit ’nem Ein-Mann-Verlag angefangen und hatten nachher, was weiß ich, 25 Leute beschäftigt. Los ging es in einer Dreieinhalb-Zimmer Wohnung in der Humboldtstraße, im Schlafzimmer war das Lager. Später hab ich ein Haus angemietet in der Rohrallee. Nach meinem Ausstieg haben die, so weit ich weiß, das Niveau gehalten. Es kam aber nicht mehr viel Neues dazu. (…)
Hans Dieter Hüsch, Franz Josef Degenhardt, Wolf Biermann
War das eine musikalische Geschmacksfrage, Ihre Auseinandersetzung im Verlag: Klassik gegen kämpferisches Liedgut?
Nein, das war eine politische Entscheidung, durch die wir übrigens auch Hans Dieter Hüsch verloren haben. Der Hüsch wollte wieder eine seiner literarischen Platten machen, und ich hab gesagt: „Lasst uns die doch machen!“ – Aber nein, das Geld sollte für was anderes eingesetzt werden. Das Denken wurde immer enger. Das hatte auch mit der politischen Entwicklung zu tun, Honecker wurde als Hoffnungsträger gesehen, und da war so was nicht mehr möglich. Ich hab das Telefonat mit Hüsch damals selbst geführt und musste sagen: „Tut mir leid, Hans Dieter, wir haben da kein Geld für – und das stimmte gar nicht!“ (…) Hüsch war ja ein sehr schwieriger Mensch, den sie sehr verletzt hatten in der 68er Bewegung. Hüsch war ein bürgerlicher Humanist, der nicht ganz in diese Zeit zu passen schien. Das war ein sprachbegabter guter …, ja, ein guter Mensch einfach. Und er ist dann so wüst beschimpft worden von diesen Linksradikalen – da trägt der heut noch dran, das hat der nie vergessen.
Was war da vorgefallen?
Es gibt ja kaum einen, der so mit der deutschen Sprache spielen kann, wie Hans Dietrich Hüsch. Und man muss sich nun vorstellen: Der tritt auf mit – was weiß ich, „Der Küster tritt die Treppe krumm“ – beim Waldeck-Festival, und dann kommen natürlich jede Menge Chaoten aus Berlin und von woanders und schreien (gröhlt): „Ey, Hüsch! Wo ist das Politische! Hör mit deinem Scheiß auf!“ – Und das ist ihm bei jedem Auftritt passiert. Er hat sich nachher mit so Floskeln gerettet, hat dann verschüchtert und verletzt ins Mikrofon gesagt: „Herr, schenk mir meinen täglichen Zwischenruf!“ Franz Josef Degenhardt war da ganz anders. Ich erinnere mich an eine große Veranstaltung, die wir in Bochum machten. Fünf Mark Eintritt, das war viel Geld damals, die Ruhrlandhalle war rappelvoll, siebeneinhalb Tausend passen da rein. Degenhardt fängt an zu spielen, da schreit einer (wieder gegröhlt): „Ey, was machst Du eigentlich mit deinem vielen Geld?“ – Das ging weiter, die nächsten riefen: „Genau, wat is mit dem Geld?“ – Die konnten ja alle rechnen, was da rauskam bei fünf Mark Eintritt … Franz Josef grinst und sagt (flötet): „Da geh ich gleich mit in Bochum in ’n Pu-huff! Haste was dagegen?“ – Gegröhle … Die merkten schon, wenn sie sich mit dem anlegten, kriegten sie Saures. Aber Hans Dietrich Hüsch war anders, der konnte sich nicht wehren. Wenn da einer aus dem Publikum hochging, schrak der zusammen, da hörte der auf.
Waren diese Zwischenrufe typisch für die Zeit, für die linke Bewegung?
Allerdings. Und je linksradikaler und maoistischer die Leute waren, je unflätiger waren diese Zwischenrufe und auch die Aktionen. Denken Sie an Langhans! Da hat der Degenhardt in einem Lied drauf angespielt: „Aber in die Akten scheißen mögen wir hier nicht.“ Das hatten die doch gemacht während der Verhandlung, stand doch in jeder Zeitung … Verstehen Sie, was das mit Kleinbürgern macht? Da hieß es (angeekelt): „Wat sind das für Tiere?“ – Die hatten für sich in Anspruch genommen, links und revolutionär zu sein … Also, ich hab immer gesagt: Wenn es diese Bande nicht gäbe, dann müsste sie der Strauß erfinden. (…) Für mich waren das die Büttel der Reaktion. (…) Entsprechendes, nur viel extremer, gilt für die RAF, die machten alles kaputt und betrieben damit das Geschäft des Klassenfeindes.
Wenn Busch sang „Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre“, hatten Sie bei Pläne keine Probleme damit?
Gegen Gewalt hatten wir nix, wir hatten was gegen individuellen Terror! Wir hatten ja den Anspruch, uns im Marxismus auszukennen. Und da gibt es den schönen Satz: Die Form der Auseinandersetzung bestimmt immer der Gegner. Das heißt, der Kampf um die Macht vollzieht sich so lange ohne Gewalt, bis das Regime zur Gewalt, und zwar zur militärischen Gewalt, greift. Und dann schlägt es um. (…) Der Einsatz von Knüppeln und Wasserwerfern und zwei, drei tragische Todesfälle sind damit nicht gemeint. Also nicht nach dem Motto der RAF: Wenn die Polizei kommt ham wir alle verdeckt ’ne 08 in der Tasche und schießen die nieder. Das war nicht unser Standpunkt. (…) Ein revolutionärer Akt muss außerdem immer auch von der Stimmung der Bevölkerung getragen werden. (…) Die Gewaltfrage würde entschieden werden, das war für uns ganz klar, wenn ’ne revolutionäre Situation da sein würde. (…)
(Exkurs zu Andreas Baader und Ulrike Meinhof)
Welche Haltung hatte der Pläne-Verlag gegenüber Biermann. Hätte der Sie interessiert?
Nee, das Arschloch hätten wir ums Verrecken nicht genommen. Für uns war das ein klarer Verräter. Der machte dann Platten bei Wagenbach, seinem Leib- und Magenverleger, diese selbst aufgenommenen Lieder aus dem Wohnzimmer. Da haben wir drüber gelacht. Das war keine Konkurrenz für uns.
Haben Sie vorhin nicht gesagt, dass Sie gerade weniger perfekte Produktionen mochten?
Ja, aber es war Biermann. Den mochte ich weder sprachlich noch musikalisch. Den hätten wir nie produziert. Da waren wir uns alle einig. (…) Ich fand den auch größenwahnsinnig. Das war ja kein zweiter Busch, das war nicht mal ein Krug! Der hatte noch nix auf die Beine gestellt und tauchte plötzlich als der große DDR-Kritiker auf.
Eine DDR-kritische Haltung war bei Pläne tabu?
Unsere Haltung war: Das macht man nicht. Das macht ja der Klassenfeind schon. Anti-Kommunisten gab ’s schon genug! Da reihten wir uns nicht ein, das müssen Sie aus der Zeit heraus verstehen! (…) Natürlich hatten wir auch Bedenken, die hatte jeder. Aber wir haben keine Platte darüber gemacht. Das machte der Springer schon, das war antikommunistisches Tagesgeschäft damals. (…)
Das Degenhardt-Konzert, das Sie erwähnt haben, war von Pläne veranstaltet worden. Haben Sie noch andere Veranstaltungen organisiert?
Ja. Wir hatten dann auch eine Konzertagentur, haben das „Arbeiterlieder-Festival“ veranstaltet und vieles andere. Das war sozusagen das Abdecken, von mir aus können Sie auch Absahnen schreiben, also: das Abschöpfen der Konzertseite. Auch das Live-Geschäft wollten wir mitnehmen. Wir haben da gewissermaßen das ganze linke Spektrum bedient. Aber wir haben ausgesucht, wir haben nicht jeden genommen! So ist es nicht!
Sie hatten schon damals so was wie eine, heute würde man sagen: Corporate Identity …
Ja, ja, ja. Das war auch mein hohes Anliegen. Wobei ich überhaupt nicht wusste, was das war zum damaligen Zeitpunkt. Also, dieser Wiedererkennungseffekt auch durch den Grammophonapparat in diesem roten Kreis war natürlich ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Über den Slogan haben wir ja schon gesprochen.
Ist das eine Qualität der Linken? Slogans und Parolen zu kreieren? „Vorwärts und nicht vergessen“, „Ami go home!“ und so weiter …
Das konnte nicht anders sein. Das waren ja Lieder der Arbeiterklasse (…). Das muss hämmern, das muss sitzen, das muss wiederholbar sein! Und zwar nach drei, vier mal hören muss man das mitsingen können! Das wurden dann geflügelte Worte. Oder denken Sie an Kittner: „Vom Denken kriegt man Beulen.“ Das ging so: „Wer denkt, ist links / Wer links ist, demonstriert / Wer demonstriert, kriegt Beulen / Also: Vom Denken kriegt man Beulen!“ – Den Spruch hat der sein Leben lang verkauft.
Haben Ihnen eigentlich Ihre Kollegen den Ausstieg bei Pläne übel genommen?
Unter Linken geht das ja immer fast bis zum Beziehungsverlust, wenn Sie so ’ne Arbeit beenden. Ich glaub schon, dass mir das übel genommen wurde. (…)
Letzte Frage: Was war das Besondere an Busch? Wofür steht er?
Er war die singende Stimme der deutschen Arbeiterklasse.
Auch wenn es nicht unbedingt mehrheitlich die Arbeiterklasse war, die die Pläne-Platten kaufte?
Jetzt müssten wir natürlich soziologisch aufschlüsseln, wie sich die linke Bewegung in den 70er Jahren in der Bundesrepublik zusammensetzte. Dass die Mehrheit der Arbeiterklasse nicht da zu finden war, wurde ja schon an den Wahlen deutlich. Aber es ist unbestritten, dass viele aus der SPD – jetzt können Sie auch fragen, ob das die Arbeiterklasse ist – unsere Platten gekauft haben. Ich kann aber den Arbeiteranteil unserer Käufer nicht beziffern. Ich mein schon, die Mehrheit der Plattenkäufer kam aus dem sozialistischen Beritt. Aber natürlich waren da auch Studenten dabei und alle möglichen Leute aus dem bürgerlichen Lager.
Interview: Jochen Voit
Foto: privat
(Textfassung autorisiert von Ingo Boxhammer am 20. Januar 2006)

Renate Bronnen
über ihr Leben als Österreicherin in der DDR und ihre Freundschaft mit Ernst Busch
„Beim Singen hatte er eine ungeheure sexuelle Ausstrahlung!“
(Gespräch am 10. Mai 2005 in Berlin)
Renate Bronnen (geborene Bertalotti) ist Jahrgang 1922. Sie wächst in Mauthausen und Linz auf und studiert nach dem Abschluss des Lyzeums Gesang und Schauspiel. Mit 19 heiratet sie den Schriftsteller Karl Kleinschmidt. Die Ehe hält nicht lange. Durch ihre Schauspieltätigkeit lernt sie 1947 den Schriftsteller Arnolt Bronnen kennen, der als Redakteur einer kommunistischen Zeitung in Linz arbeitet. 1952 heiraten die beiden in Wien. Renate Bronnen ist die dritte Ehefrau des umstrittenen Autors. Vier Jahre später entschließt sich Arnolt Bronnen, nach Berlin in die DDR überzusiedeln. Renate Bronnen geht mit ihm und bleibt auch nach dem frühen Tod ihres Mannes in der DDR wohnen. Fortan führt sie mit ihren beiden Söhnen ein Leben in zwei Welten: Sie pendelt zwischen Österreich und Ost-Berlin, wobei sie die Vorzüge beider Welten zu schätzen weiß: In Österreich verbringt sie einen Großteil ihrer Freizeit, in der DDR nimmt sie kulturelle Verpflichtungen wahr und pflegt Kontakte zu Künstlern und ehemaligen Kollegen ihres verstorbenen Mannes. Gut befreundet ist sie mit Ernst Busch, der wie sie in Niederschönhausen wohnt. Renate Bronnen lebt bis heute in dem Haus, in das sie 1956 mit ihrem Mann Arnolt Bronnen eingezogen ist.
Es ist fast unmöglich, dem viel zitierten österreichischen Charme nicht zu erliegen, den Renate Bronnen verbreitet. Sie lacht viel und sie kann selbstironisch erzählen: “Sie, wanni Ihnen zu viel red, sang Sie ’s!“ – Beim Gespräch gibt es große Mengen Kaffee und Kuchen. Ich werde mehrmals ermahnt, mehr zu essen und zu trinken. Zwischendurch erläutert sie mir die Einrichtung des Wohnzimmers, den österreichischen Bauernschrank und auch die Bilder an den Wänden, „zum Teil Beutestücke aus meiner ersten Ehe“, sagt sie. Unser Gespräch dauert mehr als vier Stunden („Wissen Sie, ich hab 100 Geschichten, nicht eine, Sie müssen mich gezielt fragen!“). Zum Schluss kommt noch eine Freundin Renate Bronnens hinzu, Inge Drinda, die ebenfalls Geschichten über Ernst Busch zu berichten weiß.
Jochen Voit: Erzählen Sie bitte zunächst, wo Sie herkommen und wie Sie aufgewachsen sind …
Renate Bronnen: Geboren bin ich in St. Pölten in Niederösterreich als Tochter eines ehemaligen k.u.k.-Offiziers. Mein Vater ist nach dem Ersten Weltkrieg sozusagen von der dienenden Truppe entlassen gewesen – er war nach wie vor im militärischen Dienst, aber nicht mehr in Uniform. Er war geschieden, also ich war eigentlich Waisenkind im Sturm der Zeit. Meine Mutter hat mich stehenden Fußes verlassen, wie ich zwei Jahre alt war, wegen eines anderen Mannes. So was hat ’s immer schon gegeben, nicht wahr. Und mein Vater hat dann wieder geheiratet: eine sehr nette, sehr schöne, sehr angenehme Frau, das war dann sozusagen meine Stiefmutter. Ich wusste aber gar nicht, dass ich eine Stiefmutter hab, weil ich ja viel zu klein war. Die ersten sieben Jahre meines Lebens bin ich in Mauthausen bei meiner Großmutter aufgewachsen.
Der Ort hat später traurige Berühmtheit erlangt durch das Konzentrationslager …
Ja, aber wissen Sie, was interessant ist? Mauthausen war ja ein Nest, ein Markt halt an der Donau. Da war der Bettelberg, dieser Steinbruch, der dann das KZ Mauthausen war. Und wenn wir als Kinder dort oben spazieren gegangen sind, hat ’s immer geheißen: „Aber geht nicht zu weit! Geht nicht bis zum Bettelberg, das ist viel zu gefährlich!“ – Nicht dass man abstürzt … So hatte der Bettelberg für mich schon immer etwas Düsteres und etwas Unheimliches – noch bevor die Nazis das Lager bauten. (…)
Wohin kamen Sie nach Ihrem siebten Lebensjahr?
In Mauthausen war ich nur im Kindergarten, in die Volksschule bin ich dann in Linz gegangen. Dort hab ich auch Matura gemacht am Lyzeum. Dann war ’38 der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich …
„Tschingderassa-Bummbummbumm!“ – Kindheit in der Kaserne
Waren Sie damals politisch interessiert oder geprägt?
Ja, freilich. (…) Ich bin ja eigentlich in einer Kaserne aufgewachsen, weil mein Vater als Offizier in einer Kaserne gewohnt hat – wir haben eine sehr schöne große Wohnung gehabt. Ich bin also mit Militär, mit Tschingderassa-Bummbummbumm – hör ich heut noch gern, liegt mir irgendwie im Blut – und mit Fahnen und all diesen Sachen aufgewachsen. Und ich kann mich erinnern: Im Jahr ’34 war dieser Aufstand von den Sozialdemokraten, von den Sozis in Österreich. Und die Kaserne meines Vaters war am Stadtrand von Linz, wo auch die Brotfabrik war, und dort waren die Roten. Da wurde geschossen, und wir mussten uns verstecken … So bin ich als Kind aufgewachsen: mit Stahlgewittern, Stechschritt und Traraa. Aber es hat mich weiter nicht gestört, möchte ich sagen. (Lachen) Ja, es gehörte einfach zu meinem Lebensbild.
War Ihr Vater Monarchist?
Wahrscheinlich. Genau weiß ich ’s nicht, ich bin ja erst ’22 geboren. Er war jedenfalls noch im Ersten Weltkrieg als Offizier. Meine ersten beeindruckenden Kindheitserinnerungen haben mit ihm zu tun: Da sind wir ausgefahren mit Militär und Pferden, Autos gab ’s ja so gut wie keine. Er wurde dann aber sehr herzkrank und ist gestorben, als ich zehn Jahre alt war. Es war ein Gehirnschlag, glaub ich, es ging ziemlich rasch in meiner Erinnerung. Ich bin dann bei der Stiefmutter aufgewachsen und gehörte zu denen, die ’40 die erste Kriegsmatura machten.
Wie veränderte sich das Leben durch den Anschluss ’38?
Das war natürlich toll! Österreich, besonders Linz, war ein langweiliges Bauerndorf gewesen. Und auf einmal kamen die Nazis und es war was los. Wir sind mit Tschingderassa-Bumm und weißen Stutzen in die Schule marschiert. Wir hatten ja keine Ahnung, worum es geht! Nur eines muss ich sagen: Am Stadtrand, wo wir in der Kaserne in der Garnisonstraße gewohnt hatten, da gab es nicht weit ein richtiges Armenviertel, der Hühnersteig. Die Leute dort hießen „die Ausgesteuerten“, das waren Obdachlose, die keine Arbeitslosenhilfe mehr bekommen haben, die es ja damals unter Dollfuß auch schon gab (Engelbert Dollfuß, österreichischer Bundeskanzler, 1934 von Nationalsozialisten im Bundeskanzleramt erschossen; JV). Und die mussten sich jeden Freitag oder Montag irgendwo anstellen, und das war direkt auf meinem Schulweg. Mein Vater hat immer zu mir gesagt: „Du, geh nicht diesen Weg, du gehst die andere Straße!“ – Als ob die mir was getan hätten, diese armen Teufeln. Das waren die Ärmsten der Armen. Ich seh sie heut noch vor mir: wie KZ-Gestalten, grau, fahl, in Lumpen und nichts zu essen, so standen sie da. Was hätten die mir tun sollen? Ich bin also immer dort vorbeigegangen, weil mich das einfach interessiert hat, was mit denen ist, was da passiert. (…) Vielleicht muss man das gesehen haben, um zu verstehen, wieso der Hitler so mit Tschingderassa-Bumm empfangen worden ist, wieso der so umjubelt war. Denn diese ganzen armen Leute waren dann schlagartig weg – aber nicht eingesperrt im KZ, sondern die hatten Arbeit. Drum haben die auch alle den Hitler gewählt.
Sie erinnern sich also zunächst an positive Veränderungen?
Absolut, absolut. Weil auf einmal alle Arbeit hatten, und dadurch jeder ein ganz ein anderes Lebensgefühl hatte. Das war die große positive Veränderung.
Waren Sie dann beim BDM?
Ja, natürlich. In meiner Klasse waren auch zwei BDM-Führerinnen, die wahrscheinlich schon vorher, also in der Schuschnigg-Zeit, illegal dabei waren (Kurt von Schuschnigg, österreichischer Bundeskanzler nach Dollfuß bis zur Absetzung durch die Nationalsozialisten 1938; JV). Es hat ja illegale Nazis gegeben in Österreich, und als dann der Hitler kam, sind die auf einmal alle aus ihren Löchern gekommen. (…) Ich muss Ihnen sagen: Linz war eine Hochburg Hitlers. Wir sind auf der Straße umeinander gerannt und haben geschwärmt von seinen schönen blauen Augen, so ein Schwachsinn! Das ist mir alles erst nachher zu Bewusstsein gekommen.
Wann war das ungefähr?
Kurz vor ‚m Zweiten Weltkrieg, würde ich sagen. Oder jedenfalls kurz nach Kriegsbeginn. Zunächst haben wir uns nichts Böses gedacht, als auf einmal die drei Jüdinnen aus dem Lyzeum verschwunden waren. Das ging schlagartig. Zwei waren Töchter von einem Antiquitätenhändler aus der Linzer Altstadt. Mit denen waren wir genau so befreundet wie mit anderen auch. Und Hitler ist gekommen im März ’38, und Anfang April waren die nimmer da. „Ja, wo sind denn die?“ – „Ja, wieso sind denn die weg?“ – „Ach so, die sind weg.“ Da haben meine Freundinnen und ich noch nichts gemerkt. Aber dass sie weg waren, ist uns natürlich aufgefallen. (…) Der Krieg war dann schon ein einschneidendes Erlebnis. Wir kannten ja alle aus meinem Jahrgang die Jungs vom Realgymnasium. Und die haben sich alle freiwillig gemeldet. Da ist kaum einer übrig geblieben. Von denen, die ich kannte, sind vielleicht drei aus dem Krieg zurückgekommen. Alle anderen sind in den Schlachten geblieben. Die meisten sind zu den Sturzkampffliegern gegangen, die wenigsten zur Marine, dann natürlich zu den Panzerfahrern, das fanden die eine tolle Sache, die haben dafür auf ’s Studium verzichtet. Sind alle auf der Strecke geblieben! Drum haben ja dann nach dem Krieg auch so viele Mädchen aus meiner Generation alte Männer geheiratet …
Kleinschmidt und Bronnen: Zwei Männer für jeweils sieben Jahre
Arnolt Bronnen war ja auch wesentlich älter als Sie …
Ja, aber das war ja meine zweite Ehe. Mit 19 hab ich den Schriftsteller Karl Kleinschmidt geheiratet, mit 20 hab ich ’s erste Kind gehabt. Mein Mann war Sohn gut situierter Eltern, die Kleinschmidtischen und die Weißgärberischen sind übrigens Nachfahren von Anton Bruckner gewesen. Und meine Schwiegermutter ist mal Sängerin gewesen an der Dresdner Staatsoper, mein Schwiegervater war Röntgenologe, Haus in Linz und Schlösschen auf dem Land in Ottensheim. Ich bin dann aber krank geworden, hab eine schwere Lungentuberkulose gekriegt, wobei ich die Disposition zur Krankheit wohl geerbt hatte, meine richtige Mutter ist an TBC gestorben. (…)
Sie haben das offenbar gut weggesteckt …
Gut weggesteckt? Ich bin Überlebensprofi! Ich hab schon zwei tödliche Krankheiten überlebt. Erst die Lungentuberkulose und dann vor zwölf Jahren den Krebs. Ich bin nicht tot zu kriegen. Furchtbar! (lacht) Aber gut, es nützt nichts. Durch dieses Leben muss man durch, sag ich immer.
Wie lange dauerte Ihre erste Ehe?
Ich bin 83 Jahre alt und war zweimal sieben Jahre verheiratet. Sonst war ich frank und frei. (…) Meine erste Ehe wurde geschieden und meine zweite war dann zu Ende, weil der Bronnen gestorben ist. Mein erster Mann hat sich aus dem Staub, mein zweiter in den Staub gemacht … (…)
Wie haben Sie Arnolt Bronnen kennen gelernt?
Das war ’47. Ich hatte ja nach der Schule Gesang studiert und Schauspiel und hatte eigentlich auch in diesem Fach tätig werden wollen. Dann kam aber die offene Lungentuberkulose auf beiden Seiten, und so kam es zunächst nicht dazu. Später dann hatte mein erster Mann eine Andere gefunden, und ich stürzte mich dann endlich in die Schauspielerei. Aber als ich den Bronnen kennen lernte, war ich noch verheiratet, der Bronnen war auch verheiratet. Also, Sie sehen schon, da ging ’s drunter und drüber. (lacht) (…) Wie war das? Genau … Der damalige Intendant von Linz, der Stögmüller, hat gesagt: „Du, weißt‘ was? Da gibt ’s einen Schriftsteller, der heißt Bronnen, der hat ein Stück geschrieben, „Vatermord“, das wollen wir aufführen.“ Nach dem Krieg hatten sich ja lauter so kleine Theatergruppen gebildet, denn es war ja alles in Schutt und Asche, und jeder wollte wieder irgendwas machen. (…) Ich weiß noch, dass ich damals nach Hause kam und meinen Mann fragte: „Kennst du einen Bronnen?“ – „Ja, ja, den kenn ich!“, der war sehr gebildet, der Kleinschmidt. „Naja“, sagt er, „wenn ’s dich interessiert, dann mach ’s doch.“
War der Kleinschmidt politisch eher links oder rechts?
Weder noch, völlig desinteressiert. Er war aber in der Nazi-Partei, weil damals jeder in der Nazi-Partei war. Mein Schwiegervater auch.
Sie auch?
Nein, ich nicht. Wissen Sie, ich war immer schon vorsichtig. (…) Ich wollte bloß nach dem Abitur nicht in den Arbeitsdienst gehen, da mussten ja Jungs und Mädchen hin, Buam und Dirndln. Ich wollte was anderes machen. Und weil wir Beziehungen hatten, Linz war ja eine Provinzstadt, da kannte jeder jeden, sagte man mir: „Weißt was, geh in die Gauleitung! Da kannst a bissl Maschine schreiben oder so was.“ – „Ah ja, das ist eigentlich ganz a gute Idee.“ – Ich konnte weder Maschine schreiben noch stenographieren oder sonst was. (lacht) Ich hab nur ganz gut ausgesehen. (Lachen) Dann bin ich tatsächlich zur Gauleitung gegangen und hab das auch einigermaßen hingekriegt. Aber es hat mich nie ein Mensch gezwungen, in eine Partei zu gehen. Auch hier nicht! Ich war mein ganzes Leben in keiner Partei. Wie ich das geschafft hab, weiß ich auch nicht.
„Bauer, hol die letzte Rübe raus!“ – Propaganda in der Diktatur
Sind Sie in einer Kirche?
Ich bin römisch-katholisch erzogen. Das hatte ich zwischenzeitlich ganz abgelegt: erst durch die Nazi und später dann durch die Kommunisten hier. Aber heute würde ich sagen, ich bin wieder römisch-katholisch, die Kirche interessiert mich doch. Wissen Sie, ich bin ein Mensch des Theaters, mir gefällt alles, was große Aufmachung hat. Nehmen Sie den neuen Papst Benedict XVI, da gefällt mir das ganze Drumherum. Mir hat auch das ganze Drumherum bei den Nazi sehr imponiert. Nur wie ich hierher gekommen bin mit dem Bronnen, hab ich zum Bronnen gesagt: „Du, das ist ja dasselbe in Rot, was ich kürzlich in Braun erlebt hab!“ – Da ruft er: „Das kannst Du nicht sagen! Das ist ganz was Anderes …“ – Also hab ich nix mehr gesagt, aber gedacht hab ich mir einiges.
War das Drumherum, wie Sie sagen, tatsächlich so ähnlich?
Aber ganz genauso. Dieselben Fahnen, dieselben Spruchbänder. „Bauer, hol die letzte Rübe raus!“ – und lauter so einen Schwachsinn. Lauter Blödsinn! Ich dachte mir immer: „Des hab ich doch schon amal irgendwo g’lesen.“
Aber Sie sagen selber, Sie sind anfällig für diese Inszenierungen?
Ja, ich war anfällig dafür. Aber jetzt, nach dem zweiten Mal, nicht mehr. Nie mehr wieder! Und in eine Partei bin ich auch nie gegangen. Das engt ein.
„Vorführung des Raubtiers“ – Die erste Begegnung mit Bronnen
Arnolt Bronnen sah das anders. Der war bei den österreichischen Kommunisten aktiv, als sie ihn kennen gelernt haben …
Ja, er war damals Kultur-Redakteur bei der Neuen Zeit, der kommunistischen Zeitung in Linz. Der Bronnen war überzeugter Kommunist, und er war ja in die österreichische KP eingetreten und war auch eingesperrt im letzten Kriegsjahr. Jedenfalls hat man mich vorgeschlagen für die und die Rolle in dem Stück vom Bronnen. Und der Edwin Sponeck, der war später lange Regisseur in Wien, hat dann den Kontakt zum Bronnen vermittelt. Der hat dem Bronnen in den Kalender geschrieben „Vorführung des Raubtiers“ – das war ich! (lacht) Ich weiß nicht, wieso … Ach so, doch, ich hab damals so einen Wildkatzenmantel gehabt, der wird ’s gewesen sein, nehm ich an … Ich bin also zum Bronnen hin in die Redaktion, und er hat gefragt: „Was können Sie vorsprechen?“ – Hab ich gesagt: „Vielleicht den Monolog von Fräulein Julia aus ‚Julia’ von Strindberg.“ Denn die Rolle hat mir sehr gut gefallen. – „Jo, bitte, bitte!“ Ich hab vorgesprochen, und er hat sich meine Daten notiert, war sehr liebenswürdig, sehr freundlich. Und später, wie wir uns schon gut gekannt haben, hab ich ihn gefragt: „Du, sag amal, wie war ich denn eigentlich?“ Da hat er gesagt: „Was mir an dir am besten gefallen hat, waren deine Beine.“ (lacht) Also, Sie können sich vorstellen … (lacht) Es ist dann eh nie zu dieser Aufführung gekommen, aber ich bin dadurch a bissl getingelt und hab dies und jenes gemacht. Und plötzlich hab ich wieder Blut gespuckt, der zweite Lungenflügel ist von der Tuberkulose befallen gewesen. Und da hab ich mir gedacht: „Jetzt schaff ich ’s nimmer, jetzt geht ’s wirklich nicht mehr!“ Da hab ich mit meinem Leben abgeschlossen, und der Bronnen hat zu mir gesagt: „Also, wenn du stirbst, dann sterb ich mit dir.“ Da hab ich mir gedacht: „Also bitte! Nein, das wirklich nicht! Sterben möcht ich dann doch alleine!“ Aber ich hab das dann doch durchgestanden, hab einen doppelten Pneumothorax gehabt, das muss ungefähr ’52 gewesen sein.
War das sozusagen sein Heiratsantrag an Sie?
Nein, nein, er war ja noch verheiratet. Ich war ja auch verheiratet. Wir waren ja beide noch verheiratet! Wir mussten uns zuerst einmal scheiden lassen. Aber mein erster Mann hat eh auf Scheidung gedrängt, weil er die Nächste heiraten wollte. Und da hab ich mich dann scheiden lassen. Jetzt war aber noch der Bronnen verheiratet. Der hat sich dann auch scheiden lassen. Ich hab dann auch seine geschiedene Frau kennen gelernt und seine beiden Töchter, mit denen ich ein sehr gutes Verhältnis hab. Die Barbara Bronnen hab ich erst vorgestern wieder getroffen bei einem Brunch im Operncafé. (…)
Sie haben dann Arnolt Bronnen 1952 geheiratet …
Ja, es war allerdings eine Wochenend-Ehe, der Bronnen war in Wien bei der Scala und ich hab in Linz gelebt. Wochenend-Ehen sind wunderbar! (…) Ja, wir waren ganz modern – in jeder Hinsicht. (lacht) (…)
Arnolt Bronnen war um einiges älter als Sie. Hat Sie das nicht gestört?
Er war 27 Jahre älter. Aber das hat mich überhaupt nicht gestört! (…)
Ihre beiden Ehemänner waren Schriftsteller. Hat Sie das Schreiben, das Schöpferische, angezogen?
Ja, immer. Sie, ich glaub, ich hab mit zwölf Jahren den Shakespeare gelesen und wollte immer zum Theater, Goethe und Schiller hab ich gelesen – ich kann heut noch die ganzen Balladen auswendig. Für mich ist überhaupt das Kreative absolut erotisch. Ich war mit Malern befreundet und mit Schriftstellern. Obwohl ich aus einer Offiziersfamilie komm … Aber durch meinen ersten Mann kam ich ja in eine, man kann sagen, großbürgerlich-künstlerische Welt hinein. Und das war natürlich eine sehr angenehme Atmosphäre.
Hat Sie die kommunistische Anschauung Bronnens nicht abgeschreckt?
Nein, nein, überhaupt nicht. Weil ich eigentlich mein ganzes Leben lang auf der Suche nach was anderem war – nicht so sehr nach was besserem, sondern nach was anderem. Ich war zum Beispiel schon mit 15 für getrennte Schlafzimmer, und meine Schulkolleginnen haben gesagt: „Nein, Du bist abnormal!“ – Ich hab dann gesagt: „Ich finde getrennte Schlafzimmer wunderbar!“
Haben Sie gern selbst die Entscheidungen getroffen?
Ja, absolut.
Würden Sie sich als emanzipiert bezeichnen?
Nein, das geht zu weit. Als sehr neugierig!
„Das ist was Neues!“ – Umzug aus Österreich in die DDR
Wer hatte dann die Idee, in die DDR zu gehen?
Der Bronnen.
Hatten Sie Lust dazu?
Ja, weil ich neugierig war. Und weil ich mir gedacht hab: Das ist was Neues, das ist was Anderes! (…)
Wie kam Bronnen drauf, in die DDR zu gehen?
„Der Becher geht so lange zum Bronnen, bis er Brecht.“ Die kannten sich doch alle aus der Vor-Nazizeit.
War das ein geflügeltes Wort?
Ja, natürlich, aus den 20er Jahren.
Das sollte heißen, dass die drei unter einer Decke steckten?
Genau. Wobei es dem Bronnen mehr um den Brecht ging. Kennen Sie die „Tage mit Bertolt Brecht“? In diesem Buch hat der Bronnen die Freundschaft der beiden beschrieben. Der Bronnen war ja der meistaufgeführte Autor in den 20er Jahren. Der hat den Brecht mitgezogen. (…) Der Brecht hat alle Menschen benutzt, und so hat er auch den Bronnen benutzt. Der Bronnen hat damals auf den Kleist-Preis verzichtet und hat gesagt, man möchte ihn dem Brecht geben, der Brecht wär der bessere. Weil er den Brecht einfach so bewundert hat. Damals war ich ja kaum geboren, damals war der Ihering der große Kritiker, den hab ich später sogar noch kennen gelernt. (…) Und der Becher hat ja dann als Kulturminister den Bronnen hierher geholt. Übrigens mochte ich den Becher sehr gern. Der Becher war mir viel sympathischer als der Brecht. (…)
Erinnern Sie sich noch gut an Brecht?
Ja, an ihn und an sein furchtbar dreckiges Auto mit dem räudigen Hund drinnen! Da sind wir vom Berliner Ensemble aus irgendwo hinfahren … Insgesamt hab ich ihn dreimal gesehen. Einmal, daran erinnere ich mich noch sehr gut, waren wir bei ihm in seiner Wohnung oben in der Chausseestraße. Da hat er zum Fenster raus auf den Dorotheenstädtischen Friedhof gezeigt und gesagt: „Und dort unten lass ich mich begraben.“ Werd ich nie vergessen. (…) Wissen Sie, ich bin wie ein Schwamm, ich kann alles in mich aufnehmen. Und ich urteile darüber nicht. Sondern ich sag: „Ahaa, der is so, und der is so …“ – Und warum? … – „Ach, is ja ganz wurscht, warum er so is, er is halt so!“ Und wie ich hierher gekommen bin aus Linz, aus der Provinz, und plötzlich unter all diesen Menschen gewesen bin, hab ich nur gestaunt, was für eine Welt sich mir da eröffnet.
Hat Ihnen diese Welt gefallen?
Gefallen? Ungeheuer imponiert! Ich war fasziniert von den Trümmern und von den Intellektuellen und von den Leuten, die hier etwas aufbauten. Das war geistig sehr anregend. (…) Wie gesagt, der Brecht wär jetzt als Mann nicht mein Typ gewesen. Aber der Becher war ein sehr gut aussehender, sehr gepflegter Mann. Er war hinreißend zu mir: „Wenn Sie was brauchen, Frau Bronnen, kommen Sie jederzeit zu mir!“ Ich weiß noch, wie ich zum Bronnen gesagt hab: „Du, wir müssen zum Becher, wir brauchen eine Wohnung.“ Da hat der Bronnen gesagt: „Der ist Kulturminister und kein Wohnungsminister.“ Hab ich gesagt: „Aber der wird einen kennen, der eine Wohnung weiß!“ – So kamen wir zu dem Haus. Das war ’56 und ging über den Schriftstellerverband. Und kaum waren wir da, ging ’s los: Im ersten Jahr ist der Brecht gestorben, im zweiten Jahr ist der Becher gestorben und im dritten Jahr der Bronnen. Und ich stand da in der DDR mit zwei Kindern, mit einem ganz kleinen zweijährigen und mit meinem neunzehnjährigen Sohn Harald aus erster Ehe. Das war in diesem Haus hier, aber es sah natürlich alles ganz anders aus und rundherum die Ruinen und die Trümmer. (…) Nach dem Tod vom Bronnen ging gleich die Leichenfledderei los. Benommen haben sie sich alle: katastrophal! Der war kaum unter der Erde, da hat mich zum Beispiel die Weigel anrufen lassen und mich eingeladen, sie würde mich gern sprechen. Ich bin dann hin zu ihr, weil ich gedacht hab, sie will vielleicht irgendwas für mich tun. Sie war ganz charmant, ganz Wienerin, hat gesagt, wie leid ihr alles tut: „Ja, was machst denn jetzt?“ – „Ich weiß noch nicht.“ Ich hab ’s wirklich nicht gewusst. Ich hab gedacht, vielleicht will die Weigel ja ein Stück vom Bronnen rausbringen oder so. Und dann hat sie gesagt: „Du, gell, aber die Briefe vom Bert, die gibst ‚ mir.“ Darum ist es ihr gegangen. Dann ist noch die Frau vom Wolfgang Heinz, dem Regisseur, vorbeigekommen, da hab ich wieder gedacht, es geht ums Theater. Mit der war ich per Sie, nicht per Du, die hat gesagt: „Frau Bronnen, Sie werden ja jetzt wahrscheinlich nicht hier bleiben, wollen Sie uns nicht das Haus überlassen?“ Da hat ’s mir gereicht! Ich hab gedacht: “Ihr Miststücke!“ – Danach hab ich gewusst, welche Stellung ich hier hab, an wen ich mich halten muss und wie ich ’s machen muss. Dann hat die Presse im Westen den Bronnen in den Schmutz gezogen, ich bin aus dem Staunen nicht mehr raus gekommen. Aber ich hab ein glückliches Naturell, ich bin ja Österreicherin. Ich hab schaun müssen, wie ich überlebe und dass meine Kinder eine gesicherte Existenz haben. Die Brecht-Briefe hab ich übrigens zehn Jahre später für gutes Geld an die Staatsbibliothek in München verkauft. (lacht) (…)
Bei der „bevorzugten Intelligenz“ – Wohnen in der Künstlersiedlung
Und Sie sind trotz der schwierigen Umstände in Ost-Berlin geblieben?
Sie, ich leb jedes Jahr für mehrere Monate in Österreich. Das hab ich damals auch schon so gemacht. Sowie der Andi Ferien gehabt hat, waren wir in Österreich, im Sommer immer. Und wissen Sie, vor allem meine Freundschaften mit Frauen haben ein Leben lang gehalten, besonders mit zwei Frauen, die beide in Österreich gelebt haben. Leider sind beide inzwischen tot. Aber mit denen hab ich viel Zeit verbracht, meistens im Sommer und in sehr angenehmer Atmosphäre – also, für die Armut hab ich gar nichts über …
War das für Sie auch eine Flucht auf Zeit aus einer Gesellschaft, die nicht so viel …
Naja, die Gesellschaft, in der ich hier gelebt hab, war ja auch nicht gerade arm. Aber vor allen Dingen waren die Leute hier hochintellektuell und sehr interessant. Die Leute, mit denen ich in Österreich zu tun hatte, waren zwar auch nicht dumm, waren auch Intellektuelle, waren vor allem aber sehr gut situiert. Das waren eben meine zwei Welten. Dort gab es das gute Essen, das Trinken, die Feste, den Ball, das Feiern, die Partys – und hier war eben die andere, die geistige Welt. Diese Welt hier hat mich fasziniert, aber meine Wurzeln waren halt in Österreich – dort hab ich eigentlich immer meine Kraft für hier bezogen. (…) Aber ich war dann hier auch materiell abgesichert, weil ich über das Kulturministerium, das hat der Abusch in die Wege geleitet, der Klaus Gysi war damals Kulturminister, eine Ehrenpension bekommen hab.
Sie waren privilegiert, weil sie kommen und gehen konnten, wie Sie wollten …
Nur unter diesen Umständen bin ich in Berlin geblieben. Ich bin einmal in der Woche nach West-Berlin gefahren – sonst hätte ich das nicht ausgehalten.
Eine Luxus-Situation.
Ja, absolut. Aber ich muss Ihnen sagen: Ich hab auch hier in dieser Siedlung ohnehin immer unter Privilegierten gelebt. Und ich hab auch hier so ziemlich alles gekriegt, weil ich alle bestochen hab. Ich hab ungarische Salami oder Schokolade mitgebracht und hab dann den Verkäuferinnen unterm Ladentisch ein Stück Schokolade gegeben und die haben mir dann was Besseres gegeben. (…)
Am Telefon haben Sie zu mir gesagt, Sie leben in einer Siedlung, die „für die bevorzugte Intelligenz“ reserviert war …
Ja, darüber hätte ich lachen können. Die meisten Intellektuellen haben ja ursprünglich in West-Berlin gewohnt. Und der Becher wollte die aber in den Osten bringen. Damals war ja bereits die Trennung abzusehen, wobei die Mauer niemand vorhersehen konnte. Also, man konnte noch hin und her fahren ohne Schwierigkeiten. Ich konnte es auch später, weil ich einen österreichischen Pass hatte. Auch der Busch hat ja ursprünglich in West-Berlin gewohnt. Jedenfalls hat man dann den Leuten, den Intellektuellen, die aus der Emigration zurückgekommen sind, hier Villen zur Verfügung gestellt. Da waren zum Beispiel der Kritiker Fritz Erpenbeck, der mit Ulbricht in der Emigration war, und seine Frau, die Schriftstellerin Hedda Zinner, Tochter von einem reichen Wiener Möbelfabrikanten. Das waren überzeugte Kommunisten, die ’35 nach Moskau gegangen sind. Nach denen sind heute hier die Straßen benannt, und früher haben die hier um die Ecke gelebt. (…) Früher hieß meine Straße übrigens Straße 100. Die wurde ja erst gebaut, als sie die Häuser hier gebaut haben. Vor 90 Jahren war das alles hier Wald und Wiese, nur Sand und Föhren.
Hat die Siedlung einen regelrechten Namen gehabt?
Nein. Ich weiß nicht, wer das Wort aufgebracht hat von der Siedlung für die bevorzugte Intelligenz. Aber das war kein offizieller Name. Hier lebten eben Ärzte, Wissenschaftler und Künstler. Zum Beispiel hat auch der DDR-Bildhauer Kremer hier gewohnt, seine Frau wohnt heute noch in dem Haus. Und weiter drüben war die Weinert-Siedlung, die hieß so, weil da der Weinert gewohnt hat, auf der anderen Seite war das sogenannte Städtchen, wo die Politiker gewohnt haben: der Becher, der Ulbricht und so weiter.
War man auf du und du mit diesen Leuten?
Zu mir hat niemand „du“ gesagt, und ich hab auch zu niemandem „du“ gesagt. Ich hab zum Becher „Herr Minister“ gesagt, und er hat zu mir „Frau Bronnen“ gesagt oder „gnädige Frau“, das weiß ich nicht mehr, das ist ja ganz wurscht … (…)
Sie haben sich offenbar schnell zurecht gefunden in dieser „geistigen Welt“, wie Sie es nennen. Sie haben in Künstlerkreisen verkehrt, haben viele Prominente getroffen …
Am Anfang war ich natürlich unsicher, aber bald hab ich gewusst, wie alles funktioniert. Wissen Sie, es läuft eigentlich mit allen Intellektuellen auf der Welt überall gleich: Sie sind alle irgendwo machtbesessen und irgendwo alle a bissl feig. Keine Helden. Sie sind liebenswert, weil sie Künstler sind und weil sie geistreich sind. Aber ich glaub, die Kunst des Lebens ist: Man darf die Mitmenschen nicht zu ernst nehmen.
Wollen die aber nicht ernst genommen werden, diese Intellektuellen?
Ja, ja, das muss man ihnen vortäuschen. Man muss ihnen sagen: „Du bist der Größte! Gar nicht dran zu zweifeln!“ Der Busch hat sich das natürlich auch gern gefallen lassen. Auch wenn er kein Intellektueller war, sondern ein proletarischer Künstler. Aber diese kleine Gruppe von zurückgekehrten Künstlern und Intellektuellen, die in den 50er Jahren hier lebten, die haben sich untereinander auch gebraucht. Es war eigentlich eine Enklave, und Privilegien gehörten auch dazu, weil der Staat die Leute ja bei Laune halten wollte.
Krimsekt und Kaviar: Die erste Begegnung mit Busch
Wie haben Sie nun Ernst Busch kennen gelernt?
Das war nach einer Tucholsky-Matinee. Der Busch hat Lieder gesungen und der Hanns Eisler hat ihn am Klavier begleitet. Und ich war hingerissen! So was hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Erstens hat er eine phantastische Stimme gehabt, und zweitens waren diese Tucholsky-Songs, das waren ja keine Lieder in dem Sinn, das waren ja richtig revolutionäre Songs, phänomenal. Also, ich war wie vom Schlag gerührt, es war faszinierend! Und im Anschluss an die Matinee sind wir dann gemeinsam zum Mittagessen gegangen. Ich glaub, damals war noch der Becher dabei, genau kann ich mich nicht erinnern, vielleicht ist auch der Langhoff mit …, also jedenfalls war der Eisler mit, der Busch war mit und eine Menge von den damaligen prominenten Künstlern. Und damals, 1957, gab ’s zum Essen gehen und auch zum Wohnen in Ost-Berlin eigentlich nur das Hotel Newa.
(Ende der ersten Kassettenseite)
Newa war ein Hotel für repräsentative Zwecke besonders auch für Gäste des Kulturministeriums, der Leonard Frank ist dort abgestiegen und all diese Leute. Und dort war unten ein großes Restaurant, da sind wir dann oft zum Essen hin gegangen. Da gab ’s relativ gut zu essen. Und da bin ich wahrscheinlich an diesem Tag mit dem Bronnen, dem Busch und dem Eisler zum ersten Mal dort reingegangen nach der Matinee. Es gab Krimsekt, es gab russischen Kaviar. Große Tafel, und neben mir saß der Busch. Und wie wir dann dort Kaviar gegessen und Krimsekt getrunken haben, sag ich zum Busch: (mit schüchterner Stimme) „Also, ich muss ihnen sagen, ich hab mir das alles gar nicht so vorgestellt.“ – (laut und dröhnend, betont norddeutsch) „Ja, Mädchen, was hast du denn gedacht? Wir wollten doch nicht den Reichtum abschaffen, sondern die Armut!“ Das war der Busch. Das ist ganz typisch für ihn gewesen. Ich hör ihn heute noch: „Ja, Mädchen …“ (…) Busch hat von sich immer gesagt: „Ich bin eine Kieler Sprotte!“ Er war ja aus Kiel gebürtig, und genau so war er. Er war nicht sehr groß, aber er wirkte alles andere als klein. Er hatte so was Stacheliges, so was Aufbegehrendes und so was Gegen-alles-sein. Also, das war der Busch. Und ich muss ihnen sagen, am genialsten war es, ihn live bei ihm zu Hause zu erleben. Ich war ja zeitweise fast jeden Tag mit ihm zusammen. Wir haben uns immer in der Heide getroffen zum Spazierengehen und dann hat er gesagt: “Komm jetzt mal mit, ich muss dir was vorsingen!“
Kannten Sie Busch schon vor dieser Matinee durch Radio oder Schallplatten?
Nein, nie gehört. Ich hab ihn bei der Matinee zum ersten Mal gesehen und gehört. Und war fasziniert. Dann hab ich ihn gesehen im Theater im „Kaukasischen Kreidekreis“. Da singt er ja auch, der Brecht hat ihm ja überall Songs hineingeschrieben, da war er ja unerreicht. Also, ich war sprachlos! So was von Schauspielerei und so was von Songs und so was von modernem Theater!
Können Sie erklären, was für Sie das Besondere war an seiner Art zu spielen?
Es war ohne Pathos. Das war für mich neu. Wissen Sie, ich hab im Burgtheater die größten Schauspieler gesehen, aber das war eine ganz andere Art, Theater zu spielen. Da gab es die großen Gesten und den Werner Krauss und den Emil Jannings und die ganzen Klassiker und das große Pathos … Und dann sah ich auf einmal den Busch im „Kreidekreis“ … Das war einzigartig!
„Österreicherin, setz dich nieder und hör zu!“: Busch mit der Klampfe
Hat er Sie mehr als Sänger oder als Schauspieler beeindruckt?
Als Sänger wie als Schauspieler. Er war auch ein großartiger Schauspieler. Aber am allerbesten war er zu Haus, wenn er seine Klampfen genommen hat, wie er immer gesagt hat, er konnte eh nicht spielen, und irgendein Brechtgedicht, das der Eisler gar nicht vertont hatte, gesungen hat, das er selbst irgendwie vertont hatte. „Österreicherin, setz dich nieder und hör jetzt mal zu!“ Er hat natürlich auch rumgebrüllt mit mir wie mit allen, ich hab mich ja auch einschüchtern lassen. (lacht) Er hat dann gesagt: „Hör mal zu! Wie gefällt dir das?“ Und er hat genau gewusst, dass ich hingerissen war von ihm. Ich muss Ihnen aber sagen: Ich hab nie mit dem Busch a Banscherl gehabt, nie mit ihm ein Verhältnis gehabt. Das wäre mir zu weit gegangen. Dazu war er mir zu verrückt.
Aber Sie meinen, das wär durchaus drin gewesen?
Ja, ja, das wär durchaus drin gewesen.
Hat er geflirtet mit Ihnen?
Ja, ja. Ich hab auch mit ihm geflirtet. Den Flirt haben wir gar nicht ausgeschlossen. Aber eine Bindung, das hätte ich nicht riskiert.
Warum?
Weil er ein Verrückter war, ein Besessener.
Gebunden war er ja, wenn auch nicht verheiratet …
Verheiratet war er nicht. Seine damalige Lebensgefährtin, die Tete, die Margarete Körting, hab ich auch gut gekannt. Sie ist aber dann bald gestorben. Wissen Sie, der Busch war ungeheuer brutal und gemein – deswegen war er wahrscheinlich auch als Künstler so hervorragend. Und ein Egozentriker, alle Künstler sind Egozentriker, aber so einen wie den Busch hab ich nie mehr getroffen.
„So geht man nicht um mit einer Frau“ – Busch und Tete
Sie sagen, er war gemein. Meinen Sie, besonders zur Tete?
Ja, ja, zur Tete.
Weil er sie betrogen hat?
Ach was, Betrügen ist ja nix Gemeines. Beschimpft und schlecht behandelt als Frau hat er sie.
Wie äußerte sich das?
Wie das ist, wenn man einen Menschen schlecht behandelt: (aufbrausend) „Du dusslige Kuh!“, „Was verstehst du schon!“, „Halt den Mund!“, „Das weißt du nicht!“ – so ging das. Wenn sie dann irgendwas gesagt hat, das wär doch so und so, dann hat er sie bloßgestellt und noch mehr rumgebrüllt. Er hat ununterbrochen mit ihr herumgeschrien. Wir waren alle darüber entsetzt. Denn so geht man nicht um mit einer Frau. Wir sind dann alle auf und davon gerannt, denn erstens konnte sich das keiner anhören und zweitens konntest du ja zum Busch nicht sagen: „Sag mal, was fällt dir denn ein!“
Waren Sie auf Tetes Beerdigung?
Nein, ich glaub, da war ich grad in Österreich. (…)
Busch ist auch nicht da gewesen.
Das passt zu ihm. So war er. Wissen Sie, wirklich geliebt hat er nur seine erste Frau, die Eva. Die hat er auch bewundert.
Hat er öfter von der gesprochen?
Ja. Da fällt mir eine Geschichte ein: Ein ehemaliger SS-Offizier aus Österreich, mit dem ich befreundet war, der war damals im Krieg in Paris stationiert. Und der hat mich, wie ich dann in Österreich vom Ernst Busch erzählt hab, gefragt: „Ist der verheiratet?“ Sag ich: „Der war mal verheiratet, glaub ich, mit einer Eva.“ Da hat er gesagt: „Du, das war diese hervorragende Kabarettistin und Sängerin, die ich in den Offiziers-Casinos in Paris gehört hab!“ Naja, die musste auch irgendwie ihr Leben retten… Busch hat sie ja auch später immer wieder getroffen. Aber er hat sie gehasst, weil sie ihn damals verlassen hatte.
Die Initiative bei der Trennung ging von ihr aus?
Ja, sie hat ihn verlassen. Sie ist ja auch vor ihm in die Emigration gegangen, sie haben dann zwar wieder zusammengefunden, aber es hat eben nicht gehalten. So wie er von ihr geredet hat und wie er getan hat, hab ich den Eindruck gehabt: Sie ist gegangen. Und ich hab mir gedacht: Das kann ich mir gut vorstellen, mit so einem Wahnsinnigen kannst ja nicht leben! Ein genialer Künstler, aber als Mensch ein totaler Chaot!
„Dort ist die Tür! Raus!“: Empfehlungen von Gerhart Eisler
Andere, mit denen ich gesprochen habe, sagen, er sei sehr umgänglich gewesen …
Ja, vielleicht gegenüber Leuten, die er nicht gut gekannt hat. (lacht) Er war brutal bis zum Gehtnichtmehr. Du musstest alles mit ihm aushalten, und du musstest alles für ihn tun! Ich war auch befreundet mit dem Eisler, vor allem mit dem Gerhart Eisler, der ja beim Rundfunk gearbeitet hat. Und Busch hatte gerade Lieder aufgenommen und hat sie mir vorgespielt, ich war ja jeden Nachmittag bei ihm. Er hat mich wahrscheinlich auch gebraucht als Publikum, weil ich natürlich, nicht von allem, aber von fast allem fasziniert war. Ich bin einfach da gesessen und hab ihn bewundert und angestaunt. (…) Wenn wir unter vier Augen waren, hat er auf der Klampfe irgendwelche Texte von Brecht gesungen, und wenn ich gefragt hab: „Is das vom Eisler?“, dann kam: „Ach Quatsch! Is doch von mir!“ – Ich glaube, er mochte mich auch deshalb, weil ich ein völlig unbeschriebenes Blatt war, ich hab ja von nix was gewusst. Mir fehlten die ganzen Zusammenhänge. Jedenfalls hat er damals Songs im Studio aufgenommen, und da war auch das Lied vom jüdischen Friedhof in Weißensee dabei. Und ich hab zu dieser Zeit viel Kontakt zum Gerhart Eisler gehabt, der hat ja auch um die Ecke gewohnt hier in Niederschönhausen. Bei irgendeinem Treffen hat er zu mir gesagt: „Du, was macht ’n der Ernst?“ Sag ich: „Du, der nimmt jetzt die und die Songs auf, unter anderm auch das Lied vom jüdischen Friedhof.“ Und da hat der Gerhart zu mir gesagt: „Sag doch bitte dem Ernst, das soll er raus lassen.“ Es war damals die Ulbricht-Zeit, wo dieses Thema nicht so ideal war, die Russen hatten ja auch mal die Juden verfolgt … Und ich geh frisch und fröhlich, frank und frei zum Ernst und sag: (flötet) „Du, schönen Gruß vom Gerhart, ich soll dir sagen …“ – (brüllt) – „Dort ist die Tür! Raus mit dir! Raus!“ Ich hab überhaupt nicht gewusst, was los ist. Sag ich: „Was is denn, was hast ’n?“ – (brüllt) „Wenn du zu dem hältst, dann raus!“ Also, nur damit Sie einen Eindruck bekommen, wie Ernst Busch war. Sie können sich vielleicht vorstellen, warum ich mich nicht näher mit ihm eingelassen hab. Sie, der hat jede vernichtet. Den konnten Sie nur am ausgestreckten Arm ertragen.
Hat er Verhältnisse mit anderen Frauen gepflegt?
Von „gepflegt“ kann überhaupt nicht die Rede sein. Naa, naa. Eines Tages war ich bei ihm und wollte kurz darauf wieder mal nach Österreich fahren. Da sagt er: „Musst du dahin fahren?“ Hab ich gesagt: „Ja, ich muss!“ – „Fährst du hin wegen einem Kerl?“ Hab ich gesagt: „Auch.“ Ich hatte damals einen österreichischen Freund, einen Arzt …
Hat er Ihnen das übel genommen?
Naja, er hat nicht übel genommen, dass ich mit einem andern ins Bett ging. Das glaub ich nicht, so scharf war er aufs Bett gar nicht. Sondern er hat mir übel genommen, dass ich an jemand anderen eine stärkere Bindung hatte als an ihn. Weil wir uns ja täglich gesehen haben, und er mir alles vorgespielt hat. (…)
Hat das für Busch eine Rolle gespielt, dass Sie mit Arnolt Bronnen verheiratet gewesen waren?
Nein, die haben sich zwar gekannt, der Bronnen und ich waren auch mal beim Busch und bei der Tete. Aber dann ist ja der Bronnen gestorben und bald darauf auch die Tete.
Haben Sie Margarete Körting eigentlich bemitleidet?
Sehr. Die hat mir leid getan. Die Steffi Eisler, mit der ich auch sehr befreundet war, die auch Österreicherin war und die leider vor zwei Jahren gestorben ist, beste Freundin … wir haben beide gesagt: „Dass die Tete sich das gefallen lässt! Wir würden ihn erwürgen!“
Warum hat sie sich das gefallen lassen?
(leise) Sie hat ihn sehr geliebt und … war keine so gute Schauspielerin. Sie hat sich wahrscheinlich in seinem Licht irgendwie … Er hat sie aber nie geheiratet. Das hätte sie gerne gewollt. Er hat sie begraben lassen, als hätte er mit ihr nichts zu tun gehabt, als Margarete Körting … Da haben wir gesagt: „Ja, und was ist mit dir?“ – Da hat er gesagt: „Ich hab sie zu ihrem Mann gelegt. Sie war doch mit dem Körting verheiratet!“ Er hat sie also neben ihrem ersten Mann begraben lassen, sie war ja verheiratet gewesen mit einem Schauspieler namens Körting. (…)Kinder hatte sie keine, aber Hunde waren immer da, zwei Pekinesen.
„Nicht spröde, sondern knalltrocken!“ – Norddeutscher Charakter
Mochte Busch die Hunde?
Ja, ja. Ich will Ihnen was sagen: Der Busch war eine Kieler Sprotte, wie er immer gesagt hat, und er war ein Proletarier im besten Sinn des Wortes. Und er war stolz drauf, er war ja Werftarbeiter, Schlosser. Er hat meinem Sohn Andreas, ich glaub: zum siebten Geburtstag, eine Werkzeugtasche geschenkt. Er hat ja gewusst, dass ich zwei linke Hände hab. Ich versteh nichts von Werkzeug. Und Busch: „Mensch Junge, damit mal was wird aus dir!“ Die Tasche hat der Andi heut noch. Und dann war er halt ein Norddeutscher, ein Kieler – die sind an sich für uns Österreicher schwieriger …
Ist „spröde“ das richtige Wort?
„Spröde“ ist gar kein Ausdruck! Knalltrocken würde ich sagen.
Wie würden Sie ihn noch beschreiben?
Er war sehr humorvoll, intelligent, hochintelligent obwohl ungebildet. Überzeugter Kommunist, aber im besten Sinn des Wortes – also nicht das, was die aus dem Kommunismus dann gemacht haben. Ihm ging es um die Idee der Freiheit und darum, dass es den Menschen allen gleich gut gehen soll. Ein hehrer Kommunist.
Warum wirkte diese Mischung auf Frauen?
Warum das auf Frauen gewirkt hat? (…) Auf Frauen hat er deshalb gewirkt, weil er überhaupt nicht hinter den Weibern her war, weil er sich kühl und distanziert gegeben hat. Und das reizt natürlich jede. Genau wie jeden Mann eine kühle Frau interessiert, so reizt das umgekehrt jede Frau: „Warum ist denn der so kühl? Wieso komm ich denn da nicht an? Was ist denn da los? Da stimmt doch was nicht, was hat er denn?“ – Das ist es. Sag ich jetzt als Frau. (…) Andrerseits muss ich sagen: Er hat eigentlich so im privaten Umgang keine sehr starke sexuelle Ausstrahlung gehabt. Darüber bin ich mir auch mit der Steffi Eisler einig gewesen. Wissen Sie, der Busch hat, wenn er gesungen hat, einen ungeheuren Charme gehabt. Aber als Mensch …
„Er war einmalig als Sänger!“ – Faszination und Erotik der Stimme
War es vor allem die Stimme, die faszinierte?
Ja, die Stimme war es. Er hatte eine ausgesprochen erotische Stimme. Aber auch seine Ausstrahlung auf der Bühne war eine sehr erotische. Aber als Mann, wenn wir uns gegenüber saßen … Für mich war er ein Insel-Mann: Mit dem hätte ich auf einer einsamen Insel leben können, und es wär nix passiert. Er war ja auch nicht so ein Eroberer- oder Draufgängertyp, der die Weiber reihenweise an sich gerissen hat. Ich sag Ihnen: Die einzige, die er wirklich geliebt hat und die er immer geliebt hat, war die Eva. Die ihn verlassen hatte. Trotzdem muss ich sagen: Wenn er gesungen hat, dann hat er eine ungeheure sexuelle Ausstrahlung gehabt!
Erinnern Sie sich noch, wie Buschs Beziehung mit Irene Ullrich anfing?
Zu mir hat er gesagt: „Die hat mir doch die Weigel ins Haus geschickt.“ Die Irene war doch Sekretärin von der Weigel. Und die Weigel hat natürlich gewusst, dass der Ernst … also, in … na, was heißt: schlamperten Verhältnissen gelebt hat, gar nicht, aber halt allein war … Aber wie gesagt, wir haben uns jeden Tag gesehen. Abends hat er dann gesagt: (lautstark) „Was gehst ‚ denn nach Haus? Bleib hier! Kannst doch hier schlafen, der Andi auch!“ – „Naa, ich muss unbedingt nach Haus, der Andi muss ja auch in der Früh versorgt werden …“ Der ging ja noch gar nicht zur Schule …
Bei Ihnen hat er seine Zurückhaltung offenbar aufgegeben …
Ja, ja, durchaus.
Sind Sie bei ihm einfach vorbeigekommen oder haben Sie sich verabredet?
Er hat ins Telefon gebrüllt: „Ich geh jetzt weg!“ Dann wusste ich, er ist in der Dings-Siedlung in die Heide gegangen, und ich musste dann hier alles stehen und liegen lassen, damit wir uns auf halber Strecke in der Heide treffen. Und da hat er dann oft gesagt: „Jetzt kommste mit!“ – Und zu Hause hat er mir Musik vorgespielt. Ich hab mir seine Platten angehört, er hat mir mit der Klampfe irgendwelche Texte vorgesungen, hat irgendwas improvisiert, er war einmalig als Sänger, hinreißend als Künstler. Hinreißend! Im Gegensatz zum Brecht, der mir als Mann überhaupt nicht gefallen hat. Aber Busch war hinreißend. Nur hab ich gottseidank mit einigermaßen Erfahrung gewusst: „Meine Liebe, das kommt nicht in Frage!“ (…)
„Er war hundertprozentig für die Sache!“ – Busch und die Politik
Hat Busch Ihnen gegenüber sich auch politisch geäußert?
Ja, das hat er getan. Er hat sich natürlich einen anderen Kommunismus vorgestellt, als die ihn gemacht haben. Schauen Sie sich doch den Ulbricht an, das ist natürlich zum Busch ein Antityp allein schon von der Stimme her, vom Aussehen her. Mit dem hatte er Riesenschwierigkeiten. Der Busch war ja sehr fortschrittlich und wollte alle möglichen Sachen im Sozialismus machen. Er hat mir auch manchmal Geschichten von früher erzählt aus der Emigration, und das war für ihn reizvoll, weil ich darüber nichts wusste. (…) Als dann nach dem Becher der Abusch Kulturminister wurde, wurde es manchmal schwierig. Busch hat den Abusch gehasst, der Abusch war aber mit mir sehr nett und freundlich, der hat auch in Niederschönhausen gewohnt. Aber wenn der Busch und ich beim Spaziergang den Abusch von weitem gesehen haben, hat der Busch gesagt: „Komm, wir gehen auf die andere Straßenseite!“ (…)
Wie ist Busch mit der Situation umgegangen, dass er all diese Leute, Becher und viele andere Politiker, persönlich von früher kannte? Ich meine, das waren ja nun Autoritäten, die den Staat vertraten …
Naa, naa. Für Busch hat ’s keine Autorität gegeben. Er war sich selbst der Oberste. Und er hat zu allen eine gewisse Distanz gehalten.
Er wurde doch auch eingebunden von …
Nein, er hat sich nicht einbinden lassen. Von nichts und niemand.
Er hat ja nicht nur große Literatur rezitiert und gesungen. Er hat auch die Partei besungen und Stalin. Da hat er sich schon einbinden lassen.
Na gut, er war ja ursprünglich der Barrikaden-Tauber. Das war dann die Konsequenz daraus. Den Stalin haben sie ja alle besungen. Das musste man, wenn man dazu gehörte. Drum war er ja dann so sauer, drum war er ja so stachelig, drum war er ja so schwierig – weil ihm das alles nicht gepasst hat und weil er gesehen hat, dass das alles wieder eine Diktatur wird.
Hat er das gesagt, dass ihm das alles nicht passt?
Ich weiß das aus seinen Äußerungen zu Liedern, zu Theaterstücken oder zu kulturellen Vorgängen. Da hat er sich so geäußert, dass klar war, dass ihm diese Art von Kommunismus oder Sozialismus – nennen Sie ’s, wie Sie wollen, nicht passt, dass er sich das anders vorgestellt hatte. (…) Aber in der Zeit, als der Stalin besungen wurde, das können Sie heute nicht mehr verstehen, war auch das echt und ehrlich – genau wie die Spanienlieder. Man wär ja als Verräter an der Sache abgestempelt worden, wenn man da nicht mitgemacht hätte. Busch, als jemand, der hundertprozentig für die Sache war, hat gar keine andere Chance gehabt.
Welchen Einfluss hatte Irene Busch auf ihn?
Die Irene war, so weit ich weiß, eine Vertriebene, ein Flüchtling. Ich glaube, ihr erster Mann war Wehrmachtsoffizier und ist im Krieg gefallen. (…) Sie war dann am Berliner Ensemble, wo sie mit einem bekannten Schauspieler liiert war. (…) Ob sie Busch irgendwie beeinflusst hat, weiß ich nicht.
Sie haben vorhin gesagt, dass er einen faszinierte, wenn er sang. Inwiefern haben die explizit politischen Texte, die er sang, zu der Faszination beigetragen oder sie getrübt?
Das gehörte einfach zusammen: Busch und politische Texte. Der Busch war überzeugter Kommunist. Der Busch war überzeugt davon, dass man den Menschen helfen muss. Beinahe wie eine Art Messias: Er wollte jedem helfen, es sollte jedem gut gehen. Dadurch, dass er selbst aus der Arbeiterschicht kam und dann zu Wohlstand gekommen war, wollte er jeden zu sich heraufziehen. Das war glaubwürdig, das hat man ihm abgenommen. Und der Busch hat seinen Kommunismus durchgehalten bis zuletzt. (…) Wie hieß noch mal sein russischer Freund?
Überartikulierte Aussprache: Buschs Gesichtslähmung
Schneerson. Grigori Schneerson.
Schneerson, genau. Bezaubernder Mann. „Du, der Schneerson ist da, komm vorbei und bring ’n Sekt mit!“ – „Ja, natürlich, bin gleich da!“ – Dann bin ich rüber, das sind immer schöne Abende gewesen. (…) Die beiden kannten sich ja noch aus der Zeit vor dem Krieg und hatten Lieder zusammen gemacht. (…) Ich vermute, dass er damals, vor dem Krieg, auch anders gewesen ist. Ich hab ihn ja erst später kennen gelernt. Durch diese Kopfverletzung, die halbseitige Lähmung, die ihn ja sehr gehandicapt hat und durch die er sich auch als Schauspieler eingeschränkt gefühlt hat, ist er wohl auch schwieriger geworden. Diese Verletzung war, würd ich sagen, das, was ihn am schwersten getroffen hat in seinem Leben.
War diese Lähmung sichtbar? Hat man beim Reden gemerkt, dass er beeinträchtigt war?
Nein, nicht direkt. Man hat ja in einem Sanatorium in Moskau viel versucht, den Zustand zu verbessern. Aber die eine Seite war fast gelähmt. Und trotzdem hat er das, vor allem auch durch Training, einigermaßen in den Griff bekommen. Drum hat er auch diese überartikulierte Aussprache gehabt, musste er ja. Weil er immer das Gefühl gehabt hat, er sei nicht präzise genug, man verstünde ihn nicht durch seine Lähmung. Also, wenn er unter etwas gelitten hat, dann darunter. (…) Er hat aber meistens versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Und er war dann auch humorvoll oder sarkastisch. Einmal am ersten Mai hatte ich eine rote Fahne rausgehängt. Verstehen Sie: Ich – Österreicherin und Nicht-Kommunistin – seh, dass alles rot beflaggt ist, Jessas Maria, häng schnell auch eine Fahne raus. Ist der Busch mit irgendeinem Kommunisten vorbeigekommen, steht vor der Haustür und schreit: „Mensch, das sieht ja aus wie ’n Bahnwärterhäuschen!“ Sag ich: „Soll ich ’s wieder reintun?“ – „Nee, lass mal hängen.“ (lacht) Also, er war schon sehr treffend und sarkastisch. Konnte auch böse sein, aber zu mir, muss ich sagen, war er das nicht. (…) Ich bin überhaupt keine ängstliche Person, aber der Busch war vielleicht der einzige Mann, den ich kannte, der …, nicht direkt unheimlich, aber mir als Mensch unberechenbar erschien.
„Menschlicher Defekt“ – Jähzorn und Rechthaberei
War er jähzornig?
Ja, das war er. Ich hab ja oft erlebt, wie er sich der Tete gegenüber benommen hat. Er hat sie angebrüllt, vor allen zur Sau gemacht. Und sie – ein unglückliches Weib, kann ich nur sagen – hat ihm auch immer widersprochen, aber so sind halt die Deutschen. Ich hätt nie zu ihm gesagt: „Du, das stimmt nicht.“ Um Gottes Willen, nie und nimmer hätt ich das gemacht. Da wär er sofort explodiert. Also, alles konnte man beim Busch, nur nicht widersprechen. (…) Die Tete kannte ihn, glaub ich, vom Deutschen Theater und hat sich halt von Anfang an um ihn gekümmert, als er noch in West-Berlin gewohnt hat. Sie hat ihn wahrscheinlich geliebt, verehrt und vor allem bewundert. Der Busch hat das so dargestellt, als wenn sie sich ihm aufgedrängt hätte: (lautstark) „Die ist doch zu mir gekommen! Ich hab sie nicht mehr losgebracht!“ Und als sie gestorben war, sagt er zu mir: „Mensch, jetzt hat sie sogar noch für mich gespart!“ Sie hatte ein Sparbuch angelegt und ihm Geld hinterlassen. Werd ich nie vergessen, wie er das gesagt hat. (…) Ich glaube übrigens, dass er später ein schlechtes Gewissen gehabt hat, weil er die Tete so schlecht behandelt hat. (…) Wissen Sie, jeden Tag spazieren gehen und sich Lieder anhören – wunderbar. Aber so schön, so reich, so gescheit hätte er gar nicht sein können, dass man sich mit dem Busch liiert hätte. Unmöglich! Als Künstler grandios, aber als Mensch kannst ‚ ihn nur erwürgen. „Ich bin ein Prolet!“, hat er immer geschrien. Ich darauf: „Ja, ja.“ (Pause) „Jaaaa!“ – Er dann: “Was?“ Wenn du ihm dann zugestimmt hast, hat er dich angefahren … (…) Wissen Sie, er war nicht direkt gefühlskalt, sonst hätte er die Seeräuberballade nicht so singen können. Aber menschlich hat er einen Defekt gehabt. Vielleicht war er deshalb so ein großer Künstler.
Hugo Fetting hat mir erzählt, dass er dem Busch jede Zeile, die er über ihn schrieb, vorlegen musste. Hat Fetting auch unter Buschs menschlichem Defekt leiden müssen?
Der Fetting! Der lebt noch? Grüßen Sie ihn sehr herzlich von mir! Ja, was glauben Sie, was der Fetting dort zu hören bekommen hat. Aber der hat ein dickes Fell gehabt, so oft wie der Busch den angeschrien hat. Der Fetting und ich haben uns über Jahre lang täglich bei Busch getroffen. Und oft sind wir zusammen weggegangen und haben gesagt: „Jetzt lass‘ mer den Spinner allein, geh‘ mer!“
Erinnern Sie sich an Buschs Begegnungen mit Künstlerkollegen, zum Beispiel mit Paul Dessau?
Um Gottes Willen! Ein einziges Mal war ich dabei. Das muss Ende der 50er gewesen sein. Nach dem Spaziergang sagt er: „Du bleibst heut hier, der Dessau kommt.“ Ich hab den gar nicht gekannt. Ich hab nur gesehen, das ist ein gut aussehender, gut erzogener, sehr netter Mann. Und den hat der Busch vor mir zur Sau gemacht! Mir war das so peinlich. Ich bin dreimal aufgestanden, (schreit) „Du bleibst sitzen!“, dreimal bin ich aufgestanden, so peinlich war mir das. Den hat er so zur Sau gemacht, aber so! Und ich wusste gar nicht warum. Ich kannte ja die ganzen Vorgeschichten nicht. Ich bin ja, als ich mit dem Bronnen nach Berlin kam, wie ein Kind ins Wasser geschmissen worden, und dann hieß es:“Jetzt schwimm!“. Ich konnte ja niemanden fragen, wie das alles zusammenhing. Und warum ich dabei sein musste, als der Busch den Dessau wegen alter Geschichten zusammengebrüllt hat, war mir auch nicht ganz klar. Wahrscheinlich wollte der Busch dem zeigen …, ich weiß es nicht. Der Dessau hat natürlich nichts weiter gewusst von mir, als dass ich die Witwe vom Bronnen bin. Das war eh für alle ein rotes Tuch, eh schlimm genug. Der Bronnen war ja furchtbar in Verschiss, weil man ihm seine politische Vergangenheit übel genommen hat. Man hat auch seine Stücke hier nicht gespielt, gar nix. Vor allem den West-Emigranten hat der Bronnen überhaupt nicht gepasst, weil er mal Antisemit gewesen war, seine erste Frau Olga war ja eine Geliebte vom Goebbels gewesen. (…) Der Becher mochte aber den Bronnen und war ihm dankbar, weil der Bronnen seinerzeit vor ’33 ganz groß im Rundfunk war und den Becher, als es dem nicht gut ging, in seiner Funkstunde lesen ließ. Das hat ihm der Becher nie vergessen.
Boutique Gloria in Ost-Berlin: Kulturministerium und Mode
Dass Sie von diesen Vorgeschichten wenig wussten, scheint Sie nicht weiter gestört zu haben. Oder hatten Sie zunächst Anpassungsschwierigkeiten hier in Berlin?
Ich hab es als Österreicherin natürlich leicht gehabt. Ich hab einfach den österreichischen Schmäh eingesetzt, ich war damals jung und ganz gut aussehend. Alle waren sehr liebenswürdig zu mir. (lacht) Und ich wollte doch damals eine Boutique machen, da waren gerade die Boutiquen aufgekommen im Westen. Ich war mit dem Bronnen in Hamburg beim Rowohlt gewesen und hab die erste Boutique gesehen, die es damals gegeben hat, Gloria hat die geheißen. So etwas wollte ich hier in Ost-Berlin machen und hab das dem Becher im Kulturministerium vorgetragen, der Abusch saß daneben. Der Becher war hellauf begeistert: „Das ist eine großartige Idee! Da weiß ich wenigstens, wo ich die Handtaschen kaufen soll …“ – Für seine Freundin natürlich, nicht für seine Frau! Und dann hab ich mich mit der HO, so hieß das damals: Handelsorganisation, in Verbindung gesetzt. Dann ist aber der Becher gestorben, und alle Pläne wurden platt gemacht, da gab es keine Chance mehr, was zu machen.
Das war zu sehr privatwirtschaftlich gedacht?
Ja, ja. Da haben die gesagt: „Wenn wer das macht, dann macht das die HO!“ Sie können sich ja vorstellen, was das für eine Boutique geworden wäre … (…)
(Exkurs über einen Wutanfall Buschs, bei dem sich Renate Bronnens Sohn Andi vor Schreck unter dem Fernseher versteckt hat – Auslöser war eine Besucherin aus Rumänien, die noch nie etwas von Ernst Busch gehört hatte)
Hatte Busch ein besonders großes Geltungsbedürfnis? Hat er etwa diese Ehrentitel, die man ihm gegeben hatte, selbst benutzt? „Barrikaden-Tauber“ zum Beispiel …
Also, „Barrikaden-Tauber“, das hat ihm schon sehr imponiert. Aber nicht wegen der Barrikade, sondern wegen dem Tauber. Der Richard Tauber war ja ein großartiger Sänger und der Star überhaupt! In meiner Kindheit war der immer und überall zu hören – bis diese blöden Nazis kamen. Tauber war ja Jude.
Glauben Sie, dass der Busch den Tauber geschätzt hat?
Ja, absolut. Ob er Schallplatten von ihm hatte, weiß ich nicht. Er hatte ja nix mehr von früher, er hat ja hier nach dem Krieg bei Null angefangen.
Hat er zu Ihrer Zeit privat überhaupt was anderes gehört als sich selber?
Nein, glaub ich nicht. Und immer ungeheuer laut. Ob er vielleicht doch schlecht gehört hat auf dem einen Ohr? (…)
Haben Sie ein Lieblingslied von Busch?
Die „Ballade von den Seeräubern“. Das war mein Lied! Besonders wenn er ’s zu Hause zur Klampfe gesungen hat. Das war unübertroffen! Da hat er sich ausgelebt: (fängt an zu singen) „O Himmel, strahlender Azur …“ – Ich meine, auch die Spanienlieder waren wichtig und notwendig, die muss man halt aus der Zeit verstehen. Aber die Seeräuberballade hat mir am besten gefallen.
Glauben Sie, dass das auch Buschs Lieblingslied war?
Nein, ich glaube, dass er die Spanienlieder am meisten geliebt hat. Die hat er auch am häufigsten bei sich zu Hause aufgelegt.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie und Busch sich jeden Tag gesehen haben. In welcher Zeit war das und wie lange ging das?
Das ging vielleicht ’58 los und endete Mitte der 60er Jahre. Wann hat er die Irene geheiratet?
1964.
Ja, und da war es ihm nicht mehr so angenehm, wenn ich gekommen bin … Wie soll ich das sagen? Obwohl ich nie, ich schwör ’s Ihnen, mit ihm im Bett war, hatten wir doch eine sehr enge freundschaftliche Beziehung. Ich hatte aber immer einen Freund in Österreich, ich war ja Witwe. Und mit dem Busch hab ich es nicht so weit kommen lassen. Obwohl er nie so auf mich zugegangen wär, dass ich mich hätte wehren müssen, verstehen Sie. Als dann die Irene ins Haus kam, hat er sich von Freundinnen zurückgezogen, mit der Steffi Eisler war er ja auch befreundet, aber nicht so wie mit mir. Ich glaub, in dieser Zeit ist auch die Geschichte mit dem Gerhart Eisler gewesen, wo er mich rausgeschmissen hat, „Geh, da ist die Tür!“ hat er geschrien, das weiß ich noch. Ich meine, die Irene war damals auch dabei und schon schwanger. Und ich glaub, der Harald war auch mit. Da hat der Ernst mich richtig rausgeschmissen. Ich hab dann gesagt: „Ja du, dann geh ich.“ Bin dann aufgestanden und gegangen. Ich hab mir damals gedacht: „Komm, lass den Verrückten, der Ernst spinnt halt mal wieder und so…“ Aber da hat sich unsere Beziehung eigentlich getrennt.
Haben Sie ihn später dann nicht mehr getroffen?
Kaum noch. Er ist dann einfach nicht mehr zu mir gekommen, das ging von ihm aus. Später war er dann völlig verwirrt, er hatte ja Alzheimer, was damals noch nicht so gut erforscht war und worüber man auch nicht selbstverständlich gesprochen hat. Und er hat auch vorher schon starke Gedächtnislücken gehabt, sodass man das vielleicht auch nicht so schnell erkannt hat. Man hat das dann aufs Alter geschoben und seine Verletzung durch die Bomben, die im Gefängnis, wo er war, eingeschlagen sind. (…) Getroffen hab ich ihn dann mal in der Oper, wo ich mit dem Gerhart Eisler gewesen bin, aber das waren eher Zufälle. (…) Dann, in den 70er Jahren, ist er nur mehr zu Hause gesessen und hat seine eigenen Platten gedröhnt, alle Fenster offen, und ganz Niederschönhausen hat die Lieder vom Busch gehört. Er ist dann auch immer weniger öffentlich aufgetreten, er war einfach alt und krank. Und dann hat mir irendwann jemand erzählt: „Du, stell dir vor, der Busch ist bei dir vor dem Haus an der Straßenecke gestanden und hat nicht mehr nach Hause gefunden.“ Das war der Alzheimer. Und da hab ich mir gedacht, dass er vielleicht im Unterbewusstsein den Weg zu mir gegangen ist, den er früher so oft gegangen war. (…) Die Irene hat ihn dann auch öfter suchen lassen, und die Polizei hat dann schon Bescheid gewusst. (…)
In Ihrer Freundschaft mit Busch hat ja Politik keine große Rolle gespielt. Dass er Kommunist war und viele Ihrer anderen Freunde hier auch, hat auf Sie nicht abgefärbt. Oder würden Sie sich als Kommunistin bezeichnen?
Ich? Um Gottes Willen, nie!
Sind Sie links?
Was ist links? Wenn links bedeutet, dass man sich frei und ungebunden fühlt, dann schon. Es gab sogar eine Zeit, da bin ich mit der Mao-Fibel in der Tasche rumgerannt, aber das waren natürlich Einflüsse aus dem Westen …
Haben Sie sich für Politik interessiert?
Nein, eigentlich nicht. Wissen Sie, das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich hab mich mein ganzes Leben vor allem fürs Theater interessiert. Ich bin einfach eine theatralische Person. (…) Politik ist zwar auch irgendwo Theater, aber meistens leider sehr schlechtes. Meine Bühne ist immer das Leben gewesen, und da hab ich viel Theater gespielt, kann ich Ihnen sagen …
Das klingt so, als hätten Sie das alles nie besonders ernst genommen, was hier politisch abgelaufen ist in der DDR …
Ja, aber das gilt auch für das, was früher in Österreich abgelaufen ist. (lacht) Ich hab nur immer geschwiegen, weil ich halt ein Überlebensprofi bin. (…)
Hat Sie das an Busch dann nie gestört, dieses Überzeugte, dieses Wissen, dass diese politische Sache genau das Richtige ist?
Das war eben für ihn das einzig Richtige. Weil er als Proletarier an diese Ideen geglaubt hat. Drum war er ja so gut, weil er mit so viel Überzeugung seine Songs gesungen hat. Er hat an die Sache geglaubt, aber doch nicht an die Leute, die den Sozialismus hier stümperhaft ausgeübt haben. Der Busch war doch ein Edelkommunist. So weit es das gibt. Er hat ja auch überall seine Meinung gesagt – laut und deutlich. Natürlich haben die Funktionäre auch versucht, ihn zu benutzen. Sie haben sich schmücken wollen mit dem großen Ernst Busch. Aber richtig drauf eingelassen hat er sich nicht. (…)
(Am Ende des Gesprächs gemeinsame Unterhaltung mit Renate Bronnen und ihrer Freundin Inge Drinda, die Jahrgang 1928 ist, über den Künstler-Ferienort Ahrenshoop und Urlaube des Ehepaars Drinda ebendort. Auch Busch und Tete seien öfter dabei gewesen, das sei ’53, ’54 gewesen. Tete habe immer das grüne Auto gefahren. Ahrenshoop sei als ehemalige Malerkolonie ein beliebter Treffpunkt „für die bevorzugte Intelligenz“ gewesen. Hier sei man unter seinesgleichen gewesen, sei zum FKK-Strand und ins Kulturhaus gegangen. Busch habe es aber meist vorgezogen, im Wald spazieren zu gehen. Drinda: „Er war kein Partyheld“. Wenn er in Gesellschaft gewesen sei, habe er auch dominieren wollen, sagt Renate Bronnen. Inge Drinda erinnert sich, dass abends in Ahrenshoop damals der „Kreidekreis“ von Brecht besprochen worden sei, der gerade gespielt wurde. Inge Drinda, deren Mann Horst am Deutschen Theater gespielt hat, sagt, sie habe Busch damals sehr bewundert: „Ich fand den toll!“ – Wenngleich er seine Eigenheiten gehabt hätte: „Einmal wollte er ins Deutsche Theater, weil er an dem Abend zu spielen hatte, und da sagte der Pförtner, der war wahrscheinlich neu, er möchte den Personalausweis sehen. Jeder musste ja immer seinen Ausweis parat haben. Da hat der Ernst gesagt: „Schönen Dank!“, und ist wieder nach Hause gefahren. Das ist typisch Ernst Busch. Der dachte, er wird verkohlt. Denn kein Mensch am Deutschen Theater hätte normalerweise gewagt, zu Ernst Busch zu sagen: „Zeig mir mal deinen Ausweis!“ Das Theater war natürlich in heller Aufregung, da wurde dann ein Auto geschickt, damit der Ernst noch zur Vorstellung kommt. Das war praktisch so, als wenn man den Intendanten angehalten und gefragt hätte, was er hier will. Busch hatte das Theater ja maßgeblich geprägt. Er war ja praktisch das Theater.“)
Interview: Jochen Voit
Foto: Johanna G. Bechen
(Textfassung autorisiert von Renate Bronnen am 16. Februar 2006)

Lothar Brümmer
über Ernst Busch-Auftritte bei FDJ- und SED-Veranstaltungen und den besonderen Stellenwert der Spanienlieder in der DDR
„Wenn es bei Parteiversammlungen hieß ’Wat singwa jetz?’, dann kam meist ’Spaniens Himmel’, weil manche andere Lieder gar nicht kannten!“
(Gespräch am 6. September 2004 in Berlin)
Lothar Brümmer ist Jahrgang 1943. Er ist Halbwaise und wächst zunächst in einem Berliner Kinderheim, dann, ab dem sechsten Lebensjahr, bei Pflegeeltern auf. Nach der Schule macht er eine Lehre als Konditor, die er 1961 abschließt. Seit 1958 ist er in der FDJ, 1961 tritt er in die SED ein. Da er in dem von ihm erlernten Beruf keine Anstellung findet, schlägt er die Funktionärslaufbahn bei der FDJ ein. Hier hat er bei verschiedenen Kulturveranstaltungen Gelegenheit, bedeutende Künstler, darunter auch Ernst Busch, live auf der Bühne zu erleben. Bis 1971 arbeitet er als hauptamtlicher FDJler und leistet in dieser Zeit auch drei Jahre Dienst bei der NVA. Nachträglich absolviert er an der Volkshochschule die 10. Klasse, um sich für ein Studium bewerben zu können. Er geht ans Industrie-Institut der TU Dresden und erwirbt den akademischen Grad eines Diplom-Ingenieur-Ökonomen. Anschließend wir er in den Apparat der SED in Berlin übernommen, wo er bis 1989 unter anderem in den Bereichen Jugend und Sport, Industrie, Organisation, Personal- und Wohnungswesen arbeitet. Seit 1990 ist er in wechselnden Arbeitsverhältnissen tätig. Heute ist er Rentner und nebenbei als Vermögensberater aktiv.
Jochen Voit: Woher und seit wann ist Ihnen Ernst Busch ein Begriff?
Lothar Brümmer: Ich kenne ja Ernst Busch sozusagen aus zwei Dimensionen: einmal aus dem Theater – wobei er ziemlich genau zu der Zeit, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, seinen Abschied von der Bühne nahm; und zweitens und hauptsächlich als Sänger – da lernte ich ihn vor allem aus der Konserve kennen, sprich: über Radio. Und weil ich eben dem linken Spektrum verbunden war und immer noch bin, war und ist Busch für mich ein Beleg für diese These, oder Hypothese besser gesagt, die heißt: „Kunst ist eine Waffe!“ Oder wenn man das ’n bissl relativiert oder einen anderen Terminus benutzt: „Liedgut eignet sich zur Agitation!“ Bei ihm waren ja Text und Interpretationsart absolut im Gleichlauf. Wenn ich da denke an „Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist!“, das war ja ein Aufruf, und das sang er auch so, als konkrete Aufforderung.
Ist das der Text, den Sie in Ihrer Erinnerung als erstes mit Busch verbinden?
Nein. Wenn Sie so konkret fragen, muss ich sagen: Busch ist und bleibt für mich zuallererst Spanienkämpfer. Eigentlich ist „Spanienkämpfer“ ja übertrieben, denn er hat ja nicht mit der Waffe gekämpft, sondern hat eben auch dort Agitation und Kultur gemacht und natürlich „Spaniens Himmel breitet seine Sterne“.
War dies das erste Lied, das Sie von ihm wahrgenommen haben?
Denke ich. Das ist zumindest von der Emotion her als eines der ersten gespeichert.
Wann war das, als sie ihn zum ersten Mal gehört haben?
Mit Sicherheit Ende der 50er Jahre, hauptsächlich aber in den 60er Jahren. Da habe ich ihn im Radio gehört und auch live bei großen Veranstaltungen hier in Berlin. Die Teilnahme an solchen Veranstaltungen war für mich zum Teil berufsbedingt. Ich war ja FDJ-Funktionär und später hauptamtlicher Parteiarbeiter, Berufsrevolutionär, wenn man so will. (lacht) Und bei niveauvollen und wichtigen Großveranstaltungen der FDJ war Busch eben oft, wie man heute sagen würde, Stargast.
„Ernst Busch war in der DDR ’ne lebende Legende!“
Waren das für Sie mehr als nur Pflichttermine?
Unbedingt, unbedingt! Für mich waren er und sein Auftritt ein Symbol und ein Aufruf für die Einheit von Sprechen und Tun. (…) Bei ihm hatte man das Gefühl, dass er – auch bedingt durch den Spanienkrieg – wusste, wovon er sprach oder sang. Dass er mit seinem Liedgut auch, jedenfalls in den 30er Jahren, bestimmt nicht mehr in den 70er und 80er Jahren, dazu beigetragen hatte, die Menschen ein bissl wacher zu machen.
Hatten Sie bei FDJ-Veranstaltungen in den 60er Jahren den Eindruck, dass Busch bei den jungen Leuten ankam? Haben Sie da in den Gesichtern der Zuhörer so etwas wie Interesse oder gar Faszination gesehen?
Ich denke, ja. Ich will jetzt nicht so kühn sein und das mit absoluter Sicherheit behaupten, aber ich denke, ja. (…) Er hat eben durch die Art seines Vortrags die Emotionen rübergebracht, da wurde auch mitgesungen, und es gab immer viel Applaus. Er war ja ’ne lebende Legende.
Für Sie und Ihre Generation bestimmt. Aber konnten die jungen Leute mit seinem Namen auch alle etwas anfangen, wenn es hieß: Heute Abend tritt Ernst Busch auf?
Die aktiven bestimmt. Ich muss natürlich einschränken: Das gilt jetzt nicht für jemanden, der mehr oder weniger versehentlich in so eine FDJ-Veranstaltung geraten ist. (lacht) Aber eins ist klar: Ein mehr oder weniger bewusster DDR-Bürger wusste und weiß, wer Ernst Busch war und ist.
Haben Sie sich auch Platten von Busch gekauft?
Nein. Ich war und bin zwar links, aber ich bin kein Fetischist, der sich das vor Begeisterung jeden Abend auflegt. Das ist ja keine Musik, die man zur Unterhaltung hört. Das würde ich nicht mal heute machen. Heute würde ich ’s höchstens machen, wenn ich in so ’ner lethargischen Stimmungslage wäre oder zur Erinnerung eben. Aber es ist ja keine Unterhaltungsmusik!
Was ist es denn für eine Art von Musik?
Es ist schon eher Agitation, wobei man es nicht darauf reduzieren kann, weil die Interpretation auf so hohem künstlerischen Niveau stattfand, dass man es nicht ausschließlich oder zuerst als Agitation wahrnahm. Die brauchte man ja eigentlich auch nicht mehr zu der Zeit, als ich ihn gehört habe. Da war ja das, was er wollte oder was man meinte haben zu wollen, das war ja da, sprich: die DDR.
Deswegen würde mich interessieren, was für eine Funktion er hatte bei diesen Veranstaltungen.
Er war eben, und das ist ja nichts Unanständiges, in gewissem Sinne ein Repräsentant der sozialistischen Ideen. (…)
„Niveauvolles Kulturprogramm“: FDJ- und SED-Veranstaltungen
Hatte das auch was Nostalgisches?
Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Das könnte für sehr alte Menschen so gewesen sein, also für Spanienkämpfer zum Beispiel. (…) Das war ja ein Zeitraum von 15 Jahren, in dem ich Busch hin und wieder erlebt habe, das ging bis Mitte der 70er Jahre. Einmal hat er, das muss einer seiner letzten Auftritte gewesen sein, im Palast der Republik gesungen. Meine Erinnerung daran ist vage, aber ich weiß noch, dass das eine sehr hohe Protokollveranstaltung war, wie das damals hieß. So eine Protokollveranstaltung hatte im Wesentlichen zwei Bestandteile: nämlich a) es wurden zwei bis drei Reden gehalten und b) es gab ein niveauvolles Kulturprogramm – und auch nicht ausschließlich proletarisches Liedgut, sondern auch mal Peter Schreyer zum Beispiel. An diesem Abend war Ernst Busch für den zweiten Teil eingeladen. Vielleicht war ’s ein offizieller Staatsbesuch aus dem sozialistischen Ausland. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls ist da Busch nach längerer Zeit wieder aufgetreten. Im Gegensatz zu früheren Gelegenheiten war er nach meiner Erinnerung da von seiner ganzen Gestik her nicht mehr der Typ, der die Menschen von den Stühlen reißen konnte. Er war nicht mehr so kraftvoll, was ja auch verständlich ist, weil er echt alt war. (…)
Hat er zwischen den Liedern etwas gesagt, irgendwelche Bemerkungen gemacht?
Nein. Aber selbst vom Liedvortrag her merkt man ja … Es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich so auftrete und singe, als wenn ich gleich selber Morgen in den Kampf ziehen wollte oder ob ich, weil ich ’s eben schon lange tue, mich immer noch berufen fühle, diese Lieder zu singen. (…) Sonst habe ich Busch ja mehr auf Singeveranstaltungen als auf Protokollveranstaltungen erlebt. Und seine Lieder erklärten sich auf Veranstaltungen eigentlich von selbst. (…)
Sind Busch und Schreyer auch mal zusammen aufgetreten?
Würde ich jetzt nicht wissen. Ist vom Prinzip her aber nicht unmöglich.
Waren die FDJ-Veranstaltungen, bei denen Sie waren, offen für jedes Publikum? Und waren das Pflichtveranstaltungen für die FDJ?
Diese eine im Palast der Republik war sicherlich eine de facto geschlossene Veranstaltung, da kam man nur mit Karten rein. Ansonsten würde ich mich dem Begriff „Pflichtveranstaltung“ überhaupt nicht anschließen. Das ist eigentlich Nonsens! Es gab natürlich durchaus Abende, wo man gesagt hat: „Es wär schon schön, wenn du da hingehst …“ oder „Geh mal unbedingt hin …“ oder „Wir möchten, dass du da hingehst …“. Aber Pflicht war es nicht – wer wegblieb, wurde ja nicht bestraft.
Wie lief so ein Abend ab?
Man muss eben unterscheiden zwischen Singeveranstaltungen und Protokollveranstaltungen. Ich habe ihn mehr auf Singeveranstaltungen erlebt. Da traten eben sehr viele unterschiedliche Solisten und Gruppen auf. Und da wurde eben auch zum Mitsingen aufgefordert.
War Busch bei diesen Abenden der herausragende Name?
Unbedingt, unbedingt. (…) Ich weiß es zwar nicht, aber er wird bestimmt auch mal im Rahmen der Singebewegung aufgetreten sein. Das müssten Sie mal recherchieren.
Haben Sie ein Lieblingslied von Busch?
Wissen Sie, gegen den Begriff „Lieblingslied“ wehre ich mich bei seinem Liedgut. Was am tiefsten im Gedächtnis ist, ist eben „Spaniens Himmel“ – da würde ich aber nicht von Lieblingslied sprechen.
Warum nicht?
Weil das eine zu ernste Thematik ist. Da kann ich nicht von Lieblingslied oder Hitliste sprechen. Für mich schließt sich das aus. Aber von der Rangfolge her wäre „Spaniens Himmel“ für mich das erste und dann das „Einheitsfrontlied“. Mich beeindruckten die Zeilen „es macht dich ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her“. Das war für mich übrigens auch der wesentliche Unterschied zu Paul Robeson. Den hab ich mal im Friedrichstadtpalast live erlebt, und der hat ja mehr klassisch gesungen. Aber wenn er mal ins Proletarische gegangen ist, dann war ’s eher Zustandsbeschreibung oder Klagelied. Bei Busch war wichtig: erstens die Analyse und zweitens der Aufruf. Also, Busch hat gewissermaßen immer gesagt: „Ändert selbst was!“ – Und in dem Sinne (…) ist für mich Busch derjenige, der am deutlichsten und am energischsten von der Art und Weise seines Vortrags her und eben von den Texten her, die ja sicherlich nicht seine waren, zur Veränderung aufgerufen hat.
Hat Sie das angesprochen?
Unbedingt. Ich glaube aber, dass man für eine solche Art der Kunst und des Gesangs wahrscheinlich schon ein Stück weit intellektuell oder sachlich und emotional geöffnet sein muss. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass jemand, der überhaupt nichts vom Linkssein weiß und hält, dass den das spontan anspricht, wenn er den Busch jetzt zum ersten Mal hören würde.
„Du bist doch dialektisch vorjeschult!“ Werdegang und Politisierung
Kommen Sie aus einem linken Elternhaus?
Nein. Das ist eine eigene Geschichte (lacht), die wird Ihnen auch nicht groß weiter helfen. Ich erzähle Ihnen die Kurzform, weil Sie ja so konkret fragen. Es ist fast so etwas wie eine Anekdote … Ich hab vor der Wende immer aus Spaß gesagt: Ich bin eigentlich ein Opfer des 13. August.
Inwiefern?
Ich hab ja als ersten Beruf Konditor gelernt, hier in Berlin, und hab ’61 ausgelernt. Und es gab ja diese berühmten Grenzgänger: Das waren Ost-Berliner, die in West-Berlin zur Arbeit gingen, auch in meiner Berufsgruppe gab ’s da viele. Und wenn ich vier Wochen vorher ausgelernt hätte, hätten mich alle möglichen Konditoreien noch mit 1000 Mark begrüßt und gesagt: „Komm doch zu uns in die Backstube!“ – Aber da der Staat, was ich nachträglich auch richtig finde, drauf achtete, dass zuerst die Arbeit bekamen, die nun durch die Mauer keine mehr hatten, hab ich keine Arbeit gekriegt. Die Grenzgänger waren ja über Nacht alle arbeitslos geworden, die mussten eine neue Beschäftigung im Osten kriegen. Ich hab dann, weil ich vorher schon als Lehrling fürs Taschengeld gekellnert hatte, am Buffet so ’n Job gemacht in ’nem Restaurant. Und dann kam zufälligerweise mein ehemaliger FDJ-Sekretär und fragte mich: „Willst Du nicht FDJ-Sekretär werden?“ – Das war eine Tradition, die ich auch gut fand und für mich selbst auch nachvollzogen habe: Wer aussteigen wollte, der musste immer ’nen Nachfolger anbringen. (…) Wenn der 13. August nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich zunächst wirklich Konditor geworden.
So sind Sie FDJ-Funktionär geworden. Aber links waren Sie offenbar ja schon vorher …
Ja. Das ist nur der eine Teil der Geschichte. Es gibt aber noch einen zweiten inhaltlichen, fast philosophischen Anlass: Da war ich so um die 12, 13 Jahre und war zu Besuch bei Verwandten oder Bekannten in West-Berlin. Und ich hatte immer irgendwie schon, auch als Kind, das Bedürfnis nach Ehrlichkeit und nach Gerechtigkeit und mischte mich auch gerne in Gespräche ein, was ja jedes Kind eigentlich macht. Und da sagte irgend so ’n Onkel zu mir: „Sei doch ruhig! Du bist doch dialektisch vorjeschult!“ (lacht) – Ich hatte noch nie was von Dialektik gehört. Also gehe ich drei Tage später in die Bibliothek und sag zu der Frau da: „Gebense mir wat über Dialektik!“ – Da hat die natürlich ooch jekiekt! Und da hat sie mir, ich verkürze das jetzt, zuerst das „Kommunistische Manifest“ in die Hand gedrückt und dann noch weitere ähnliche Bücher. Und das hat mich angesprochen. Und so fing das an, eigentlich mit 13 Jahren.
Von Ihrem Elternhaus her kamen da keine Anregungen?
Überhaupt nicht. Ich bin bei fremden Menschen als Pflegekind groß geworden. Das waren bürgerliche Menschen, konservative Leute. Also ganz das Gegenteil! Als ich Mitglied der SED geworden bin, sagten die zu mir, weil sie an die Zeit in den 30er Jahren dachten: „Das muss ja schön sein, wenn dann die Leute auf dich mit ‚m Finger zeigen und sagen: Da kommt der Kommunisten-Brümmer!“ – Ich hab dann auch mit diesen Damen, es waren zwei Frauen, gestritten und gesagt: „Ihr habt ’s zwar erlebt, aber nicht erfahren!“ (…)
„Emotionale Aufrüstung“ – Das Spanienlied
Wenn Sie heute an Ernst Busch denken, was bedeutet er für Sie? Sehen Sie ihn als eine Figur der DDR?
Für mich steht er zuerst für Spaniens Freiheit. Das heißt, die Vor-DDR-Zeit ist für mich zunächst die entscheidende. Und zweitens hatte er in der DDR natürlich seinen Hort, meine ich. In der DDR war er ein wichtiger künstlerischer Repräsentant des neuen Deutschland, wie wir damals sagten. (lacht)
Hat er dazu beigetragen, dass die Erinnerung an den Spanienkrieg wach gehalten wurde in der DDR?
Unbedingt. Durch ihn wurde ja das Spanienlied berühmt. Als Beispiel: Auf vielen ganz normalen auch kleineren Veranstaltungen, sei es von der FDJ oder der SED, da wurde eben zu Beginn oder zum Ende ’n Lied gesungen. Und wenn es bei diesen Versammlungen hieß ’Wat singwa jetz?’, dann kam eben meist ’Spaniens Himmel’, weil, unanständigerweise gesagt, manche auch andere Liedtexte gar nicht kannten. Das wurde dann gesungen als emotionale … Aufrüstung sozusagen. (lacht)
War das ein Hit?
In Anführungsstrichen unbedingt!
Was Busch in Spanien geschaffen hat, entfaltete ja überhaupt erst in der DDR eine größere Wirkung. Diese Lieder schufen ja offenbar eine ganz eigene Art der Erinnerung und ein Gemeinschaftsgefühl, das weit über die Interbrigadisten hinaus ging …
Völlig richtig. Und in dem Sinne denke ich, dass man sagen kann, übrigens unabhängig von den Kategorien Ost und West, dass Busch ein Synonym für deutsche Spanienkämpfer ist. Busch hat sozusagen damit auch so ’n bissl nationale Ehre wiederhergestellt, er hat sozusagen gezeigt: Es gab nicht nur den Faschismus, sondern aus unserm Land kommen auch Menschen, die was dagegen unternommen haben. (…)
Ich fand die Vorstellung immer merkwürdig, dass junge Leute „Spaniens Himmel“ singen, Leute, die teilweise 30, 40 Jahre weg sind von dem historischen Ereignis, zu dem das Lied geschaffen wurde, aber sich trotzdem darin irgendwie wieder finden sollen. Ich meine, im Text kommen Worte vor wie „Schützengraben“ … War das nicht manchmal seltsam, dieses Lied etwa in den 70er Jahren in einer FDJ-Versammlung oder auch in einer großen Halle mit vielen Menschen zusammen, die den Krieg nicht erlebt haben, zu singen? Kam Ihnen das nicht anachronistisch vor?
Nein. Einfach deshalb nicht, weil man eben – und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin sagte – ein bestimmtes Maß an emotionaler Bindung an diese Historie braucht, um das zu verstehen und zu fühlen. Dann ist man oder meint sich in einer Dimension, die relativ zeitlos ist. Den Ruf der Freiheit in dem Sinne gab ’s ja seit Jahrhunderten, sag ich jetzt mal. So muss das Lied ja gesehen werde. Und deswegen wirkte das Lied, weil es auch über die Emotionen geht, nicht anachronistisch. Zumindest hatte ich überhaupt nicht diese Empfindung, und, ich unterstelle mal, weil es eben so sehr häufig gesungen wurde, andere wahrscheinlich auch nicht. Natürlich muss man auch da wieder unterscheiden: Nicht jeder, der ’s gesungen hat, musste sich nun unbedingt en detail mit dem verbunden fühlen, was er da sang. (…) Es ging ganz grob um Linkssein, um das Gefühl der Freiheit. So wie man sich auch bei anderen Liedern nicht bis auf die Kommastelle genau den Text anguckt. Aber wenn einem das Ganze von der Emotion und vom Vortrag her gefällt, dann reicht das ja manchmal schon.
Hat sich „Spaniens Himmel“ sozusagen irgendwann verselbstständigt und wurde, von Busch losgelöst, ein Lied für alle Anlässe?
Ja, unbedingt. Das Lied war ein fester Bestandteil des sogenannten sozialistischen Liedguts, ohne Frage! Aber, da kann ich nur für mich sprechen, es ist für mich auch immer Busch! Trotzdem gab es viele Menschen, die gar nichts von Busch wussten, und munter dieses Lied gesungen haben. Mit Sicherheit war das so, das Lied wurde ja auch in der Schule gesungen. Und wer in der sechsten Klasse war, der musste nicht unbedingt was von Busch gehört haben. (…) Außer die Musiklehrerin war zufällig ein Fan von Busch.
Würden Sie sagen, dass es irgendwann den Charakter eines Volksliedes hatte?
Da wehre ich mich gegen den Begriff. So wie ich ihn interpretiere, würde ich sagen: nein. Aber im Sinne von Massencharakter: ja. (…) Es gehörte unbedingt zum Massengut, hässliches Wort. Oder sagen wir: Es gehörte zum festen Bestandteil des Liedguts in der DDR und war unter diesen Agitationsliedern, in Anführungsstrichen, mit Abstand das erste. Das haben Leute auch beim Abspülen vor sich hin gepfiffen, das war schon sehr populär. (…) Ich glaube übrigens auch, dass das nicht verschwinden wird – dazu war es eine Zeit lang zu präsent. Es ist sozusagen schon in die Geschichte eingegangen. (…). Und ich muss Ihnen sagen: Wenn man das Lied in großen Gruppen gemeinsam sang, dann war das ein erhebendes Gefühl – jedenfalls am Anfang, als es noch nicht so abgenutzt war.
Diskutieren und Singen: Parteilehrjahr und FDJ-Studienjahr
Singen Sie selbst auch?
Sagen wir mal: Ich singe nicht gut, aber gerne. Ich bedaure auch, dass ich kein Instrument spielen kann. Aber mit anderen zusammen habe ich schon immer gerne gesungen, gerade „Spaniens Himmel“. (…) Ich habe ja schon gesagt, dass an den Anfang und ans Ende von Versammlungen, wenn sich die Parteigruppe traf, ein Lied gehörte. Und zwar waren das eben sogenannte Arbeiter- und Kampflieder. Da sang man auch nie, das wissen Sie wahrscheinlich gar nicht, die „Internationale“. Die sang man nicht in Gruppen von 30 Mann, die sang man höchstens in großen Menschenansammlungen, aber nicht in kleinerem Kreis bei der Zeitungsschau oder beim Parteilehrjahr.
Parteilehrjahr?
Das war so was wie ’ne Weiterbildung. Da saß die Parteigruppe alle vier Wochen zusammen und hat sich mit einem Problem, mit einer Fragestellung entweder des Sozialismus oder des Kapitalismus beschäftigt. Bei der Partei hieß das Lehrjahr, bei der FDJ Studienjahr. Und für diejenigen, die vom Alter oder ihrer ideologischen Haltung her weder in der FDJ, noch in der Partei waren, hieß das Schulen der sozialistischen Arbeit. Das ging immer über ein Jahr, da gab ’s dann Broschüren zur methodischen und inhaltlichen Aufbereitung mit Angaben, was man also praktisch in jedem Monat sich vornimmt zu behandeln. Und das gab ’s eben speziell fürs Parteilehrjahr und fürs FDJ-Studienjahr. Und für die Schulen der sozialistischen Arbeit gab ’s das zwar auch, aber da war ’s notwendiger- und richtigerweise natürlich noch viel lockerer.
Und wer traf sich zum Parteilehrjahr?
In einem Betrieb, BVG von mir aus, gab ’s eben zum Beispiel die Gruppe Planung. Und da gehörten vielleicht 50 Leute dazu. Und von diesen 50 Leuten waren acht in der SED. Und diese acht haben dieses Parteilehrjahr gemacht. Die Differenz zu 50 teilte sich in FDJ-Studienjahr und Schulen der sozialistischen Arbeit.
Damit alle mal geschult wurden und …
Naja, geschult ist fast zu viel gesagt. Ich hab ’s ja selber auch als Durchführender gemacht. Das war immer sehr unterschiedlich. Es war eigentlich zu 50 Prozent oder mehr ein Diskutieren. Und ein geringer Teil waren noch so ’n bissl theoretische Grundlagen oder was wir dafür hielten …
… des Marxismus-Leninismus?
Ja, ja.
Und das wurde also jedes Mal mit einem Lied eingeleitet und mit einem Lied beendet?
Nein, diese Schulungen nicht, sondern die Parteiversammlungen. Die fanden jeden Monat für die Mitglieder der SED statt, zusätzlich zu den Schulungen. Und zwar überall, wo Menschen arbeits- oder bildungsmäßig organisiert waren. In großen Betrieben waren die Parteimitglieder eben eingeteilt in Parteigruppen als strukturmäßig kleinste Einheiten. Und bei dieser Parteiversammlung, da wurde eben zu Beginn oder am Ende oder im besten Fall zu Beginn und am Ende ein, ich sag mal, linkes Lied gesungen.
Was waren da in Ihrer Erinnerung die meistgesungenen Lieder?
Kann man schwer sagen, weil die Gruppen sehr unterschiedlich zusammengesetzt waren.
Je nach Lieblingslied des jeweiligen Leiters?
Ja, aber auch je nach Können und auch Mentalität der Leute. „Spaniens Himmel“ wurde dann zum Beispiel in den 80er Jahren etwas weniger gesungen, weil es eben, das muss man ehrlicherweise sagen, zum Dauerbrenner geworden war. Das war schon unanständig bei manchen: Weil sie nicht mehr Texte kannten, haben manche fast ausschließlich „Spaniens Himmel“ gesungen. (lacht) (…)
Interview: Jochen Voit
Foto: privat
(Textfassung autorisiert von Lothar Brümmer am 7. Februar 2006)

Anne Dessau
über Unabhängigkeit und über Ernst Busch und die Liebe eines Sommers
„Er war mein Idol.“
(Gespräch am 24. Januar 2006 in Berlin)
Anne Dessau ist Jahrgang 1934. Sie wächst in ihrer Geburtsstadt Dessau auf, wo sie nach achtjähriger Volksschule eine Buchhändlerlehre macht. Erst danach darf sie sich ihren eigentlichen Berufswunsch erfüllen und Schauspielerin werden. Mit 17 beginnt sie ihre Ausbildung – zunächst in Erfurt und dann an der neu gegründeten Staatlichen Schauspielschule Berlin. Die Einrichtung (die spätere Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“) geht zurück auf die 1905 von Max Reinhardt gegründete Schauspielschule des Deutschen Theaters. Anne Dessau beendet ihre Ausbildung 1954, erhält aber kein Diplom, weil es während ihrer Studienzeit zu Querelen mit der Schulleitung gekommen ist. Stein des Anstoßes sind honorierte Aufnahmen in Ernst Buschs Plattenfirma Lied der Zeit und ihre persönliche Bekanntschaft mit Busch gewesen. Als Schauspielerin arbeitet sie später an verschiedenen Häusern, zuletzt am Deutschen Theater bei Wolfgang Langhoff, Wolfgang Heinz und Benno Besson. Mitte der 60er Jahre entschließt sie sich, ihren Beruf aufzugeben und sich dem Schreiben zu widmen. Sie arbeitet als Journalistin unter anderem für die Weltbühne und als freie Autorin fürs DDR-Fernsehen. Einige von ihr geschriebene Filme werden mit Preisen im In- und Ausland ausgezeichnet. Von 1980 bis zur Wiedervereinigung werden ihre Vorlagen allerdings aus politischen Gründen nicht mehr realisiert, nach 1990 reüssiert Anne Dessau als Buchautorin und schreibt wieder erfolgreich für Kino und Fernsehen. Seit 1960 ist sie mit dem Schauspieler Helmut Müller-Lankow verheiratet.
Unser Gespräch findet bei Anne Dessau im Wohnzimmer statt. Blick in den verschneiten Garten. Dämmerlicht und Kerzen. Es gibt Gebäck und grünen Tee.
Jochen Voit: Frau Dessau, wie kommt es, dass Sie wie eine Stadt heißen?
Anne Dessau: Ich hab ursprünglich einen polnischen Mädchennamen gehabt: Anneliese Chmielecki, aber der wurde stets falsch ausgesprochen. „Schmierlekki“ wurde gesagt, was ich ziemlich barbarisch gefunden habe. Mit 23 spielte ich meine erste große Filmrolle, der Regisseur sagte: „Wie heißt du? Anneliese Chm… – das geht nicht!“ Er fragte mich, wo ich herkomme, und ich habe gesagt: „Aus Dessau.“ Darauf er: „Anne Dessau.“ Peng, mein Name war geboren. Mir hat das insofern gefallen, weil unsere einstige Landesmutter eine Bürgerliche war, eine Apothekerstochter mit dem Vornamen Anneliese. Sie hatte den Fürsten von Sachsen-Anhalt geheiratet und hieß danach Anneliese von Dessau, darüber gibt es übrigens auch eine Operette. (lacht) Von dieser Frau hatte ich ja schon den Vornamen und nun hieß ich auch noch Dessau. So wurde es im Personalausweis eingetragen, das ist jetzt seit fast 50 Jahren mein Name.
Der Film, den Sie damals drehten, war „Millionen der Yvette“ …
Ja, danach habe ich allerdings keine Spielfilme mehr gemacht, sondern Theater gespielt. Erst in Quedlinburg, dann in Potsdam und meine dritte und letzte Station war das Deutsche Theater hier in Berlin. Ich war dort eine unter vielen: Am Deutschen Theater gab es mindestens fünfzehn wunderbare Schauspielerinnen im Alter zwischen 30 und 45, von denen jede all das spielen konnte, was ich gern gespielt hätte. Sie hatten bereits gezeigt, was sie konnten … Ich hatte mich allerdings schon immer gemopst auf Proben …
Was meinen Sie mit „gemopst“?
Gelangweilt. Das, was Schauspieler eigentlich genießen, sich eine Sache erarbeiten und sie dann abends auf der Bühne zeigen, hat mich nicht so wahnsinnig begeistert. Ich fand den eigentlichen Arbeitsprozeß nicht so prickelnd, ich wollte immer nur abends raus auf die Bühne. Also, ich war nicht ausgefüllt. Theaterspielen heißt, das zu machen, was andere sagen: Erst sagt ’s der Dichter, dann sagt ’s der Regisseur, und dem Ensemblespiel ist man ja auch verpflichtet – das war nicht mein Ding. Ich wollte unabhängig sein, hatte Lust zu schreiben. 1966 hab ich dann ein Fernstudium in Journalistik angefangen.
„Völlig daneben!“ – Von der Buchhändlerin zur Schauspielerin
Kommen wir noch mal zurück zur Schauspielerei. Als Sie aus Dessau weg gegangen sind, …
… bin ich auf die Schauspielschule nach Erfurt gegangen, da war ich 17. Und kaum war ich ein halbes Jahr dort, wurden alle Schauspielschulen zusammengelegt. Es gab ja Schulen in Dresden, in Weimar, in Erfurt, in Potsdam … Nun wurde die Ausbildung zentralisiert, und zwar in Leipzig und Berlin. Das heißt, wir wurden noch mal gesiebt und mussten noch mal vorsprechen. Man konnte wünschen, wohin man wollte, aber ob sich das für jeden erfüllt hat, weiß ich nicht. Für mich hat es sich erfüllt: Ich wollte nach Berlin und habe mich dort für die neue Fachschule für Schauspielkunst beworben. Die Weigel war Vorsitzende in der Kommission, der ich vorsprechen mußte, sie hat auch das Gespräch mit mir geführt. Auf ihre Frage, warum ich denn nach Berlin wollte, hab ich dann, gar nicht aus Raffinesse, sondern weil ich wirklich der Meinung war, gesagt: „Weil Sie in Berlin sind und weil Ihr Ensemble in Berlin ist! Und weil ich diese Art zu arbeiten so bewundere!“ Ja, und dann kam ich nach Berlin.
Glauben Sie, dass Helene Weigel beeindruckt war von dieser Antwort?
Das weiß ich nicht. Sie war eine sehr freundliche Frau, jedenfalls zu Außenstehenden immer von außerordentlicher Herzlichkeit.
Wie fanden das Ihre Eltern, dass Sie Schauspielerin werden wollten?
Völlig daneben. Ich habe erst einen Beruf lernen müssen, vorher durfte ich mich gar nicht bewerben. Und da ich nur acht Volksschuljahre habe, konnte ich schon mit 14, schwupps, in die Lehre gehen. Ich hab Buchhändlerin gelernt. Die Lehre dauerte eigentlich drei Jahre, aber man hat mir ’n bisschen was erlassen. Und als ich dann in Halle meine Gesellenprüfung machte, sagten die würdigen Herren mir, dass sie mich sofort nehmen würden. Als Bibliothekarin. Als ich antwortete, dass ich eigentlich Schauspielerin werden will, fanden sie das furchtbar, die alten Herren.
Das ist ein großer Sprung: von der Bibliothekarin zur Schauspielerin …
Ja, und zwar ein Sprung in den Abgrund für die Herren Bibliothekare.! (lacht) (…) Dabei hatte mir diese Prüfung Riesenspaß gemacht: Man kriegte ein Thema, hatte dann zwei Stunden Zeit, alle Titel zu diesem Thema aus dieser wahnwitzig großen Landesbibliothek raus zu suchen. Wer viele Quellen fand und das Material gut kommentierte, bekam die entsprechenden Punkte. Recherchieren hat mir schon immer großen Spaß gemacht. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits die Zusage für die Schauspielschule in Erfurt. Meine Mutter ließ mich erst los, nachdem ich meine Gesellenprüfung abgeschlossen hatte.
Sie haben also nie in Ihrem ersten Beruf gearbeitet?
Nie. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich immer irgendwie in diesem Beruf gearbeitet habe. Denn für jede Arbeit, jeden Text, jedes Buch, für alles, was ich später geschrieben habe, musste ich ja unentwegt in Archive und in Bibliotheken gehen und dort kramen.
„Tabakwaren und Spirituosen“ – Kleinbürgerliches Elternhaus
Waren Ihre Eltern künstlerisch interessiert?
Meine Mutter hatte ein Opern-Abonnement. (lacht) Und uns gegenüber wohnte der Tenor vom Landestheater. Da war sie immer ganz aufgeregt, wenn er zum Einkaufen kam. Meine Mutter hatte so ’n kleinen Laden, also meine Familie war richtig kleinbürgerlich. Künstlerisches Talent schlummerte ein wenig in der Familie meines Vaters: Da ging man gerne mal bei Feiern im Betrieb mit Versen von Otto Reutter auf die Bühne, so in die Richtung ging das. Mein Vater hat überhaupt gerne die Leute unterhalten.
Was hat Ihr Vater beruflich gemacht?
Gelernt hat er Klempner. In den Junckers-Werken in Dessau war er dann Werkstoffprüfer. Da wurden ja Flugzeuge gebaut, und jedes Stück Metall, was verarbeitet wurde, musste geprüft werden. Das hat er gemacht, nachdem Hitler an die Macht gekommen war, davor war er etliche Jahre arbeitslos – also die klassische Geschichte, die man so kennt aus der Zeit …
Hat er sich mit den Nationalsozialisten identifiziert?
Überhaupt nicht, nein. Aber es gab ein schlimmes Erlebnis, als die Russen einmarschierten: Er hatte so ’n Gewerkschaftsabzeichen, und in dem Abzeichen war ein kleines Hakenkreuz. Die Russen zogen ihn über ’n Ladentisch, das war eine brenzlige Situation.
War er in der NSDAP?
Nein. Meine Eltern haben heimlich über diesen Hitler geschimpft und hörten heimlich Londoner Rundfunk. Das weiß ich noch, dieses Ba-ba-ba-bamm (klopft den Takt der Senderkennung auf den Tisch), da wurde dann ’ne Decke über den Apparat gehängt, und man saß lauschend darunter …
Also, politisch waren Ihre Eltern …
… nicht sehr aktiv. Es ging vor allem darum, dass man sein Auskommen hatte. Farbe bekannte mein Vater insofern, als er vor ’33 in der SPD war und nach dem Krieg dann sozusagen übernommen wurde in die SED.
Und Ihre Mutter?
Meine Mutter war nie in irgendeiner Partei. Sie hat Tabakwaren und Spirituosen verkauft, ist früh um fünf aufgestanden, um für drei Pfennig zwei Zigaretten an die Arbeiter, die zur Schicht gingen, zu verkaufen. Sie war diese typische Frau, die sich kaputt geschuftet hat, um ihre Familie ein wenig in der Rangordnung der Gesellschaft höher zu hieven. Deswegen war sie sehr enttäuscht: weil ich, die ja als ganz gescheites Mädchen galt, nun ausgerechnet Schauspielerin werden wollte. Ich sollte studieren. Was Ordentliches.
Ruhten die Hoffnungen der Familie allein auf Ihnen?
Nein, ich habe einen 13 Jahre älteren Bruder. Der war zu diesem Zeitpunkt noch in Gefangenschaft. Er hatte Zeitungskaufmann gelernt, war also für Annoncen zuständig, heute würde man vielleicht sagen: Er arbeitet im Mediengeschäft. Lange Zeit hatte er die Idee, Spanisch zu lernen und als Korrespondent mit mir zusammen ins Ausland zu gehen. Daraus wurde nichts. Ich ging auf die Schauspielschule, er heiratete, hat … dann einen ganz anderen Job gemacht, Planungsleiter in der Chemie.
„Kunst als Waffe“ – Politische Erziehung an der Schauspielschule
Gab es eine Zeit, in der Sie angefangen haben, sich politisch zu interessieren?
Wir wurden ja zum politischen Denken erzogen auf der Schauspielschule. Wir hatten Gesellschaftsunterricht, Marxismus-Leninismus …. Das war die vorherrschende Ideologie, die Philosophie, Basis jeden künstlerischen Schaffens: „Kunst als Waffe“. Auch ein Motto von Ernst Busch, aber er hat es gelebt, es war seine persönliche Erfahrung und die hat er mit seinen Liedern und in seinen Rollen mitreißend an sein Publikum weitergegeben. Die uns aufgedrückten Diskussionen um Inhalt und Form, in denen ging es darum, dass man den Menschen in einer künstlerischen Form didaktisch belehrt, der Inhalt also die Form bestimmt.
Wogegen sollte Kunst Waffe sein?
Gute Frage. Gegen die Kapitalisten, gegen den „Klassenfeind“, wie das hieß. Dieses Kämpfen mit künstlerischen Mitteln, das gehörte zu all diesen hehren und drögen Geschichten, die uns erzählt wurden.
„Hehre und dröge Geschichten“, eine merkwürdige Mischung …
Das ist sicher stark verkürzt, aber darauf lief es hinaus. Das erste Mal, dass ich richtig empört war, das weiß ich noch, war bei Stalins Tod ’53: Da sollten plötzlich alle Menschen so was von wild gebeutelt und erschüttert sein, weil dieser Mann nun tot war. Ich war vielleicht 18 Jahre alt und mir hat er nicht viel bedeutet. Damals war ich für ein halbes Jahr in einer Fabrik beschäftigt, und als die Nachricht von Stalins Tod kam, mussten wir alle antreten zum Appell, fünf Minuten schweigen und an „die Sonne der Sowjetunion“ denken. Die „Sonne“ war Stalin. Und das war in vielen Betrieben so, in der ganzen DDR. Nun war ich aber ein junger Mensch, der Druck und Unterordnung nicht leiden konnte. Ich war gegen alles, was Druck auf mich ausübte, das konnte sehr verschiedener Natur sein, das hatte nicht unbedingt was mit Politik zu tun. Zuordnen: ja. Aber unterordnen: nein.
Wie haben Sie diese Zeremonie empfunden?
Als ganz schrecklich. Ich fand, das sollte man nicht machen mit all den Menschen, die wahrscheinlich gar keine Beziehung zu diesem Mann hatten. Dann gab es kurz darauf noch ein bestürzendes Ereignis, als die Leute ’53 auf der Stalinallee demonstrierten, als dieser Aufstand war, der dann niedergeschlagen wurde.
„Erst später helle dafür geworden“ – Der 17. Juni 1953
Was verbinden Sie mit diesem Ereignis, dem 17. Juni?
Mein Bruder kam damals von einer Dienstreise aus Berlin zurück. Er war Planungsleiter einer Chemiefabrik, war in der Partei und trug auch dieses Abzeichen. Jedenfalls haben sie ihn an der Stadtgrenze von Dessau aus dem PKW gezogen und wollten ihm ans Leben. Sie haben das Auto umgeworfen und sind richtig gewalttätig gewesen. Die Leute waren aufgebracht, weil mein Bruder dieses Abzeichen trug. Und sie waren der Meinung, dass diese Idee vom Arbeiter- und Bauernstaat ’ne Lüge ist. Das war mir bis dahin gar nicht so als Problem erschienen und ich bin erst später helle dafür geworden. Ich muss überhaupt sagen, dass ich das erst im Nachhinein für mich ein bisschen aufgearbeitet hab. Denn für mich waren die Verhältnisse in der DDR zunächst eine Befreiung gewesen: als Mädchen aus einfachen Verhältnissen in einem Land aufzuwachsen, also sagen zu können: „Ich will das werden“, oder „Ich will das werden“ – und wenn ich die Fähigkeit oder die Begabung dafür nachwies, dann konnte ich das. Das fand ich einfach aufregend! Wir Studenten waren, so erinnere ich mich, intensiv damit beschäftigt, das voranzutreiben, was wir eigentlich machen wollten. Theaterspielen! Das ist übrigens auch heute in der Buschschule noch so, das ist eine richtige Enklave. Ich hab Interviews für die Zeitschrift Ossietzky mit Schauspielstudenten gemacht und ihnen auch Fragen zu politischen Themen gestellt – da gucken die ganz verdutzt und fühlen sich außerordentlich gestört. Oder sind sofort misstrauisch und denken: „Was will denn die von mir? Worauf will die jetzt hinaus? Was will die von mir hören?“ Sie sind auch nicht streiken gegangen gegen Studiengebühren …
Wer Schauspiel studiert, hat wahrscheinlich einen stark individualistischen Zug …
Absolut. Das ist es ja, was dich treibt beim Schauspiel, dieses Ich-Sagen. Eigentlich ist das überhaupt gar nichts, was „Wir“ sagt. Und ich denke mal, dass es nicht unbedingt ehrlich ist, wenn man als Schauspieler sagt: „Ich möchte den Leuten dieses oder jenes sagen, indem ich den Dichter oder Autor so und so interpretiere.“
Wie muss man sich das vorstellen, als Sie 1951 nach Berlin gegangen sind? Offenbar hatten Sie ja Ihre Eltern inzwischen einigermaßen überzeugt, dass das jetzt die richtige Entscheidung ist …
Ja. Ich hab mir dann in Berlin-Adlershof ’n möbliertes Zimmer genommen. Die Schauspielschule war damals in einem alten Bootshaus in Schöneweide untergebracht. Anfangs haben wir sogar in der Schule geschlafen, ich glaube, in diesen Räumen ist heute die Direktion untergebracht. Wir haben auf Jutesäcken und Feldbetten gepennt, die noch aus der Zeit der Bombenangriffe im Keller gestanden hatten, aufgereiht wie die Sardinen. Es dauerte eine Weile, bis wir alle ’ne Bleibe gefunden hatten. Ich bin dann in Adlershof in die Wassermannstraße gekommen mit ’nem Plumpsklo im Keller (lacht) und ’nem großen gestickten Jesus überm Bett, und an dieser Idylle durfte man auch nichts verändern. (…) Meine Mutter hat das finanziert bis ich ein Stipendium bekam, sie hatte ein Töpfchen, wo sie das Geld aufbewahrte, das sie verdient hatte durch Gartenarbeit. Davon kriegte ich was, das Petersiliengeld war zum Beispiel für die Miete, aus einem anderen Töpfchen bekam ich was für Kohlen oder Holz. Später bekam ich auch ein Stipendium, was nicht ganz einfach war, weil ich nicht wirklich zur Arbeiterklasse gehörte. Vor allem meine Mutter mit ihrem Kleinkramladen wirkte sich nicht so günstig aus. Jedenfalls ging dann das Studium ’51/52 los, in diesem Jahr wurde auch die Schule eröffnet. Ich gehörte zum ersten Jahrgang, fing aber gleich im zweiten Studienjahr an, weil mir die Zeit in Erfurt angerechnet wurde. Und Ende ’52 flog ich dann raus … (…)
Bühne und Schallplatte – Erste Begegnungen mit Busch und Weigel
Dass es 1952 zu dieser Suspendierung kam, hing ja unmittelbar mit Ernst Busch zusammen. Bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne wissen, wann und wie Sie ihn als Künstler erstmals wahrgenommen haben …
Das war noch in Dessau. Das BE gastierte mit der „Courage“ im Landestheater, das muss etwa ’50 gewesen sein. Ich hab diese Aufführung als revolutionierend für das Theater empfunden, so eine Form von Theater hatte ich noch nie gesehen bis dahin.
Sind Sie mit Ihren Eltern da hin gegangen?
Nein! Meine Eltern fanden das schrecklich, wenn ich diese Platten aufgelegt hab. Dieses (singt heiser und wienerisch) „Von Ulm nach Metz“ hat die Weigel immer bei uns im Wohnzimmer gesungen und Busch das Lied vom Pfeifenpieter. Und meine Eltern waren sauer.
Warum mochten Ihre Eltern diese Musik nicht?
Das war ihnen absolut fremd. Meine Mutter liebte Opern, und mein Vater liebte Fußball. Also, das passte nicht. Das hat man als Kind auch nicht hinterfragt. Damals fand Jugend doch noch anders statt als heute. Wenn Eltern gesagt haben, dass sie das nicht mögen, dann hinterfragte man das nicht. Man hatte das zu akzeptieren. Und es gab genügend Gelegenheiten, wo keiner da war und ich die Musik in voller Lautstärke genießen konnte. Das Grammophon mit der Nadel, das bei uns im Wohnzimmer stand, gab was her.
Hatten Sie noch andere Platten zu der Zeit?
Ja, „Weil ich Wasserträger bin“ von Dunajevskij (lacht) und den „Donauwellen-Walzer“. Das waren aber nicht meine Platten. Das war das, was da war. Die von Weigel und Busch gesungenen Brecht-Lieder hab ich mir selber gekauft. Wann und wo, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich auch und es hat mich sehr beeindruckt, dass die Weigel mindestens einmal im Jahr in Dessau neben der Buchhandlung, in der ich lernte, vorfuhr und den Antiquitätenladen leer kaufte. Sie kam im PKW, hatte aber einen LKW dabei und ließ den voll laden mit Möbeln und Meißner Porzellan. Wahrscheinlich waren das nicht nur Sachen, die sie für sich kaufte, sondern auch als Requisiten für ihr Theater. Das vermischt sich in meiner Erinnerung, weil das alles ungefähr zur selben Zeit stattfand: dieses Plattenhören, das Gastspiel des BE und die Weigel, die im Laden nebenan einkaufte …
Ist in dieser Zeit bei Ihnen auch der Wunsch entstanden, Schauspielerin zu werden?
Das wollte ich schon immer. Ich habe ja auch Laientheater gespielt. Das fand unter der Schirmherrschaft des Landestheaters statt, wurde also von Fachleuten angeleitet. Organisiert hatte es die FDJ, ich war ein, zwei Jahre dabei. Die Buchhändlerlehre machte ich ja nur, weil meine Mutter verlangt hatte, dass ich einen Beruf lernen sollte, bevor ich mich an der Schauspielschule bewerbe.
Gab es Sänger oder Schauspieler, für die Sie damals geschwärmt haben?
Für Hans Albers als Filmstar hab ich zum Beispiel geschwärmt. Und von der Stimme her mochte ich Richard Tauber! Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, waren es oft markante Stimmen, die mich bei Männern faszinierten. Auch mein Mann hatte eine traumhafte Gesangs- und Sprechstimme. Also, Stimmen scheinen bei mir eine große Schwingung auszulösen. So erging es mir auch mit Ernst Busch, den ich ja zunächst nur durch die Platte und die Bühne kennen gelernt habe.
„Unheimliche Ausstrahlung als Mann“ – Ernst Busch auf der Bühne
Was für einen Eindruck hat Ernst Busch auf Sie gemacht, als Sie ihn zum ersten Mal auf der Bühne gesehen haben?
Zuerst war da diese Fanfarenstimme. Dann hatte er so eine Frechheit, die unheimlich charmant war, und eine Listigkeit. Ich fand schon damals: Er hatte eine unheimliche Ausstrahlung als Mann. Obwohl, wenn man ihn so anguckt auf ’nem Bild, das nicht unbedingt ersichtlich ist. Für mich verströmte er aus allen Poren: dass da ein richtiger Kerl oben auf der Bühne steht. Das weiß ich noch sehr genau. Ich erinnere mich aber ebenso gut an Regine Lutz als stumme Kattrin oder an Wolf Kaiser, Gerhard Bienert, an Ernst Kahler als Eilif – wunderbare Leute. Das war sensationell! Sie müssen sich vorstellen, dass man an traditionelles Theater gewöhnt war und dass es im Krieg lange Zeit überhaupt kein Theater zu sehen gab. Also, das Theater des BE war für mich und auch für viele andere wie Donnerhall. (…) Ich bin dann in Berlin bestimmt in jedem Stück vom BE zehn, zwölf mal gewesen. Ich habe alles gesehen, was zu sehen war. Immer wieder.
Galt das Brecht-Theater als vorbildlich im Unterricht an der Schauspielschule?
Lehrer vom BE hatten wir nicht. Aber das Theater war hochgeschätzt, natürlich. Wir sind da nicht klassenweise rein gegangen, aber wir wurden angehalten, ins Theater zu gehen. Und wir kriegten auf unseren Studentenausweis für 50 Pfennig Stehplätze. Also, wenn es voll war, konnte man auf die oberen Ränge und dort stehen oder sich auf die Treppen setzen und gucken. Auch in West-Berlin kam man übrigens für 50 Pfennig ins Kino, was wir anfangs, als es die Mauer noch nicht gab, auch gemacht haben, obwohl uns das streng verboten war.
Wurde Busch als Schauspieler im Unterricht als vorbildlich erwähnt?
Da kann ich mich nicht entsinnen. Nee, glaub ich eigentlich nicht. Das kam aber auch auf die jeweiligen Dozenten an, mit denen man zu tun hatte. Und es kam darauf an, aus welchem Land die Emigranten, die ja das Kulturleben maßgeblich bestimmten, zurück kamen. Die in Russland gewesen waren, vertraten ganz andere Ansichten als diejenigen, die sozusagen beim Klassenfeind untergeschlüpft waren, also in den USA, in England, Mexiko, der Schweiz …
Die Faszination, die Busch auf Sie ausübte, hat sich also abseits der Schauspielschule entwickelt. Sie haben für ihn geschwärmt …
Ja, aber Sie dürfen sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich nun unentwegt vor mich hin für Busch geschwärmt hätte. So war das überhaupt nicht. Ich fand ihn zunächst einen tollen Schauspieler mit einer ungeheuren Ausstrahlung. Wenn er „Glockenspiel des Kreml“ spielte, dann glaubte man ihm, wenn er den Kommunismus pries. Weil er ein gelebtes Verständnis dafür hatte, das hat er einfach ausgestrahlt. Er war authentisch.
„Es war wie Hypnose!“ – Die Ausstrahlung des Künstlers
Hat Sie das Politische beeindruckt?
Nicht bewusst. Das war für mich einfach ein glaubwürdiger Mann. Ich hatte mit Politik überhaupt nichts am Hut. Also, Partei ergreifen wollte ich immer, aber in ’ner Partei sein wollte ich nie. Weil das ja genau das bedeutet hätte, was ich so verabscheue: den Zwang, „Ja“ zu sagen. Und zwar, nicht wenn ich es einsehe, sondern wenn die Ideologie es verlangt. Nach dem Motto: Jetzt muss „Ja“ gesagt werden, weil das offiziell wichtig ist, damit die Leute nicht alle nach dem Westen abhauen oder so. Und ich wollte gerne selber die Dinge einsehen, bevor ich ihnen zustimmte. An Busch hat mich deswegen auch weniger das Agitatorische interessiert, sondern ich fand ihn als Sänger, als Schauspieler und als Mann beeindruckend. Er war nicht nur vom Können her absolut ungewöhnlich, er war eine außerordentliche Person in seiner Arbeit.
Teilten Ihre Freundinnen oder Klassenkameradinnen diese Begeisterung?
Nicht auf diese Art. Bei mir war das …, das war wie Hypnose!
Sie haben Ernst Busch im Sommer 1952 persönlich kennen gelernt. Am Telefon haben Sie mir erzählt, dass es im Kino war …
Das war bei der Premiere von „Monsieur Verdoux“, dem Chaplin-Film, der damals im Marmorpalast gezeigt wurde. Vielleicht hatten die Leute vom Theater Vorzugskarten bekommen, jedenfalls waren sie nummeriert und ich weiß noch, dass links von mir Heinrich Kilger saß, der Bühnenbildner vom Deutschen Theater, und rechts von mir saß Ernst Busch. Und neben ihm saß, glaub ich, Fritz Erpenbeck, der Chefdramaturg war am Deutschen Theater. Ja, so saßen wir plötzlich nebeneinander. Der Kilger begrüßte die Kollegen und stellte mich vor, das war für mich alles ganz unwirklich …
Hat es da gleich gefunkt zwischen Ihnen und Busch?
Ja, das war ganz deutlich zu bemerken. Er hat die ganze Zeit immer wieder zu mir geguckt. Jahre später hab ich mal ein Foto gesehen von seiner ersten Frau, Eva Busch, und mir gedacht, dass er vielleicht irgendwas in mir gesehen hat, was ihn an die Eva erinnert hat. Ich meine, mich zu erinnern, dass ich ihm dann ein paar Tage nach dem Kinoabend geschrieben habe, dass ich im Theater bin. Und dann war er auch sofort nach der Vorstellung unten in der Kantine des Deutschen Theaters und hat mir seine Blumen, die er an dem Abend gekriegt hatte, in den Schoß gelegt. Wir haben uns dann öfter dort getroffen, manchmal auch schon vor der Vorstellung …
Musste das alles heimlich geschehen, oder sind Sie beide relativ offen damit umgegangen?
Naja, das war natürlich alles nicht ganz einfach und offen schon gar nicht. Es war wirklich sehr improvisiert. Eigentlich war es wie in einem schlechten Film … Andrerseits sind wir bei einer Riesendemonstration – ich meine, es war der Erste Mai, aber das kann ja vom Datum her kaum stimmen, doch, so muß es gewesen sein – Hand in Hand durchs Brandenburger Tor gelaufen. Zwischen Hunderten und Tausenden von Menschen. Das hat mich damals frappiert, weil ich dachte: „Er muss doch ganz behutsam und vorsichtig sein!“ Denn sonst hat er das mit uns sehr verdeckt behandelt; und plötzlich hatte das so was ganz Freies und Unbekümmertes. Die Sonne hat geschienen, und er war heiter und gelöst an diesem Tag. (…) Ich weiß nicht mehr, wann und wo und wie wir uns getroffen haben. Ich erinnere mich nur noch an diesen so unglaublichen Moment, als wir gemeinsam durchs Brandenburger Tor schritten. Das war noch vor den Theaterferien, denn danach fuhr er an die Ostsee.
Waren Sie verliebt in ihn?
Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Ich hab ’s natürlich gedacht, weil ich so was noch nie erlebt hatte. Es war etwas Magisches … und auch so unvorstellbar für mich, die ich da gerade aus der Provinz gekommen war … Plötzlich war ich dem Manne so nahe, den ich ein paar Wochen vorher noch aus dem Zuschauerraum angebetet hatte. Es war eine unwirkliche und auch eine …, ja, eine gefährliche Situation, in die ich da plötzlich gekommen war. All diese Leute, die ich aus der Ferne, also schon von Dessau aus, mit dem Guckrohr beobachtet hatte, waren auf einmal im wahrsten Sinn zum Anfassen nah. Ich hab dann bald gemerkt, dass meine Faszination vom künstlerischen Wirken dieser Persönlichkeiten nicht unbedingt identisch sein musste damit, wie sie sich im Leben zeigten. Durch Busch begegnete ich ja auch anderen Künstlern.
Haben Sie sich damals eher für reifere Männer interessiert, weil die schon was darstellten, was erlebt hatten?
Ja. Gleichaltrige waren meistens, wie das in dem Alter oft zwischen Jungs und Mädchen ist, nicht so spannend. Aber hier kam gelebtes Leben, gelebte Geschichte auf mich zu …
Worüber hat Busch mit Ihnen gesprochen?
Ich muss sagen: Es ist erstaunlich, wie wenig ich noch davon weiß. Ich stand offenbar die meiste Zeit neben mir und war unglaublich verspannt. Ich weiß aber noch, dass er sich damals um Erich Weinert gekümmert hat, der schwer krank war. (…) Was mir auch noch in Erinnerung ist: Er hatte schmerzhafte Komplexe wegen seiner Gesichtslähmung. Diese Verletzung, oder eher: Behinderung, war zwar dabei, sich langsam zu regenerieren, aber ihm war klar, dass seine Gesichtsmuskulatur nicht in dem Maß mitarbeiten konnte, wie er das gewohnt war. Er sprach sehr prononciert und man hat das eigentlich gar nicht gemerkt, dass sein Mund ein wenig schief war. Aber für ihn war das ein ganz großes Problem. Er sollte ja auch wieder filmen, was er lange ablehnte, bis Konrad Wolf es schließlich geschafft hat, ihn für „Goya“ zu gewinnen. Ich muss gestehen, dass mir diese Gesichtslähmung wahrscheinlich gar nicht aufgefallen wäre, wenn er nicht davon gesprochen hätte. Das war etwas, was sich in ihm festgesetzt hatte: dieses Gefühl, dadurch behindert zu sein.
Haben Sie versucht, ihm das auszureden oder ihm diesen Komplex zu nehmen?
Ich weiß es nicht mehr. Auf eine bestimmte Art hab ich das sicher probiert.
„Als Muhgruppe im Studio“ – Ferienjob bei Lied der Zeit
Wie lange ging diese Sommerliebe?
Das müssen etwa zwei Monate gewesen sein. Er fragte mich dann bald, ob ich bei musikalischen Proben in seiner Firma Lied der Zeit mitmachen wollte. Die war damals in einer Seitenstraße der Friedrichstraße. Da bin ich dann mit Lissy Tempelhof hingegangen. Das war während unserer Ferien und verteilte sich vielleicht über vier Wochen. Wir gingen zweimal die Woche zum Singen und bekamen ’n bisschen Geld dafür, was letztendlich als Grund für die Bestrafung durch die Schule herhalten musste. Wir waren Teil der sogenannten Muh-Gruppe, das waren die Stimmen, die im Hintergrund zu hören waren. Ich konnte nicht gut singen. Darum hab ich Lissy Tempelhof gefragt, ob sie mitkommen will. Lissy singt wunderbar. Und sie wollte genau wie ich Geld verdienen, weil sie auch wenig Mittel zur Verfügung hatte. Jedenfalls habe ich sie mitgenommen zu Lied der Zeit, damit wenigstens einer einen guten Eindruck macht. Ich kriegte stets Rippentriller von ihr, wenn ich anfing zu singen. Ich hab dann nur noch die Lippen bewegt, und sie hat geschmettert. Es waren noch andere in dieser Gruppe, aber die kannte ich nicht, sie waren nicht von der Schauspielschule. Busch hat Probenmitschnitte anfertigen lassen. (…) Dass ich überhaupt dabei war, war eigentlich nur ein Vorwand, damit Busch und ich uns sehen konnten.
Es ging eigentlich nicht ums Singen, sondern …
… um …. Nähe und …. dies und das …
Welche Lieder haben Sie gesungen?
Das waren eine ganze Reihe Lieder. Ich erinnere mich noch an „Die Ballade von der Judenhure Marie Sanders“.
Hat Lissy Tempelhof auch für Busch geschwärmt?
Jedenfalls hat sie ’s mir nicht gesagt.
Haben Sie Ihr damals gesteckt, dass da mehr bei Ihnen war als nur Bewunderung?
Sie wusste das. Aber ich müsste sie fragen, ob ich ihr das erzählt habe, oder ob sie ’s selber gemerkt hat. Komisch, ich hab das alles so tief verbuddelt in mir … (…) Ich bekam dann sogar Einzelunterricht und probte gemeinsam mit seinem Pianisten, den ich als alten Herrn in Erinnerung habe, wahrscheinlich war er gar nicht so alt …, kann sein, dass es Walter Goehr war. Ich stand dann am Flügel, sang irgendwas, und Busch kam dazu. Er nahm mich bei der Hand und ist mit mir durch dieses große Gebäude gewandert … (lacht) Es war ein unwahrscheinliches Erlebnis und zugleich eine schäbige Situation. Das war mein Problem mit der Geschichte. Deswegen war ich so stumm, was Busch sehr irritiert hat – dass ich so wenig sprach, ich fand absolut unwürdig, was da passierte. Und gleichzeitig wollte ich es nicht beenden, weil es eben so …. unwahrscheinlich war.
Sie sagen, es war unwürdig … Waren Sie zu dieser Zeit liiert und haben jemanden hintergangen?
Nein. Das meine ich nicht. Ich meine die Situationen, in denen wir zusammen waren. Wie wir diese Begegnungen gelebt haben. Das war nicht die Art Liebe, von der man träumt als junges Mädchen. Vielleicht hatte das auch mit meiner Erziehung zu tun, dass mir das unwürdig vorkam, ich weiß es nicht … Er war mein Idol. Das paßte nicht zusammen. Es war ….
War er Ihre erste große Liebe?
Das würde ich heute so sagen. Aber ich weiß nicht, wie weit da Rückschau und Verklärung ’ne Rolle spielen … Jedenfalls gab es davor keine Begegnung von Bedeutung.
Eva Busch schreibt in ihren Memoiren, dass Buschs Art, Liebe und Zärtlichkeit zu zeigen, darin bestand, dass er ihr die elektrischen Leitungen reparierte …
(lacht) Das war sicher eher als witzige Anmerkung gemeint. Ich glaube, es gab ’ne große sexuelle Anziehungskraft zwischen den beiden. Was sie meint, ist sicher, dass er nicht lange bei einem sitzen geblieben ist und zärtlich war, sich um einen gekümmert hat, einen bediente. In der Art. Das vermutlich eher nicht. (…) Dass er mir Schallplatten von sich und Blumen geschenkt hat, gefiel mir natürlich. Aber als schönstes Geschenk empfand ich, dass er mit mir zusammen durch die Straßen gezogen ist. Ich weiß noch, dass er dabei ziemlich unanständige, witzige Sachen gesagt hat. Es machte Vergnügen, sich auf seine Fantasien einzulassen, Und das, während wir aus einem politischen Anlaß marschierten! Das hatte schon was sehr Pikantes! Und war auch ein wenig surreal für das junge Mädchen, das ich damals war … Ich habe ihn herzlich und humorvoll erlebt. Ja…
Sie haben ihn in sehr liebevoller Erinnerung …
Ja, durchaus.
Bringen Sie das zusammen mit diesem kämpferischen, agitatorischen Ton, den er in seinen Liedern anschlagen konnte?
Ja, weil er glaubwürdig war.. Ich hab ihn bei der Arbeit erlebt, wo er um seine Texte, um seine Lieder kämpfte, um jede Nuance. Auch politisch war er absolut glaubwürdig für mich.
„Ein Erdbeben“ – Die Suspendierung von der Schauspielschule
Wie kam es nun zu Ihrer Suspendierung von der Schauspielschule? Christian Bleyhoeffer sagt, dass das ein großer Skandal gewesen sei …
Ich habe ihn neulich zufällig getroffen, da hat er mir gesagt, das sei wie ein Erdbeben in der Schule gewesen. Ich hab das damals gar nicht so empfunden. Vielleicht war ich noch zu sehr mit mir und dieser schwierigen Beziehung beschäftigt, die gerade zu Ende gegangen war. Ich sprach kürzlich mit Lissy Tempelhof über unseren Rausschmiss. Wir waren uns einig, dass hinter dieser Bestrafung Tete (Ernst Buschs Lebensgefährtin; JV) steckte. Es soll einen Beschwerdebrief von ihr ans Ministerium gegeben haben. Lissy Tempelhof hat mir sogar von einem Forum erzählt, das es gegeben hat, wo sie vor einer Gruppe von leitenden Mitarbeitern der Schule und von FDJ-Leuten niedergemacht wurde. Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. Entweder war ich nicht dabei oder ich war in der Situation komplett introvertiert und hab das kaum wahrgenommen. Ich glaube, der offizielle Grund für die Disziplinarmaßnahme der Schulleitung war, dass wir Geld für die Proben mit Busch genommen hatten. Solche Nebenjobs waren absolut untersagt. Ich musste dann Ende ’52 für ein Jahr „in die Produktion“, wie das hieß, und habe in Dessau als Punktschweißerin in einer Fabrik für Heizgasgeräte gearbeitet. Danach durfte ich zurück auf die Schule, mir wurde ein halbes Jahr erlassen, bekam allerdings ’54, als ich meinen Abschluss machte, kein Diplom, sondern nur einen Zettel, auf dem stand, dass ich die Schule von dann bis dann besucht habe. (…) Diese ganze Geschichte wurde offenbar von den Mitschülern als Skandal erlebt. Genau wie andere Geschichten, die in dieser Zeit Aufruhr verursacht haben an der Schule. Da gab es zum Beispiel den Studenten Hartmut Reck. Er war West-Berliner, man konnte damals ja noch hin und her, und er kam eines Tages mit kahlgeschorenem Kopf in die Schule. Ein Zeichen seiner Reue für irgendeine Unbotmäßigkeit, die man ihm vorgeworfen hatte. So was hatte es nie zuvor gegeben, dass jemand, wie das heute ja durchaus üblich ist, aus Protest mit ’ner Murmel ankam. Das war ein Riesenskandal, Reck wurde suspendiert und durfte ’n halbes Jahr nicht kommen.
Hätte der nicht ’ne Mütze aufsetzen können?
Genau das wollte er nicht. Er wollte quasi mit dem Kopf durch die Wand. Ich meine zu erinnern, dass er im Deutschen Theater eine kleine Rolle spielte. Was „naturgemäß“ verboten war. (…) Oder 1954: wir wurden zur gleichen Zeit schwanger, drei der attraktivsten Mädchen von der Schule. Da gab ’s einen Aufschrei, wir waren im letzten Studienjahr und nun schwer vermittelbar. Es wurde eine Riesenkonferenz einberufen mit dem Ergebnis, dass ein Experte für Sexualverhalten geholt wurde, der uns einen Vortrag über die Vorzüge des Verhüterlis hielt. Die Pille gab ’s ja noch nicht. Wir saßen da und haben gekräht: „Zu spät! Zu spät!“ (lacht) Ja, daran ist dann auch mein direkter Einstieg in den Beruf gescheitert. Ich hatte sehr schöne Angebote. Aber als ich dann sagen mußte, dass ich schwanger bin und erst ’n paar Monate später anfangen könnte, haben alle Interessenten sofort ’nen Rückzieher gemacht. Herr Ruschin und Herr Wisten von der Volksbühne sagten: „Sie müssen das verstehen, wir sind hier Vollmänner!“
Vollmänner? Was sollte das heißen?
Naja, dass sie potente Kerle sind und eine schwangere Blondine nicht recht in ihr Konzept passte. Das ist die einzige Erklärung, die mir dazu eingefallen ist in den letzten 50 Jahren. Die führenden Kader suchten sich gern die attraktiven Blondinen aus. Damals wie heute.
Aber Sie waren doch eine attraktive Blondine.
Ja, aber schwanger. Ich bin erst mal drei Jahre ausgestiegen, um meine Tochter bis zu ihrem dritten Lebensjahr zu begleiten, und dann erst zurück ans Theater.
Entschuldigen Sie, wenn ich noch mal indiskret frage: War Verhütung ein Thema zwischen Ihnen und Busch?
Nein, merkwürdigerweise überhaupt nicht. Das hätte dumm laufen können, wie man heute sagt. Ich war so naiv, dass ich fest der Meinung war, wenn ich nicht will, werde ich auch nicht schwanger. Diese Idee hat sich ja dann später als wenig tragfähig erwiesen (lacht) …
„An die Ostsee gekarrt“ – Der Domprediger Karl Kleinschmidt
Haben Sie im Sommer ’52 eigentlich auch Bekannte oder Freunde von Busch kennen gelernt?
Ich erinnere mich noch an Karl Kleinschmidt, er war Domprediger in Schwerin. Busch hat in diesem Dom, so weit ich weiß, die Weihnachtsgeschichte gelesen, es muss einen Mitschnitt davon geben. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich dabei war oder ob ich das so gespeichert habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es gibt doch Projektionen, die sind so intensiv, dass man nicht mehr hundertprozentig unterscheiden kann zwischen Erzähltem und Erlebtem … Jedenfalls wollten Lissy und ich zu diesem Zeitpunkt an die Ostsee, wir hatten wenig Geld, Busch hatte das gestöpselt und zu Kleinschmidt gesagt: „Du wohnst doch da oben, kannst Du den Mädchen nicht helfen?“ Kleinschmidt sagte: „Ja, klar, wenn sie ’s bis Schwerin schaffen …“ Wir sind dann da irgendwie hingefahren, und von Schwerin aus hat uns der Kleinschmidt mit seinem Auto an die Ostsee gekarrt. Mir war gar nicht bewußt, wie außerordentlich das war.
Sind Sie mit Lissy Tempelhof heute noch befreundet?
Ja, wir haben sozusagen lebenslänglich miteinander. Das Verhältnis hat sich über die Jahrzehnte immer wieder verändert, aber stets gehalten.
Wie ist die Geschichte mit Busch ausgegangen? Hat er irgendwann Schluss gemacht?
Ich denke, die Kräfte, die bei ihm zu Hause wirkten, haben sich durchgesetzt.
Haben Sie Tete mal kennengelernt?
Nein. Ich habe nur später die Todesanzeige gelesen. „Margarete Körting“ stand da, und in Klammern dahinter: Tete.
Haben Sie so etwas wie Eifersucht empfunden ihr gegenüber?
Das konnte ich nicht … Es stand mir nicht zu, so empfand ich. Sehen Sie, daran erinnere ich mich jetzt doch: Er hat mir mal erzählt, dass er so krank war, als er aus dem Zuchthaus Brandenburg kam, und dass Tete ihn unter unglaublichen Mühen und Opfern, wie er sagte, aufgepäppelt und wieder gesund gepflegt hat. Und dass er sie deswegen unmöglich verlassen könnte …
… und dass er vor allem auch aus Dankbarkeit noch mit ihr zusammen war?
Ja. Deswegen war ich auch nicht eifersüchtig. Ich hatte den allergrößten Respekt vor dieser Frau. Die Gelegenheit zu dieser Leistung, die habe ich ihr vielleicht geneidet, ja … Ich weiß nicht, wie sich die Zwei kennen und lieben gelernt haben … Wie alles zusammenhing, weiß ich nicht.
„Mit Telegrammen attackiert“ – Das Ende der Beziehung mit Busch
Hat Busch sich von heute auf morgen nicht mehr bei Ihnen gemeldet?
Er hat sich nicht mehr gemeldet. Ich hab ihn noch attackiert mit Telegrammen, die ich ihm in seine Wohnung geschickt habe und sogar in seinen Ferienort an der Ostsee. Ich wusste damals, wo er Urlaub machte. Ich dachte, wenn ich als Adresse „Ernst Busch“ schreibe und den Ort, dann würde das genügen. (…) Ich stand in dieser Zeit absolut unter Strom, das war ’ne Horrorsituation für mich: so ganz ohnmächtig zurück zu bleiben ohne zu wissen, was sein wird.
Waren Sie sauer auf ihn?
Ich weiß nicht, ob ich sauer war. Verzweifelt und ohnmächtig war ich.
Sie waren damals 18 Jahre alt. Haben Sie überlegt, sich etwas anzutun?
Nein.
Haben Sie nach den Ferien noch mal versucht, ihn im Theater zu treffen oder ihm Nachrichten zukommen zu lassen?
Nein, nie mehr.
Das heißt, nach den Theaterferien war das Ganze für Sie beendet …
Ja, absolut.
Haben Sie sich seine Platten später noch anhören können?
Nein. Ich wusste bis vor kurzem nicht mal mehr, dass ich die noch habe. Aber als sie kürzlich anriefen, habe ich in eine meiner Kisten geschaut und entdeckte sie. Ich muss das alles sehr in mir vergraben haben …
Welche Musik haben Sie ansonsten gerne gehört, als Sie auf der Schauspielschule waren?
Ich hörte die Musik, die aus dem Radio kam. Aber meine Liebe galt schon damals den alten Meistern. Ich hab die Carmina Burana gehört, als Scherchen zurückkam aus Amerika und die erste Aufführung machte. Ich ging zum Neujahrskonzert, wenn Beethovens Neunte von Abendroth dirigiert wurde. Das war, wohin es mich zog. Ich mochte auch große Aufführungen von Kirchenmusiken, Oratorien … Ich tanzte nicht. Ich war kein Mensch, der diesen Brauch schätzte. Ich bin einmal, da war ich sehr jung, zum Tanzen gegangen, und nachdem mir klar wurde, dass man aufgefordert wird als Mädchen und nicht selber die Wahl hat, bin ich nicht mehr hingegangen. Jedes Mal die Kraft aufzubringen und Nein zu sagen – das war nicht mein Ding. Auf der Schule, na gut, da haben wir schon manchmal getanzt bei Festen …
Haben Sie Busch eigentlich noch mal wieder gesehen?
Ja, einmal. Ich war zu seinem 75. Geburtstag in seinem Haus in der Leonard-Frank-Straße in Pankow. Da war ein Kommen und Gehen, das war wie Jahrmarkt. Er war dann sehr streng mit seinen Gästen: Mittags war Schluss, weil er sich dann ausruhen musste. Er war gesundheitlich schon angegriffen, hatte sich den Vormittag verausgabt, unentwegt Platten und Bänder abgespielt und Hände geschüttelt. „Naaaa, was wollt Ihr alle hier?!“ Ich weiß bis heute nicht, ob er mich erkannt hat. Er hat ab und zu so merkwürdig zu mir rübergelächelt, aber ich hatte keine Ahnung, was da in ihm vorging. (…) Auf der Bühne habe ich ihn noch ein paar Mal gesehen. Unvergessen ist mir der Galilei. Diese Aufführung hatte für mich eine große Strahlkraft. Mit dem Stück und der Besetzung Busch – da entstand sicher sehr bewusst eine Deckungsgleichheit der Biographien. Diese wunderbare Sturheit und Gelassenheit, aus der heraus er mit und als Galilei sagt: „Und sie bewegt sich doch!“ Das war erschütternd. Die Weisheit eines verletzten Menschen, der Zweifel an dessen Wissen und Erkenntnissen – das war Busch, das war auch sein Leben, sein Konflikt mit der Partei!. Der würdevolle verletzte Mensch, der da oben auf der Bühne stand … wenn der schweigt, also am Schluss schweigend isst, dann ist das Ausdruck von Widerstand. Ein stiller, starker Widerstand. (…) Etliche Theater-Fachleute hatten nicht erwartet, dass er das darstellen kann: diesen großen wissenschaftlichen Geist gepaart mit Güte und Weisheit, aber auch unbeugsamer Zähigkeit, der da sagt: „Und sie bewegt sich doch!“ – Phänomenal! Das waren Sternstunden des Theaters … (…)
Hat Busch Sie zum Lachen gebracht?
Zum Schmunzeln, würde ich eher sagen. Zum Lachen war ich, jedenfalls bei unseren privaten Begegnungen, zu angespannt. Das war ja auch, was mich sehr unglücklich gemacht hat, dass ich mich nicht präsentieren konnte als die, die ich damals meinte zu sein. Deswegen konnte ich das Zusammensein nur halb genießen. Ich musste das nach unseren – wenigen – Begegnungen erst für mich bearbeiten. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich das Erlebte so heftig verdrängt habe … Weil ich es gerne anders gelebt hätte.
Haben Sie der Beziehung jemals ’ne Chance gegeben?
Nein. Nie. (…)
War Busch impulsiv und aufbrausend?
Das sagen viele. Ich hab das nicht erlebt. Ungeduldig: ja, um Qualität und um einen spezifischen Ausdruck bemüht: sicher. Das hab ich auf diesen musikalischen Proben mitbekommen, aber er war da ungeduldig mit sich selber oder auch mit den anderen Beteiligten. Aber Aufbrausend-Sein im negativen Sinn war das nicht. Schöpferische Ungeduld könnte man das nennen. (…)
„Heute ist man stolz auf mich!“ – Verhältnis zur Schauspielschule
Lassen Sie uns noch mal kurz über Ihre Schauspielschule sprechen. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie, als Sie ’54 fertig mit der Schule waren, zur Strafe kein Diplom bekommen haben. Hat man Sie eigentlich zum 100jährigen Jubiläum der Schauspielschule eingeladen?
Ja, natürlich.
Da saßen Sie dann in der ersten Reihe?
Ja, ja. (lacht) Heute ist man stolz auf mich. Lachen muss ich auch über die Geschichte der Angelika Waller, eine sehr namhafte Schauspielerin zu DDR-Zeiten im Film und am BE. Heute lehrt sie an der Ernst-Busch-Schule und ist eine der herausragenden Fachfrauen dort. Professorin für Schauspielkunst. Ausgerechnet sie hat damals die Aufnahmeprüfung an der Schule nicht bestanden …
Sie haben sich auch vor einigen Jahren als Journalistin erneut mit Ihrer alten Schule beschäftigt. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie nach dem Buchhandel und der Schauspielerei diesen dritten Berufsweg eingeschlagen und angefangen zu schreiben haben?
Was an der Schule in all den Jahren los war, wusste ich eigentlich immer, weil ich auch zu DDR-Zeiten Kontakt zu den Dozenten hatte und über manche auch Porträts für die Weltbühne geschrieben habe. Ja, wie kam ich zum Schreiben? Das war ’61, ’62, ’63 – ich war gerade als Schauspielerin am Deutschen Theater engagiert worden, es gab durch den Bau der Mauer Vakanzen, denn etliche Schauspieler, die West-Berliner waren, durften nun nicht mehr im Osten arbeiten. Damals war Benno Besson am Deutschen Theater, er machte diese berühmte-berüchtigte Inszenierung „Die Sorgen und die Macht“ von Peter Hacks. Das war auch so ’n politischer Eklat in der DDR, weil da sehr kritisch mit dem Verhältnis Staat-Regierung- Arbeiterklasse umgegangen wurde. Ich war mit einer kleinen Rolle besetzt und Benno Besson hatte mitgekriegt, dass ich mich nebenbei bei Jean Villain, dem Schweizer Publizisten, der für die Weltbühne schrieb, mit literarischer Reportage beschäftigte. Besson sagte damals zu mir: „Tanze nicht auf zwei Hochzeiten!“ – „Sonst geht es dir am Ende wie dem Esel zwischen zwei Heuhaufen, am Ende verhungerst du, weil du dich nicht entscheiden kannst!“ Und da meine Position am Deutschen Theater ohnehin noch wenig profiliert war und ich Lust hatte „Ich“ zu sagen, habe ich mich fürs Schreiben entschieden.
„Nu‘ is‘ aber genug!“ – Karriere als Journalistin und Fernseh-Autorin
Hatten Sie nicht das Gefühl, eine Karriere weg zu werfen?
Nein, nie. Das hatte ich in meinem ganzen Leben nicht. Es ist überhaupt phantastisch, wie die Teile meiner Ausbildungen später zusammen paßten … Es war nicht einfach, aber mir ist viel von dem zugeflogen, worum andere ein Leben lang streben, um an diese Stelle oder jenen Platz zu kommen. Es kam immer das rechte Ding zur rechten Zeit. Ich hatte damals gleich einen aufregenden Einstieg, hatte mein erstes Fernsehspiel geschrieben, was sehr erfolgreich war. Und da meinte die Leitung des Deutschen Theaters: „Nu‘ is‘ aber genug!“ Mein Mann fand mich völlig übergeschnappt, er hat gedacht, er hat ’ne Hochstaplerin geheiratet und sagte damals: „Wie kommst du denn dazu? Du kannst das doch überhaupt nicht!“ Ich dachte, das stimmt eigentlich. ich hatte ja wirklich keine fundierte Basis. Also habe ich dieses Fernstudium an der Leipziger Hochschule für Journalistik angefangen, da hat mir aber ein Jahr vollkommen gereicht: Wir haben dort Stilistik anhand der Texte von Clara Zetkin gelernt! Ich meine, sie war eine wunderbare Frau, ’ne tolle Politikerin, aber Schreiben … Man hätte Stilistik anhand der Texte von Rosa Luxemburg lernen können, aber sie war ja …, ihre Arbeiten gehörten auch zu den Reizthemen, die in der DDR zu vermeiden waren.
Und die Reportagen und Feuilletons von Kisch und Tucholsky?
Die haben wir uns dann bei Jean Villain vorgenommen. Er wurde von der Neuen Berliner Illustrierten angeheuert, das war die einzige Illustrierte in der DDR, und Villain sollte Nachwuchs ausbilden für die Literarische Reportage im Sinne von Kisch. Diese Form sollte wieder belebt werden, um gesellschaftliche Prozesse in der DDR aufzudecken, kritisch zu begleiten. Das geschah in der sogenannten Tauwetter-Periode. Alle Reportagen, die wir in diesem Kurs entwickelt haben, sind gleich in der NBI publiziert worden. Wir waren sehr erfolgreich. Wir, das waren: Landolf Scherzer, Klaus Schlesinger und ich. Der Erfolg war bemerkenswert, aber kurz. Ende des „Tauwetters“, Ende der Literarischen Reportage. Ich arbeitete danach mehr als ein Jahrzehnt für Die Weltbühne. Dort konnte man noch bis circa 1980 „Ich“ sagen in der Berichterstattung.
Waren Sie in der SED?
Nee, nie. Nicht mal in der Gewerkschaft. Das war möglich, weil mein Status „Freischaffende“ mir erlaubte, mich jedem ideologischen Druck entziehen zu können. Ich hatte durch meine Themenwahl auch das Glück, reisen zu können. Ich war als Reporterin in Mittelasien, in Indien und überall in Europa… Ein Wunder. So dachte ich.
Gerade dieser Status des Freischaffenden muss doch in der DDR suspekt gewesen sein …
Ja, sicher. Aber diese Möglichkeit entsprang purer Taktik der leitenden Gremien der Printmedien und des Fernsehens. Ich habe das später in meiner Akte nachgelesen. Damit wurde sozusagen ausgestellt: „Guckt mal, wie goßzügig und weltoffen wir sind! Wir lassen eine Parteilose durch die Welt reisen!“ Nur ich hab das damals nicht durchschaut, dieses Prinzip. Ich hab auch erst viel später erfahren, dass die Fernsehfilme, die ich geschrieben hatte, in 80 Länder verkauft wurden. Ich wurde daran nicht finanziell beteiligt! Wir wurden zum Beispiel in Schweden und in der Schweiz mit Preisen ausgezeichnet. Das hat man uns, der Regisseurin und mir, nicht mitgeteilt. Wir wurden zu einer Diskussion über unsere Arbeit „Die Gesetzesfalle“ vom ZDF eingeladen. Die Produktion hatte dort die Auszeichnung „Fernsehspiel des Monats“ erhalten. Wir erfuhren das nicht offiziell, durften nicht reisen, wurden verleugnet, „Nein, Frau Dessau ist gerade im Ausland, die Regisseurin ist auch nicht da, die ist unabkömmlich.“
„Nitroglyzerin, das auf den Boden tropft“ – Problematische Texte
Fürs Fernsehen zu schreiben, war zu dieser Zeit längst Ihre Hauptbeschäftigung …
Ja, seit Ende der 60er Jahre habe ich das hauptsächlich gemacht, 90 Prozent meiner Arbeit würde ich sagen. Ich schrieb für die Weltbühne, habe zwischendurch Features für den Rundfunk gemacht, mal ein Hörspiel geschrieben. Es ist nicht alles realisiert worden. Beim Fernsehen hat man zum Beispiel von 1980 bis 1990 kein Drehbuch von mir verfilmt. Damals durchschaute ich nicht, was da gegen mich lief, weil ich permanent – stets freischaffend! – beschäftigt war. Wenn ich gesagt habe „Ich will jetzt an dem und dem Stoff arbeiten“, hieß es: „Ja, wunderbar, mach das!“. Ich hab ’nen Vertrag gekriegt und angefangen zu arbeiten. Und alles, was ich schrieb -(über Mühsam, die Luxemburg, eine erfolgreiche Physikerin, das Schicksal der Kinder vom Bullenhuser Damm), fanden sie dann irgendwie suspekt. (lacht) Meine Sachen seien „wie Nitroglyzerin, das auf den Boden tropft“. Aber ich war nicht bereit, meine Texte substantiell zu verändern. Ja, und dann wurde mir gesagt: „Hm, das machen wir später, jetzt hat der Thälmann-Film Vorrang … – Das war auch eine makabre, aber zeichenhafte Situation: Irgendwann in den 80ern hat ein Leitungsteam Fernsehen bei mir in der Küche gesessen und mich bekniet, diesen Thälmann-Film zu schreiben, der Nationalpreis wäre mir sicher. Da gab ’s noch gar nichts außer der Idee. (…)
Wie haben Sie sich verhalten?
Ich wollte das nicht. Ich hatte gerade meinen Rosa Luxemburg-Film geschrieben. Und nach dem, was ich mit diesem Stoff erlebt hatte, hab ich ganz klipp und klar gesagt: Ich bringe Thälmann nicht ein zweites Mal um!
Was hatten Sie mit dem Rosa Luxemburg-Stoff erlebt?
Na, dass sie gesagt haben: „Das ist nicht unsere Rosa!“ Und wenn es hieß „Das ist nicht unsere …“, dann war eine Sache gestorben. Es durfte nicht sein, dass man einen eigenen Blick auf eine Geschichte oder eine historische Figur hatte. Dass ich so viele historische Figuren genutzt habe, hatte ja den Grund, dass sie nicht so leicht durchschauten, was ich mit dieser Geschichte aus der Vergangenheit über die Gegenwart erzählen wollte. Da waren sie manchmal nicht clever genug.
Bei Thälmann hätten sie dann gesagt: „Das ist nicht unser Teddy!“
Ja. „Das ist nicht unser Teddy!“ – Auch die Umstände seines Todes, dass die Russen sich geweigert haben, ihm zu helfen, das wäre alles verschwiegen worden und wurde auch alles verschwiegen.
Obwohl das längst Stand der Forschung war …
Ja, sicher wusste man das. Aber das machte man nicht öffentlich, und schon gar nicht in einem Film.
Eigentlich albern.
Nein, Geschichtsfälschung! Albern – das trifft´s nicht. Wenn ich mich an meine ersten Lesungen in Westberlin und Westdeutschland mit Prosa-Arbeiten von vor zehn Jahren erinnere, da hab ich den Leuten erzählt, dass dieses und jenes in der DDR nicht erscheinen durfte aus diesen und jenen Gründen. Das hat im Publikum kaum jemand verstanden. Ein Zuhörer fragte mich: „Was ist denn daran brisant?“ Das ist nicht nachvollziehbar, das ist eigentlich zum Lachen heute – damals war ’s zum Totlachen. Und ich konnte mir diese Haltung „Nein“ zu einem Angebot zu sagen, locker leisten, weil mein Mann gut verdienender Schauspieler am Maxim Gorki Theater war und es bei uns keine Brotnot gab. Er hat immer gesagt: „Einer in der Familie soll wenigstens machen, was er will.“
Hat er nicht gemacht, was er wollte?
Naja, als fest Angestellter am Theater musste er schon manchmal in Gegenwarts-Stücken ’nen Parteisekretär oder Gewerkschaftsfunktionär mit irgend ’nem tönernen Text spielen. (…) Ich habe 1980 auch aufgehört, für die Weltbühne zu schreiben. Hermann Budzislawski, der Chefredakteur, den ich noch von meinem Leipziger Studium kannte, er war damals Dekan, wurde abgelöst durch Peter Theek. Und plötzlich lag das Blatt, das bis dahin das freieste war in diesem Land, in dem man wirklich „Ich“ sagen und seine Meinung schreiben konnte, absolut auf Parteilinie. Auf einmal wurden Texte ohne Rückfragen umgeschrieben: Ich las dann einen Beitrag von mir, bei dem die Aussage komplett auf den Kopf gestellt worden war. Da hab ich gesagt: „Gut, dann eben nicht mehr.“ (…)
Waren Sie enttäuscht, dass Ihr Radius eingeschränkt wurde?
Sicher gab es Enttäuschungen. Gerade beim Fernsehen: Ich hab zum Beispiel die Biografie einer Frau verarbeitet, die Widerstandskämpferin in der „Roten Kapelle“ und verfolgt war während des Faschismus. Ich habe also ihre Biografie nutzend und verschiedene Ereignisse verbindend eine fiktive Geschichte fürs Fernsehen geschrieben. Diese Frau war dann empört, weil ich ihre Figur anders weiter führte, als ihr Lebensweg verlief. Der Film war aber – wie gesagt – als Fiktion gekennzeichnet, es hieß: „Nach der Lebensgeschichte von Frau Sowieso.“ Sie ist dann zur Parteileitung gegangen und hat sich dort beklagt, daß mir politisch nicht zu trauen sei und ich bei Diskussionen mit Jugendlichen in unserem Wohngebiet …
Was für Diskussionen hatten Sie denn mit Jugendlichen geführt?
Man hat mir sozusagen unterstellt, dass ich die jungen Menschen gegen den Staat aufhetzen wüde, weil ich sie ermunterte, in der Schule sich nicht als Schafe im Lernprozeß zu verhalten, sondern offen ihre Meinung zu sagen. Dass viel Ungemach daher rührt, dass wir keine Zivilcourage zeigen. Es waren Schüler, vielleicht zehnte Klasse, also etwa 16 Jahre alt, die zu mir kamen, und mich fragten, wie sie sich verhalten sollten: Sie seien in der Schule dazu verurteilt zu lügen, dann sei ihnen eine gute Zensur sicher. Die hatten Fernseharbeiten von mir gesehen und offenbar den Eindruck von Integrität gewonnen …
Nach der Wende haben Sie eine weitere Karriere gestartet, und zwar als Buchautorin …
Ja. Im Rückblick auf mein Arbeitsleben war ich versöhnt, dass ich so viele Arbeiten öffentlich hatte machen können. Ich konnte mir nicht vorstellen, weiterhin Gelegenheit zur Publikation zu haben. Jetzt bist du Ende 50, dachte ich, auch gut, das war´s dann eben und schrieb trotzdem weiter. Es lief ganz anders, plötzlich und überraschend. Eine Abteilung beim Fischer-Verlag, zu welcher ich ein Manuskript geschickt hatte, weil ihr Leitmotiv „Frau in der Gesellschaft“ hieß, hatte meinen Text zur Veröffentlichung vorgeschlagen. Die zuständige Redakteurin hatte jeden Monat 400 Manuskripte auf ‚m Schreibtisch liegen. Sie konnte im Jahr lediglich zwölf Bücher machen, also quasi jeden Monat eins auswählen. Und ich kannte niemanden beim Verlag. Ich dachte wegen dieses Frauen-Labels passen meine Geschichten über historische Frauen gut rein. Die Redakteurin, Frau Ingeborg Mues, hat das tatsächlich rausgefischt. Das erste Buch hieß „Spurensuche“, und dann ging das so weiter: Immer wenn ich ein Manuskript abgeschlossen hatte, hat sie ’s herausgegeben. Einfach so: „Abschied von Buddenhagen“ und „Anna tanzt“, “Spurensuche“, drei oder vier Bücher waren es. Ich hab damit kein Geld verdient, aber das war nicht entscheidend, ich hatte ja meine klitzekleine Rente. Wir Freischaffende aus DDR-Zeiten erhalten nur die Hälfte unseres erarbeiteten Geldes. So ist es „im Vereinigungsvertrag festgeschrieben“, lautet die Begründung. Ich hab dann angefangen, eine Fernsehserie im Auftrag eines namhaften West-Berliner Produzenten zu schreiben, damals. Das war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich richtig dicke Kohle verdient habe, als ich für diese Firma Serie geschrieben habe …
Was denn für ’ne Serie?
„Frauenarzt Dr. Markus Merthin“ (lacht) – die stammt von mir. Da lebe ich heute noch von!
Wer hat den gespielt, den Frauenarzt?
Ach, dieser schöne Softie, der in der Schwarzwaldklinik den Sohn gespielt hat …
Nein! Sascha Hehn?
Genau, Sascha Hehn.
Das ist ja grauenhaft.
Furchtbar! Aber das weiß man ja nicht beim Schreiben. Ich schrieb den Pilotfilm und vier weitere Teile, dann wurde ich schmerzhaft ausgebootet. Es fing damit an, dass der Produzent dauernd reinredete, so ähnlich wie beim DDR-Fernsehen, da hat stets die Parteileitung reingeredet. Ich sagte einmal kühnerweise zu dem Produzenten: „Also, das kenn ich nun zur Genüge. Damals hat mich die politische Macht zu manipulieren versucht, heute ist es die Geldmacht. Das will ich nun nicht mehr!“ Da haben sie mich nicht mehr beschäftigt. Ich fand das dann auch gut, weil ich merkte: Das wär mir nicht bekommen auf Dauer – hat man erst mal so richtig Geld im Beutel, möchte man das nicht mehr missen. (lacht) (…) Das versaut einen … Ich hab für meine Verhältnisse gut verdient, für jeden Teil hab ich 20.000 D-Mark gekriegt, und so ein Teil musste ich innerhalb von 14 Tagen liefern. Das ging alles unglaublich schnell, schrummmm, immer raus, immer raus – alles, was ich an Geschichten gehortet hatte in mir. Wie ein Ausverkauf. (lacht) Wie Sie nun wissen, habe ich mich davon wieder erholt.
Interview: Jochen Voit
Foto: Marie Alice Bahra
(Textfassung autorisiert von Anne Dessau am 4. März 2006)

Nina Alexandrowna Dymschitz
über die freundschaftliche Beziehung ihres Vaters Alexander Dymschitz zu Ernst Busch
„АЛЕКСАНДР ДЫМШИЦ: ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ В ДВУХ ТОМАХ
ТОМ ВТОРОЙ. Звенья памяти. ПОРТРЕТЫ И ЗАРИСОВКИ“
(Москва («Художественная литература») 1983)
СЛОВА ЛЮБВИ И БЛАГОДАРНОСТИ‘
Издательство «Советский композитор» выпустило книжку известного музыковеда и композитора Г. Шнеерсона «Эрнст Буш». Это очень хорошая книга, умно, обстоятельно и любовно повествующая о замечательном немецком революционном артисте и народном певце, о его героической жизни борца за коммунизм, о его вели¬колепном творчестве.
Книга Г. Шпеерсона заставила меня многое вспом¬нить — вспомнить и разволноваться. Я вновь и вновь испытал чувства огромной любви и благодарности к на¬шему (да, к нашему!) Эрнсту Бушу, Хочется, чтобы частичка этого волнения передалась читателю.
‚ «Литературная Россия», 1963, 5 апреля; 1967, 25 августа.
Впервые я видел и слышал Буша в середине 30-х годов. Он приехал к нам, а из СССР уехал в Испанию, на фронт гражданской войны. Был он тогда молод, стро¬ен, красив той красотой рабочего человека и воина ре¬волюции, которая отличала среди немцев людей тельмановской гвардии. Я слышал, как он пел, и был потрясен и просветлен. Он пел песни па слова Мюзама, Тухольского, Брехта, Вайнерта, песни Ганса Эйслера. Он заста¬вил нас смеяться. Внезапно, как по команде, поднимал он с мест целый зал — и казалось, он тут же мог повести нас на баррикады, в атаку, в бой.
Потом я долго не видел Буша. Он сражался в Испа¬нии, томился во французском концлагере, его захватили гитлеровцы, судили, он был заключен в немецкую тюрь¬му, где его тяжко ранило во время бомбежки. Весной 1945 года мы встретились с ним в Берлине, где еще ды¬мились руины и на каждом шагу виднелись следы вой¬ны. Советская Армия освободила Буша из заключения. Он сразу же встал в строй бойцов за новую социалисти¬ческую Германию.
И снова — голос Буша. Этот удивительный голос, ча¬рующий и грозный, иронический и призывный, лириче¬ский и трагедийный, звучал с прежней, несломленной си¬лой. Он опять заставлял учащенно биться сердца, снова повелевал сотнями и тысячами. Буш пел песни о рабо¬чей борьбе, об интернациональной солидарности, о боях в Испании и о русской революции, он звал немецкий народ строить новое отечество, он издевался над запад¬ногерманскими империалистами и над американскими колонизаторами.
Мы часто встречались с Эрнстом в течение почти че¬тырех лет. Мы дружили. Недавно, листая вырезки из старых газет, я увидел пожелтевшие снимки. Вот мы стоим в дружеской беседе — два силуэта; вот мы вместе с Бушем, Фридрихом Вольфом, Вилли Бределем, Гюнте-ром Вайзенборном на открытии театра Народной сцены. Вот западная газета, в которой Буша пытались «уколоть» нашей дружбой: он-де поет арии из оперы Вебера «Дымщиц» (перелицовка названия оперы «Фрейшютц» — «Вольный стрелок»). Помню, мы смеялись над этой де¬шевой остротой.
Сколько раз я подпевал ему вместе со всем залом! Сколько раз счастливый и обновленный, выходил я с его концертов! И теперь, когда он далеко от меня, я люблю слушать пластинки с его чудесным го¬лосом.
В 1958 году мы, группа советских литераторов, были в гостях у Буша. Мы слушали новые записи его песен. Многое я знал и раньше, но вдруг мне открылось новое в его таланте. Он пел фольклорные, народные песни, пел песни Гете и Бетховена, Бехера и Эйслера, баллады с собственными текстами. Как сильно, как драматично и мудро пела в этих песнях народная душа!
Г. Шнеерсон хорошо рассказывает о Буше — великом драматическом артисте. Для Буша нет рамок амплуа. От напряженнейшей трагедии до комедийного гротеска — таков его диапазон. Я видел его в «Фаусте» умнейшим и изящнейшим Мефистофелем, в «На дне» — поэтом гу¬манизма Сатиным, в «Кавказском меловом круге» Брех¬та — лиричнейшим певцом и комичнейшим судьей, в «Матросах из Катарро» Вольфа — волевым, стремитель¬ным и энергичным революционером. В «Жизни Галилея» Брехта Буш шел по всем кругам жизни человека, он «пережил» эту жизнь вместе со своим героем и заставил нас сопереживать трагедии великого ученого. А его ге¬роические роли — Павел Власов в «Матери», Юлиус Фу¬чик в спектакле «Прага остается моей», председатель укома в «Шторме»,— сколько в них боевого реализма и революционной романтики!
Вспоминаю приезд Буша в Москву и Ленинград весной 1957 года. Тогда он гастролировал с брехтовским театром «Берлине? Ансамбль». Я просил его выступить в один из свободных вечеров в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Буш, конечно, согласился. Он радовался каждой встрече с советскими друзьями. Днем ему нездоровилось, но на вечер он приехал. Я тре¬вожился — человеку под шестьдесят лет, за плечами та¬кая жизнь, он утомлен, ему, должно быть, трудно… Но вот заполняется большой зал института. Буш заглянул в него, повеселел, усталость мигом исчезла. На сцене стоял молодой, красивый, веселый, обаятельный человек. Он пел, ему подпевали, это был вечер большой, сердеч¬ной дружбы.
А я смотрел па Эрнста, па сына кильского рабочего, сына немецкого трудового народа, и вспоминал чудесные слова Энгельса о герое‘ «Нибелунгов» Зигфриде — немец¬ком юноше, прекрасном, смелом, отважном, справедли¬вом молодом герое, о Зигфриде — представителе немецкой молодежи. «Родина Зигфрида» — так назвал свою статью Энгельс. Я думал и чувствовал — родина Зигфри¬да взрастила и воспитала Эрнста Буша, он ее сын, это она послала его в революционные бои за счастье немец¬кого народа и всего человечества.
Я прочитал книжку Г. Шнеерсона, и из сердца моего вырвались слова любви и благодарности Эрнсту Бушу. Никогда не посмел бы я обнародовать их, если бы не знал, что эти слова, эти чувства не только мои, а многих и многих. У Буша много друзей в нашей стране. Я знаю, что этот мой привет отзовется и в сердце советского сол¬дата, который весной 1945 года, встретив идущего из тюрьмы Буша и узнав его, пел вместе с ним «Песню единого фронта». Я знаю — у Буша тысячи советских друзей, умеющих ценить его беззаветную любовь к со¬ветскому народу.
Хочется сказать спасибо Г. Шнеерсону за его хоро¬шую книгу об Эрнсте Буше.— Ты, конечно, навестишь Эрнста? — спросил меня старый товарищ Ганс Роденберг.
— Я уже был у него. И буду еще,— ответил я Гансу.
Эрнст Буш — моя старая любовь, крепкая любовь наших советских людей,— человек, которому почта всег¬да приносит письма от восторженных почитателей со всех концов Советского Союза.
Не буду рассказывать о том, кто такой Эрнст Буш,— у нас это хорошо известно. Скажу лишь о том, как жи¬вет сейчас, что делает этот замечательный художник сцены, которого по праву назвали поющим сердцем ра¬бочего класса, этот великолепный актер, этот удиви¬тельный певец — великий шансонье пролетарской рево¬люции.
В последние годы Буш покинул сцену, ушел из теат¬ра. Он иногда выступает на концертах перед рабочими, перед молодежью. Вот уже несколько лет, как он выпус¬кает одну за другой пластинки с записями своих песен. Песни немецкой революционной борьбы, участником ко¬торой он является всю свою сознательную жизнь, песни гражданской войны в Испании, на фронтах которой он сражался, песни русской революции, песни на слова немецких и советских поэтов—все это любовно выпуска¬ется Германской академией искусств.
В доме на Леонгард-Франкштрассе, 11, где живет Буш, постоянно слышится музыка. Буш репетирует. Буш поет. Он работает днем и ночью (внезапно подни¬мается он среди ночи и бежит к роялю, чтобы проверить новый оттенок мотива). Сейчас он увлечен работой над новой, праздничной пластинкой, которую он посвящает пятидесятилетию Октября. Это наши песни, песни борь¬бы и труда, песенная и поэтическая летопись наших пятидесяти лет.
Эрнст увлечен этой пластинкой превыше всего. Он выспрашивает о поэтах, об истории некоторых песен. Он перерабатывает переводы текстов, уточняет, улучшает их. Мы прослушиваем некоторые записи — Буш не¬престанно стремится к их улучшению.
Затем он показывает будущие пластинки, пока еще лишь нанесенные па лепту. Мы слушаем песни на сати¬рические тексты Кестнера, на патетические тексты Вайнерта, па тексты народных немецких песен. Все это изу¬мительно сильно, поэтично, совершенно как истинное ис¬кусство.
Бушу шестьдесят семь лет. За его плечами нелегкая жизнь — борьба, битвы, тюрьма, ранение, непрестанный нелегкий труд. Но Буш молод — молод душевно, у него спокойная, мудрая уверенность мастера. Он озабочен тем, чтобы удалась его пластинка — подарок к пятиде¬сятилетию нашей страны, нашего Союза, который ему бесконечно дорог.
К нашему празднику готовится еще один подарок — фильм об Эрнсте Буше — друге советских людей (ре¬жиссер К. Гасс). Немецкие товарищи хотят подарить его советским и немецким зрителям к нашему, общему празднику.
В начале сентября Буш собирается быть с женой в Москве. Он хочет дать концерт для москвичей. Он ра¬дуется предстоящей встрече с Москвой, в которой не был десять лет.
Как всегда, мне трудно уходить от Буша, трудно расставаться с ним. Но на сей раз я предвижу скорую встречу.
— До свидания, Эрнст! До свидания, Ирена!
(Informationen zu Alexander Dymschitz in russischer Sprache im Lexikonartikel)
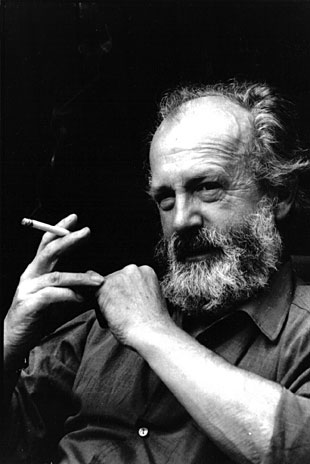
Hugo Fetting
über die Entstehung der ersten Ernst-Busch-Biografie in deutscher Sprache und die Arbeit an den Aurora-Schallplattenheften
„Er war eine von seiner Kunst besessene Figur“
(Gespräch am 22. September 2004 in Berlin)
Hugo Fetting ist Jahrgang 1923 und stammt aus Marienhof in Mecklenburg. In Güstrow besucht er die Volks- und die Handelsschule. Sein Vater ist Lokomotivheizer und Mitglied der KPD. Als Schüler geht Hugo Fetting zur HJ, „um den Motorradführerschein zu machen“, und wird zunächst ebenfalls Eisenbahner, dann Soldat. Das Kriegsende erlebt er im Lazarett, nachdem er „1945 an Führers Geburtstag verwundet“ worden ist, wie er lächelnd erzählt. Über eine Begabtenprüfung erlangt er in der SBZ die Zulassung zur Universität und studiert ab 1952 Germanistik, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte in Rostock und (Ost-) Berlin. Durch seine Bekanntschaft mit Fritz J. Raddatz kommt er in Kontakt mit dem DDR-kritischen Kreis um Wolfgang Harich und wird nach Harichs Verhaftung 1956 von der Staatssicherheit verhört. Fetting sagt heute von sich, er sei nicht oppositionell zur DDR eingestellt gewesen, er habe deren Entwicklung „kritisch begleitet“. Allerdings sei man ihm mitunter mit Misstrauen begegnet, was damit zu tun gehabt habe, dass er unverheiratet und nicht Mitglied der SED gewesen sei. Fetting ist zwar 1946 in die SPD eingetreten, tritt jedoch nach der Zwangsvereinigung mit der KPD zur SED aus der Einheitspartei aus. Von den 50er Jahren bis in die 70er ist Fetting Mitarbeiter der Akademie der Künste der DDR, danach arbeitet er an der Akademie der Wissenschaften. 1978 promoviert Fetting in Greifswald, in den 80er Jahren beginnt er für („West“-) Zeitungen Texte zum Theatergeschehen zu schreiben. Bis heute schreibt er hin und wieder Kritiken und Aufsätze für überregionale Blätter.
Fetting hat zahlreiche Bücher zum Theater verfasst, sein Spezialgebiet ist Max Reinhardt. Darüber hinaus ist er Verfasser der ersten Busch-Biografie in deutscher Sprache, sie erschien 1965 im Henschel-Verlag. In dem Buch wird Busch vor allem als großer Schauspieler charakterisiert. Erst später kam Fetting – durch seine Arbeit als Redakteur der Aurora-Plattenhefte und seine nähere Bekanntschaft mit Busch – zu der Erkenntnis, Busch sei eigentlich mehr Sänger als Schauspieler gewesen. Im Interview redet Fetting seinen Anteil am Busch-Buch klein – als sei er mehr Ghostwriter denn Biograf gewesen. Obwohl Fetting fast ein Jahrzehnt lang ständig mit Busch zu tun hatte und mit ihm per Du war, bleibt er im Gespräch spürbar auf Distanz. Nur einmal, als das eigentliche Interview bereits vorbei ist, nennt er Busch beiläufig beim Vornamen. Beim Verabschieden fällt mir ein vergilbtes Plakat auf, das an der Wohnzimmertür hängt. Darauf zu sehen ist Ernst Busch und der Hinweis auf eine Ausstellung im Deutschen Theater zum 75. Geburtstag des Künstlers. „Das hing damals an jeder Litfasssäule“, sagt Fetting.
Nachtrag: Als ich Hugo Fetting den Text unseres Gesprächs zum Autorisieren vorbeibringe und wir in seiner Wohnung im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg zusammensitzen, klingelt plötzlich das Telefon. Fetting nimmt ab und führt ein fünfminütiges Gespräch in schönstem Plattdeutsch, um anschließend mit mir wieder allgemeinverständlich weiterzureden. Bei dieser Gelegenheit erzählt er mir von einer Reise in den Westen, die er gemeinsam mit Busch und dessen schwangerer Frau Mitte der 60er Jahre unternommen hatte, von Besuchen bei Mary Tucholsky und Heinar Kipphardt in München. Und er gibt mir ein Schwarz-Weiß-Foto von sich (s.o.), das 1982 in Leipzig im Auftrag des Reclam-Verlags entstanden war, für den er damals schrieb.
JV: Wie haben Sie und Ernst Busch sich kennengelernt?
Dr. Hugo Fetting: Zunächst kannten wir uns nur vom Sehen und Guten-Tag-Sagen. Bekannt wurde ich erst 1960 mit ihm durch Eisler. Die beiden hatten wohl verabredet, dass die Akademie seine Lieder aufnehmen sollte. Und Busch verlangte dann, dass sich jemand darum kümmerte, und da ich als sogenannter Fachassistent dabei saß, blieb also nur der Fetting übrig. Und so kam ich zu Busch.
Als Fachassistent?
Das nannte sich damals Fachassistent in der Sektion für Darstellende Kunst. Und Eisler hat in der Sektion auf einer Sitzung vorgeschlagen, dass der Busch seine Sachen singen sollte und die Akademie das bezahlen oder es möglich machen sollte. Und so kam Busch wieder zum Singen und Fetting zum Busch.
Vorher kannten Sie Busch nur …
… als Akademiemitglied, vom Reden in der Sektionssitzung und als Schauspieler natürlich.
Wissen Sie noch, wie Ihr Bild von Busch war, bevor Sie ihn persönlich kennengelernt haben?
Na, da hab ich ihn nur als Schauspieler geschätzt, denn anders konnte man ihn ja nicht kennenlernen – er sang ja nicht öffentlich. (…)
Wussten Sie etwas über seine Biografie?
Wenig, wenig.
Wie sah nun Ihre neue Aufgabe aus?
Ich habe die Musiker engagiert und die Musiker bezahlt und die Termine gemacht. (…) Busch wollte jemanden haben, der ihm das alles organisiert. (…)
War das eine regelrechte Vollzeitbeschäftigung?
Nein. Die Vollzeitbeschäftigung war die Fachassistenz an der Akademie: die Sektionssitzungen zu machen, die Protokolle anzufertigen – und dann hatte ich eine Abteilung für deutsche Theatergeschichte in der Akademie. (…) Mich interessierte vor allem das Theater des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Meine Arbeiten zu anderen Themen sind eigentlich eher zufällig entstanden.
Auch Ihr Busch-Buch kam so zustande?
Ja, auch durch Zufall. Weil der Schneerson (Grigori Schneerson, sowjetischer Komponist und Musikwissenschaftler, JV) dieses russische Busch-Buch gemacht hatte, was dem Busch nun gar nicht gefiel, und zufällig der Ihering eine Broschüre oder ein Manuskript hatte, das dem Busch nur teilweise gefiel. Nun wollte er beide Schriften zusammenbringen, und dafür sollte ich das Schneerson-Buch umschreiben – und das mit dem Umschreiben gefiel mir gar nicht. So kam etwas eigenes zustande mit dem Ihering-Vorwort, was der Busch dann zusammengestrichen hat. Die Ihering-Arbeit ist zum Vorwort geworden, das war ursprünglich ein längerer Aufsatz, praktisch ’ne Broschüre von etwas über 40 Schreibmaschinenseiten.
War diese Broschüre vom Henschel-Verlag in Auftrag gegeben worden?
Gar nicht, nee. Das machte der Ihering so. Der Ihering schrieb ab und an solche Broschüren oder Artikel über irgendwelche Leute, die ihm gefielen. Über Werner Krauss hat er auch ’ne längere Sache gemacht – die ist bis heute nicht veröffentlicht. Weil Krauss damals auch überhaupt nicht up to date war, denn er hatte in „Jud Süß“ mitgespielt. So hat Ihering offensichtlich einfach für sich geschrieben.
Woher kannten Sie Ihering?
Er war Akademie-Mitglied. Und wie ich an die Akademie kam, war der Ihering Chefdramaturg am Deutschen Theater. (…) Er war ein bekannter Mann. (…) Aber er schrieb damals keine Kritiken und gar nichts mehr. (…)
Wie hat er reagiert, als sein Text zusammengestrichen wurde?
Das hat er ohne weiteres hingenommen. Weil er Busch auch sehr schätzte und ihn nicht verärgern wollte.
Wie kam es dann dazu, dass Sie das Buch gemacht haben?
Wir machten damals schon die Aufnahmen. Ich weiß nicht mehr, wann das war – das muss Anfang der 60er Jahre gewesen sein. Und da sagte der Busch eben, ich solle dieses Schneerson-Buch umschreiben, was ich dann probiert habe. Wobei mir aber die Lust dabei verging und ich ihm dann sagte: „Ich mach das nicht, das mit dem Umschreiben – wennschon, dann richtig!“
Hatten Sie damals die deutsche Übersetzung vorliegen? Im Busch-Archiv liegen diese mit Schreibmaschine geschriebenen Blätter …
Ja, die Übersetzung hatte ich. Könnte sein, dass das diese Blätter sind. Es könnte auch Schreibmaschinen-Blätter geben von einer Arbeit von Slatan Dudovs Tochter, die ein Examen über Busch gemacht hat.
Zu dieser Zeit?
In den 60er Jahren muss das gewesen sein. (…) Da weiß ich nur davon, weil ich sie gelesen habe.
Ihr Buch ist 1965 erschienen.
Dann ist das wohl danach gewesen. (…)
Wo hat Dudovs Tochter diese Arbeit geschrieben?
Das war eine Abschlussarbeit an der Humboldt-Uni. (…)
Glauben Sie, dass Busch öfter Gegenstand wissenschaftlicher Arbeiten war?
Nee, das glaube ich nicht. Meines Wissens gab es noch eine Examensarbeit über Busch in Leipzig, das war ebenfalls in den 60er Jahren.
Keine anderen späteren Arbeiten?
Glaube ich nicht.
Dabei war er doch eine wichtige Figur auch im öffentlichen Bewusstsein.
Ja, aber vielleicht hat sich keiner rangetraut. Er war ja damals auch nicht mehr so in der Öffentlichkeit. Er hat ab Ende 61, glaube ich, nur noch gesungen, nicht mehr Theater gespielt. Weil ihm das Singen dann wichtiger war als das Theater.
Also: Ihering schreibt den Aufsatz, der wird von Busch zusammengestrichen und ergibt schließlich das Vorwort. Und Sie bekommen den Auftrag, das Buch von Schneerson umzuschreiben. Das gefällt Ihnen aber nicht. Warum?
Mir? Nee, mir war das gleichgültig, was der Busch wollte.
Aber Sie sagten doch, Sie wollten das Buch nicht umschreiben?
Weil es zu viel Arbeit gemacht hätte. Das war so blumig. Und finden Sie mal dauernd neue Worte für Sachverhalte, die längst beschrieben sind! Das war mir zu blöd. Da hab ich dem Busch dann gesagt: „Nee, mit mir nicht!“
Die Sprache ist wirklich sehr blumig.
Es ist eben ein russisches Buch. Aber das hat ihn nicht interessiert, weil russische Bücher nur in Russland gelesen werden. Busch hat das nicht weiter interessiert, weil er nicht direkt damit konfrontiert worden ist – durch die Russen oder durch russische Leser.
Hat sich das Buch in Russland gut verkauft?
Das weiß ich nicht mehr. Das liegt zu weit zurück. Schneerson hat es sicher mal gesagt, wie hoch die Auflage war. Und sie ist verkauft worden, das hat er erzählt.
Und Busch hat zu Ihnen gesagt, Sie sollen ein neues Buch schreiben?
Ja, das hat der Busch dann gesagt. Mich hat das ja nicht interessiert, über ihn zu schreiben.
Warum hat Sie das nicht interessiert?
Weil ich damals andere Interessen hatte: Reinhardt und Jessner und die 20er Jahre im Grunde.
Sind Sie verdonnert worden, das zu schreiben?
Nee, verdonnert kann man nicht sagen. Er hat mich mehr oder weniger gebeten, und da hab ich’s dann gemacht. Erstens: weil es Geld brachte, zweitens: weil es mir sicher auch Spaß machte, und drittens: weil ich Busch das auch nicht abschlagen wollte.
Was hatten Sie für Hilfsmittel beim Schreiben?
Ich habe nur Sachen benutzt, die er gesammelt hatte und ihn natürlich selber befragt. Und er hat dann auch jede Seite gelesen und mir gesagt, was er nicht haben will und wie er’s haben will.
Schwierige Bedingungen …
Ich hab es hingenommen – vielleicht, weil ich damals jünger war. (…)
Hatte Busch vorgesorgt für den Fall, dass eines Tages seine Biografie geschrieben werden sollte?
Nein, nein. Er hatte früher sehr viel über sich gesammelt – in der letzten Zeit aber nicht mehr. Aus welchem Grunde er das gesammelt hatte, da hat er nie drüber gesprochen. Ich hab ihn auch nie gefragt.
Um eines Tages etwas über die eigene Person zu veröffentlichen?
Dafür war es eigentlich zu wenig – was er da aus seiner Laufbahn gesammelt hat. Es waren nur Dinge, die ihn selber interessierten, auch von den Kritiken.
Lobende Kritiken hat er nicht aufgehoben?
Wenig, wenig.
Sie zitieren aber viele in Ihrem Buch.
Ja, die hab ich dann gesammelt. Er wusste gar nicht mehr, wo er überall gespielt hatte. Und worin er gespielt hatte.
Wo hatten Sie die Kritiken her?
Da hab ich dann die Zeitungen durchgesucht.
Also haben Sie doch selbst recherchiert und nicht all das Material von Busch bekommen.
Es gab oft auch Hinweise von ihm. Ich wusste dann, wo ich recherchieren kann. Man kann vielleicht sagen: halb und halb – die eine Hälfte kam von Busch, andere Sachen kamen dazu.
Wie war die Zusammenarbeit mit Busch? Ich stelle es mir sehr aufwändig vor, wenn derjenige, über den man schreibt, so stark eingreift und jede Seite kritisiert.
Ach, das ging eigentlich sehr schnell. Ich glaube: nicht mal zwei Jahre, anderthalb Jahre vielleicht. Ich war ja fast täglich bei ihm wegen der Gesangsaufnahmen. Da war ich viel bei ihm zu Hause und wir haben beraten, was er singt und wann er singt. Welche Leute er dazu haben will, was die Leute machen, wenn er sie nicht kennt und ob er sie erst nach Hause zum Probieren haben will. Damals wohnte Busch in Pankow in der Heinrich-Mann-Straße. Wie Langhoff dann gestorben war und die Frau auch und die Kinder auszogen, kriegte er das Haus vom Langhoff in der Leonard-Frank-Straße. Da lebte auch Buschs Frau noch, bis 64 oder 65, glaube ich. Das Buch hat sie nicht mehr miterlebt, aber das weiß ich nicht mehr genau. Busch war viel zu Hause und nahm sich oft auf Tonband auf. Und da nicht weit von seinem Haus die Mauer stand und damals noch das Werk von Bergmann-Borsig in Wilhelmsruh war, fuhren da sehr viele Busse, und die störten ihn. Und so nahm er dann die Wohnung beziehungsweise das Haus vom Langhoff.
Ihn störten die Busse in der Heinrich-Mann-Straße, mit denen die Arbeiter zum Werk fuhren?
Ja, sonst wäre er wahrscheinlich gar nicht umgezogen. Früher waren die Arbeiter mit der S-Bahn gefahren. Aber nun konnten sie nur mit dem Bus zur Arbeit fahren. Und der Bahnhof von Wilhelmsruh lag eben im Westen. (…) Die Buslinie ging über Niederschönhausen nach Wilhelmsruh. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Deswegen ist der Busch jedenfalls umgezogen.
War er so empfindlich?
Es waren dauernd die Busgeräusche da. Weil dicht dabei ja auch ’ne Haltestelle war. Und das Bremsen und Brummen war dann auf den Tonbändern teilweise zu hören. Und das störte ihn. (…)
Vorher hat er ja in Treptow gewohnt.
Das hatte politische Gründe. Alle Leute, die im Westen wohnten, und das waren damals die meisten, bekamen ein Angebot, in den Osten zu ziehen, wo sie auch arbeiteten – also Becher, die Seghers oder Busch. Und die kriegten dann hier Wohnungen und Häuser und zogen dann alle nach dem Osten. In Treptow hat er dann das Haus bekommen, wo er mit der Körting einzog. (…)
Ernst Busch und Margarete Körting
Wissen Sie, wie er Margarete Körting kennengelernt hat?
Im Theater. Sie war geschieden von ihrem Mann. Der war Regisseur in Cottbus zum Schluss. Sie war mehr oder weniger Kleindarstellerin am Deutschen Theater.
Hat Busch eigentlich jemals Anstalten gemacht, sie zu heiraten?
Nein, eigentlich nicht. Teilweise war er recht naiv. Erst als sie nachher gestorben war, da hat er gesagt, er hätte sie heiraten müssen, weil sie ja keine Rente und nichts von ihm gekriegt hätte, falls er gestorben wäre. Das ist ihm aber erst nach ihrem Tod bewusst geworden.
War er naiv oder war sie naiv?
Nee, sie war sicher nicht naiv. Sie hätte das gerne gewollt. Es gab da viel Streit im Haus: Sie war sehr reizbar, und er war es dann auch. Bei ihr lag es sicher daran, dass sie eben nicht versorgt war. Und damit machte sie ihn damals, man kann sagen: ziemlich krank – obgleich er im Grunde gar nicht krank war. Er hatte zwar ’nen hohen Blutdruck und musste Tabletten nehmen und so. Und dann lief er, von wegen „bestangezogener Mann“ (Anspielung auf ein Zitat von Gad Granach, JV), nur in der Trainingshose rum. Erst später wurde er dann plötzlich, als sie gestorben war und die Ullrich kam, ein gut angezogener Mann, würde ich sagen.
Sie meinen, er hat sich zu Hause gehen lassen?
Nein, es war ihm wahrscheinlich gleichgültig. Wie ihm vieles gleichgültig war, alles gleichgültig war, würde ich sagen. Bis auf das, was er selber machte. Darum ging es ihm. Er hat auch das Theater fahren lassen, weil ihm der Gesang wichtiger war, seine Lieder.
Eva Kemlein sagte mir, die Beziehung mit Margarete Körting sei eine Strindberg-Ehe gewesen.
Ja, sie haben viel gestritten.
Auch in Ihrer Gegenwart?
Ja, ja. Er nahm auf niemanden Rücksicht. Meist ging es um Alltäglichkeiten. (…) Das ging wahrscheinlich von ihr aus: aus der unterbewussten Befürchtung, dass sie eben unversorgt wäre, falls er vor ihr sterben würde. Denn er ging damals zweimal nach Buch, da gab es so ein Institut der Akademie der Wissenschaften für Herz und Kreislauf von Professor Baumann. Da kam man nur durch Beziehungen ran, der hatte mehr oder weniger nur prominente Leute als Patienten. Busch musste seines Kreislaufs wegen zweimal dorthin.
Was hat das mit ihr zu tun?
Na, dass sie ihn immer krank machte. (…) Und die Angst, dass er wegging, denn sie war ja unversorgt. Und sie hat sicher auch nicht so viel verdient als Kleindarstellerin. Sie hat ja noch so kleine Rollen gespielt. Und er spielte teilweise am Deutschen Theater und am Berliner Ensemble.
Waren Sie bei ihrer Beerdigung?
Ja. Da war er aber nicht. Da war er auch gerade in Buch. (…) Als sie starb, war er zu Hause. Und er ging dann nach Buch.
Woran ist sie gestorben?
Wahrscheinlich an Herzversagen. Denn sie war nicht krank und nichts. Sie war einfach eines Morgens tot.
Hat ihn das schwer getroffen?
Nee, das hat ihn nicht weiter getroffen. Wobei man das nicht so genau sagen kann, denn er zeigte nie Gefühle.
Eva Kemlein sagt, dass er plötzlich überall Bilder von ihr aufgestellt hätte.
Nee, nee. Da muss sie irren. Nein, ihren Tod ließ er gar nicht merkbar an sich herankommen.
Wie kann es sein, dass er nicht zur Trauerfeier kommt?
Weil Professor Baumann ihn nach Buch genommen hat. Baumann hatte er auch gerufen, wie Tete gestorben war. Und dann hat der ihn nach Buch geholt.
Er blieb der Beerdigung sozusagen auf ärztliches Anraten fern?
Ja, wahrscheinlich. Der Baumann hat ihn da wahrscheinlich nicht weggelassen wegen seiner gesundheitlichen Situation, die ich weiter nicht kenne, denn für mich war er soweit immer gesund.
Erinnern Sie sich noch an die Beerdigung? Waren viele Leute da aus der Akademie zum Beispiel?
Ja, ja. Die ganze Kapelle auf dem Friedhof in Pankow war voll. Akademie-Mitglieder waren weniger da, denn er hatte keine Bekannten und ließ kaum jemanden nach Haus privat zu sich. Das waren immer ganz wenige – auch nachdem sie gestorben war. Aber natürlich kamen Kollegen von Busch und Körting. Denn sie war ja noch am Deutschen Theater engagiert bis ein Jahr etwa, glaube ich, vor ihrem Tode.
Wie wurde es aufgenommen, dass der Mann der Verstorbenen nicht da war?
Einige, soweit ich mich erinnere, hat es gestört. Wobei die Leute gar nicht wussten, dass er in Buch ist. Ich wusste es. Und es hat sich dann auch herumgesprochen, als sich einige aufregten, dass der Busch nicht da ist.
Hat man das nicht als Kneifen ausgelegt?
Das glaube ich nicht. Busch ist immer seine eigenen Wege gegangen. Man traute ihm auch zu, dass er nicht hingeht, wenn die eigene Frau beerdigt wird. Jedenfalls die, die ihn genau kannten.
In dieser Zeit waren Sie ja bereits am Schreiben, Ihr Buch war wahrscheinlich fast fertig …
Ja, ich glaube, es ist kurz nach Tetes Tode erschienen. Ich war damals sozusagen Untermieter im Hause Busch, obgleich ich dort nicht übernachtete.
Ist Ihnen der Tod von Margarete Körting nahe gegangen?
Ja, weil sie ’ne sehr nette Frau war. Ich hab sie schon sehr geschätzt, ja.
Kamen Sie gut mit ihr aus?
Ja, ja.
Besser als mit Busch?
Ja, weitaus besser. Man konnte mit ihr reden, während man mit Busch nur bestimmte Sachen bereden konnte.
Was für Sachen konnte man mit Busch bereden?
So Allgemeines eigentlich gar nicht, das hat ihn gar nicht interessiert in der Zeit. Nicht nur in der Zeit, sondern wahrscheinlich bis zu seinem Tode, weil ihn von den 60ern an nur die Lieder interessierten. (…)
Haben Sie bei diesen Gesprächen im Hause Busch, als Sie „Untermieter“ waren, wie Sie sagen, viel Kritik zu hören bekommen an dem, was Sie geschrieben hatten?
Ja, teilweise. Er hat dann meistens drin rumgestrichen, hat mit dem Bleistift Sätze gestrichen, die er nicht haben wollte. Die hab ich dann weggelassen oder habe den Anschluss ein bisschen anders formuliert.
Hat er Ihnen Vorgaben gemacht, was rein sollte ins Buch und was nicht?
Das eigentlich nicht, nee. Er hat mir seine Sachen gegeben, aber bestimmte Wünsche hat er nicht geäußert – sondern nur, was ihm nicht gefiel.
Private Dinge, Frauengeschichten etwa, hätte er sicher nicht drin haben wollen …
Nein, da hab ich auch gar nicht dran gedacht, sie reinzunehmen. Es ging im Grunde nur um den Künstler. (…)
War es von Anfang an klar, dass Ihr Buch bei Henschel erscheint?
Schneerson hatte ja diese Übersetzung vom Henschel-Verlag machen lassen. Denn er hatte zunächst sein Buch hier beim Henschel-Verlag angeboten. In der DDR waren die Verlage alle spezialisiert: Also Volk & Welt brachte nur West-Autoren und ausländische Autoren, Neues Leben nur DDR-Autoren und Henschel nur Theater, Musik und Film.
Haben Lektoren oder Angestellte des Verlags mitgeredet bei Ihrem Buch?
Das glaub ich nicht. Da ist alles so gekommen, wie wir es wollten oder wie Busch es wollte. Ich bin zwar als Autor genannt, aber eigentlich war es Busch. Es ist nichts gekommen, was der Busch nicht wollte oder was die Zeit nicht zuließ. Es gab ja das Amt für Literatur, so hieß es, glaube ich. Auch mein Buch ist bestimmt vom Amt gelesen worden. In der DDR gab es ja durchaus eine Zensur …
Auch in diesem Fall? Gab es Einschränkungen?
Nein, nein. Es gab auch vom Amt keine Empfehlung an den Autor, sondern das ging immer über den Verlag und über den jeweiligen Lektor.
Gab’s das bei Ihnen?
Bei mir nicht, nein.
Busch und sein Verhältnis zu Funktionären der Partei
Hier im Buch schreiben Sie zum Beispiel, dass die Zahl seiner engsten Freunde sehr klein sei. Weiter heißt es: „In seinem Hause hängt der Spruch: Allah schütze mich vor meinen Freunden – meine Feinde übernehme ich selber! Das erklärt alles.“ Man kann sich nun fragen, warum Sie das erwähnen. Vielleicht, weil es einige Genossen gab, mit denen er Schwierigkeiten hatte …
Nun, er hatte Schwierigkeiten gehabt mit Ulbricht. Wie Pieck gestorben war, wurde Ulbricht unser höchster Mann im Staat. Und von da an erhielt Busch keine offiziellen Einladungen mehr. Er war dann wie Hinz und Kunz ein Mann wie jedermann. Offiziell jedenfalls.
Hat ihn das gekränkt?
Ich glaube nicht, nein. Vielleicht am Anfang, wie es passierte. Das war noch vor meiner Zeit, aber ich glaube, da hat er sich nicht so viel draus gemacht. (…) Auf Ulbricht war er schon früher nicht gut zu sprechen gewesen. Er hat mir mal erzählt, dass er zu Beginn der 50er Jahre zu irgendeinem sowjetischen Empfang eingeladen war. Da hätte Ulbricht ihn gefragt, warum er nicht seinen Anstecker trage, Busch hatte ja 1949 den Nationalpreis dritter Klasse bekommen und dazu gab es einen Anstecker. Darauf antwortete Busch, schon sein Vater hätte gegen das Drei-Klassen-Wahlrecht gekämpft, und er halte es ebenso.
Es gibt einige solcher Geschichten über Busch und hohe Funktionäre. Beispielsweise soll er Honecker geohrfeigt haben. Das erzählt Manfred Wekwerth gerne, auch in seinen Memoiren …
Nein, das ist sicher ein Märchen. Mit Honecker ist er wahrscheinlich kaum zusammengetroffen. Höchstens später, nachdem er zum zweiten Mal verheiratet war, haben sich die beiden mal gesehen: In den 70er Jahren hatte Busch, so weit ich mich erinnere, einen Termin im ZK, da gab es ein Treffen mit Honecker, aber das war nicht die Regel.
Waren Busch und Honecker nicht im selben Zuchthaus gewesen?
Ja, aber ich glaub nicht, dass sie sich gekannt haben. Es war nicht wie zum Beispiel bei Otto Klippenstein, einem Mithäftling aus Brandenburg, der immer zu Buschs Geburtstagen kam. Honecker war ja im Übrigen bald nach 45 bei der FDJ gewesen. Und früher konnte man Tanzplatten nur kaufen, wenn man zwei Platten für eine gab. Also man musste zwei abliefern, und dann bekam man eine Tanzplatte. Honecker stachelte damals als FDJ-Vorsitzender die jungen Leute an, Busch-Platten abzuliefern. Denn Busch war ja seinerzeit verrufen als Agitprop-Sänger, was bald nach 45 als Proletkult abqualifiziert wurde. Dadurch war Busch schlecht auf Honecker zu sprechen: Weil der die FDJ angewiesen hatte, Busch-Platten zu kaufen und die dann gegen Tanzplatten einzutauschen.
Das mit der Ohrfeige halten Sie für ’ne Legende?
Das is ’ne Legende. So was verbreitet irgendjemand. Es gibt ja da ’ne Menge Legenden über Busch.
Warum bietet sich jemand wie Busch für Legendenbildung an?
Weil er sehr direkt war und nie ein Blatt vor den Mund genommen hat, also völlig undiplomatisch gewesen ist, und zwar jedermann gegenüber. Es war zum Beispiel typisch in der Akademie: Da wurde der Hans Bentzien Kulturminister. Und der hatte wahrscheinlich den Ehrgeiz, sich mit bestimmten Institutionen oder jedenfalls mit der Akademie der Künste und den Mitgliedern gut zu stellen. Und der kam dann mal in die Akademie. Und dann ging es unter anderem auch um Busch, warum er nicht singt. Das war Ende der 50er Jahre, kurz vorm V. Parteitag. Busch regte sich auf und zum Schluss sagte er, er möchte wissen, was gegen ihn vorliege, er lasse sich von niemandem an den Wagen pissen. Zum Singen gehöre eine gewisse innere Heiterkeit, und wenn er Leute vom Präsidium in den ersten Reihen sitzen sehe, die ihm den Strick um den Hals wünschen, dann könne er nicht mehr singen, dann könne er nur noch schreien.
Das ist jetzt aber keine Legende, da waren Sie dabei?
Ja, da war ich dabei. Und bestimmt so 20, 30 Akademiemitglieder und die jeweiligen Assistenten von den Sektionen, das waren insgesamt vier.
Wer hatte Busch die Frage gestellt?
Professor Cremer, der Bildhauer hatte das gefragt.
Wie war die Reaktion?
Stille – wie in der Kirche. Alle waren sehr betreten. Es waren sehr viele Parteigenossen in der Akademie. Ob sie nun wirklich Genossen waren, also gesinnungsmäßig, weiß ich nicht. Dem Abzeichen nach waren sie es. Und der Bentzien war nun sowieso ein Funktionär.
Mochte Busch den nicht?
Ach, das war ihm völlig gleichgültig. Den kannte er gar nicht. Der war gerade erst Kulturminister geworden und wollte nun ein gutes Verhältnis zur Akademie haben. (…)
Diese Aussage von Busch hört sich doch so an, als sei er gekränkt gewesen. Fühlte er sich nicht genügend geschätzt?
Nein. Ihm war ja das Singen mehr oder weniger verboten. Denn all seine Lieder waren ja nun Proletkult. Und die Partei, die diesen sogenannten Proletkult erfunden hatte, war nun an der Macht und wollte ihn verschweigen und nicht mehr hören. Und ihm war, und das glaub ich heut noch, insgesamt das Singen wichtiger als das Spielen.
Wie kommen Sie drauf?
Als ich ihn kennenlernte und auch in der Zeit danach, war das Singen für ihn das A und O. All den Leuten, die zu ihm kamen, denen hat er nie was vorgespielt oder vom Schauspiel erzählt, sondern nur seinen Gesang vorgeführt, seine Lieder. Jedenfalls war das so, seitdem er nicht mehr spielte, also seit 61 ungefähr. Da habe ich ihn ja auch erst intensiver kennengelernt – seit 60 zu Hause. Vorher kannte ich ihn auch hauptsächlich als Schauspieler.
In Ihrem Buch schreiben Sie: „Der Sänger Busch verstummte um 1950. Er war nicht mehr in Veranstaltungen, nicht mehr in Feiern und kaum noch im Rundfunk zu hören. Von ihm besungene Schallplatten wurden nur noch vereinzelt produziert (…)“ – Das stimmt ja nicht so ganz. Gerade Schallplatten kamen noch einige heraus. Und einige Lieder wie zum Beispiel „Ami go home“ sollen auch noch Mitte der 50er Jahre ziemlich populär gewesen sein …
Ja, aber Platten hat er nur solange gemacht, wie er Plattenchef war. Er hat Lied der Zeit ja praktisch erfunden. Bis das dann Deutsche Schallplatte wurde und volkseigen. Und dann wollte er auch den Plattenbetrieb loswerden, er hat deswegen noch mit Pieck gesprochen. (…)
(Ende Seite 1, Kassette 1)
Das zerrissene Parteibuch
Lassen Sie uns über die Geschichte mit dem Parteibuch reden. Sie waren ja regelmäßig zu Gast bei Buschs. Hat Busch tatsächlich zu seinem 70. Geburtstag von Kurt Hager ein neues Parteibuch geschenkt gekriegt? Und hat er sich darüber gefreut?
Nein, er hat’s ihm ja wieder zurückgegeben. Er hat dem Hager dann sozusagen auch was zum Geburtstag geschenkt. Hager hatte da so eine Ledermappe mit, da war das neue Parteibuch drin. Und Busch hat ihm das wiedergegeben oder gleich, als er gesehen hat, dass das ein Parteibuch ist, gesagt, er schenkt ihm auch was zum Geburtstag, und dazu gesagt: „Ich hab schon eins!“. Und dann hat er irgendwann, vormittags beim Frühstück war das, die Cassette geholt und gesagt: „Ich zeig Dir mal was!“. Das war eine verschlossene Cassette aus Metall, in der das alte, zerrissene Parteibuch lag. (…)
War Hager beleidigt?
Das weiß ich nicht. Er hat sich’s jedenfalls nicht anmerken lassen und ist zum Frühstück geblieben.
Für Hager muss sich Busch ja als hoffnungsloser Fall dargestellt haben …
Ich glaube, die hatten sowieso alle ein ziemlich dickes Fell, die Politbüromitglieder, sodass die sich da gar nichts draus gemacht haben – die hat das im Grunde gar nicht interessiert. (…) Hager war übrigens nicht allein, er hatte einen Kulturmensch namens Feist dabei. Dieser Feist hatte, glaube ich, einen Bruder, der später in der Abteilung Außenpolitik beim ZK war.
Waren Sie überrascht von dieser ganzen Aktion?
Überrascht schon – dass die überhaupt ’n Parteibuch mitbrachten. Aber auf der anderen Seite: Vielleicht ist es mit der Uli, mit der Irene Ullrich, auch abgesprochen gewesen. Und ich weiß nicht, ob man nachher im Nachlass ’n Parteibuch gefunden hat. Könnte sein, dass die Ullrich das wieder genommen hat.
(Exkurs über Irene Busch)
Waren Sie eigentlich per Du mit Busch?
Ja.
Auch mit der Tete?
Ja, mit der Tete auch. Mit der Uli nicht.
Das war dann immer Frau Busch?
Ja, das war Frau Busch (lacht). Während die andere auch Frau Busch war, obgleich sie nie verheiratet waren. Aber ich hab sie als seine Frau kennengelernt. Tete wurde von allen nur Frau Busch genannt. Alle glaubten, er wäre verheiratet. Alle Welt sagte Frau Busch.
(Exkurs zum Thema Heiraten, ähnlich wie am Anfang: Erst am Tag ihres Todes hätte Busch gemerkt, wie wenig er sich um Tete gekümmert hatte. Er bereute, sie nicht doch noch geheiratet zu haben: Wenn er vor ihr gestorben wäre, wäre sie „unversorgt“ gewesen und sie hätte das Haus verlassen müssen, er habe sich wenig um diese Äußerlichkeiten, Formalitäten oder Sicherheiten geschert)
Sie wurde später auch vom Langhoff entlassen. Sie war ja immer noch am Deutschen Theater angestellt und spielte auch kleine Rollen. Und zwei Jahre oder ein Jahr vor ihrem Tod wurde ihr Vertrag dann auch nicht mehr verlängert. Rentnerin war sie aber noch nicht.
Sie war dann Hausfrau?
Ja, das war sie sowieso die meiste Zeit, denn sie spielte nur kleine Rollen. (…) Sie war sehr sympathisch, sehr nett. Gekocht hat eine andere Frau, eine Haushälterin.
Hatte sie Kinder aus der ersten Ehe?
Nein, sie hatte keine Kinder. Sie ist an der Seite ihres ersten Mannes in Pankow/Niederschönhausen beerdigt. Auf dem Friedhof ist auch Busch beerdigt. (…)
Hat Busch Ihnen auch private Dinge anvertraut?
Privates hat er von seiner Mutter oder von seinem Vater ab und an mal erzählt. Oder von der Schwester in Kiel auch. Die kam mal, entweder mit der Mutter oder einer Kusine zu irgendeinem Geburtstag aus Kiel. (…) Die Schwester war irgendwie …, verwachsen kann man nicht sagen, aber irgendwie krank. Sie hat damals auch keinen Beruf mehr ausgeübt. (…)
Versäumnisse des Biografen
Lassen Sie uns wieder über Ihr Buch reden. Wie hat denn Busch auf die Veröffentlichung reagiert? Hat er Ihnen Respekt gezollt?
Nein, nein. Gar nicht. (…) Das war auch kein besonderes Buch für mich. Weil ich da vieles geschrieben habe, was ich eigentlich gar nicht schreiben wollte. Oder anders: Es ist vieles nicht gedruckt worden, was ich gern hätte drucken lassen. Einmal hat’s Busch gestrichen, ein andres Mal hätte es die Zensur gestrichen. Bestimmte Sachen sind da eben nicht drin, die drin sein hätten müssen.
Was hätten Sie denn gern noch drin gehabt zum Beispiel?
Na, zum Beispiel habe ich Lothar Kusche zitiert …
… den Artikel aus der Weltbühne …
…ja, anstelle von bestimmten Sachen, die da gepasst hätten: dass seine Lieder verboten worden sind oder sagen wir mal: dass er Lied der Zeit abgegeben hat und loswerden musste, dass der Leiter von Lied der Zeit gen Westen gegangen ist und so. Busch hat sich ja nicht um die geschäftlichen Dinge gekümmert, das war ein anderer und der ist gen Westen gegangen noch vor der Verstaatlichung der Firma. Wie hieß der noch? Wolf …, ich weiß es gar nicht mehr, er hat’s auch mal gesagt, ich kenn ihn aber nicht mehr. Das war der, der im Grunde den Betrieb gemacht hat, er war ja kein Betriebsleiter …
Warum ist der in den Westen gegangen?
Es sind ja viele gen Westen gegangen bis 61.
Aber wäre das eine Geschichte für Ihr Buch gewesen, hätte die da reingepasst?
Das nicht – aber einiges über Lied der Zeit hätte da reingehört. Dass man ihm bestimmte Lieder verboten hat, die er machen wollte und die er dann nicht machte: zum Beispiel von Tucholsky, das mit dem Jüdischen Friedhof, das heißt zwar nicht so, hat aber mit diesem Friedhof zu tun – das hat man ihm verboten.
Wann war das?
Das war ganz früh, als er noch Lied der Zeit hatte. Er hätte damals schon gerne wieder Tucholsky-Texte gesungen. Aber sie haben ihm bestimmte Sachen verboten, die dann auch nicht kamen, teilweise sogenannte Proletkult-Lieder. (…)
Das hat er Ihnen erzählt, obwohl er wusste, dass das nicht ins Buch reinkommt?
Ja, ja. Er hat bestimmte Sachen trotzdem erzählt, die dann nicht ins Buch kamen.
Hat er dann dazu gesagt: „Das bleibt jetzt unter uns!“ oder so?
Ja. Bestimmte Sachen hat er einfach nur so erzählt, die ich dann aber nicht schreiben sollte.
Haben Sie immer mitgeschrieben?
Ja, ja. Ich müsste das noch mal suchen. Ich hab noch so Aufzeichnungen da, ’ne ganze Menge.
Sie meinten am Telefon, Sie hätten keine Aufzeichnungen mehr …
Ich hab sie zwar nicht mehr gefunden, aber gewesen sind sie irgendwo noch. Aber wo sie sind, weiß ich nicht.
Tonbandaufzeichnungen haben Sie nicht gemacht?
Nein. Das würde jetzt auch nicht viel nützen, weil das Tonband mit der Zeit durchschlägt. Da haben Sie dann doppelten Text drauf oder dreifachen sogar.
Die alten Bänder im Rundfunkarchiv sind meist von erstaunlich guter Qualität …
Ja? Das sagte Busch jedenfalls. Ich selber weiß es nicht. Wir haben ja die Tonbänder, die wir auf Platten haben, wieder umschneiden lassen auf Tonbänder, die dann ins Akademie-Archiv gekommen sind – wo die geblieben sind, weiß ich auch nicht. Da müssten noch einige Sachen auf Tonband da sein. „Mackie Messer“ zum Beispiel. Aus dem Film. Es gab bestimmte Lieder, die nur auf Tonband da waren.
Wollte er die noch auf Schallplatte rausbringen?
Könnte sein, wenn sie zusammen ein Heft (Aurora-Heft, JV) ergeben hätten – dann hätten wir was draus gemacht.
Die Aurora-Hefte
An diesen Aurora-Heften haben Sie ja sehr stark mitgearbeitet …
Eigentlich nur! Da hat es dann ab und an mal Streit gegeben, und dann bin ich mal zeitweise ausgeschieden, oder sagen wir: weggegangen.
Warum?
Weil ich dann keine Lust mehr hatte im Grunde. Wenn sie so lange dabei sind – ich weiß nicht, wie lange ich Aufnahmen mit ihm gemacht habe: so annähernd zehn Jahre, glaube ich – dann haben Sie die Nase nachher voll. Das ging bis 70, oder so. Das könnte man an der Aurora-Platte sehen, die zuletzt erschienen ist. Danach nannte sich das „Rote Reihe“, die ich dann nicht mehr gemacht hab. Das hat dann jemand von der Akademie betreut, der ist jetzt auch schon gestorben …
Sie waren immer an der Akademie beschäftigt, sie waren nicht Buschs persönlicher Assistent …
Nein, nein. Ich war bis 78 an der Akademie angestellt.
Wer konzipierte die Aurora-Hefte?
Die Konzeption war meine Aufgabe, die Anregungen kamen von Busch. Es war ja seine Idee gewesen, diese Hefte zu machen. Ausgangspunkt waren immer die Lieder, die er singen wollte, die wir dann zu einem Thema zusammenfassten. Busch wollte die Reihe „Lieder von den Kämpfen der Arbeiterklasse“ nennen, oder so ähnlich. Der Titel „Chronik in Liedern, Balladen und Kantaten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ war dann meine Idee. Wobei wir es nicht ganz so streng nahmen, es waren auch ein paar Lieder dabei, die kurz nach 1950 entstanden sind.
Hat Ihnen die Arbeit mit Busch Spaß gemacht?
Ja, die ersten Jahre schon. Nachher wiederholte sich das ja alles. Und dann kannte man ihn auch von innen und außen. Wusste, wo er ernst oder nicht ernst zu nehmen ist. Wo er log oder nicht log. Zum Beispiel bin ich mal für die Akademie wegen eines Heftes nach Putbus gefahren. Erst haben wir in einer Druckerei in Brandenburg gedruckt, nachher dann in Putbus. Ich bin jedenfalls dahin gefahren und hab mir die Reise bezahlen lassen, wie das üblich war: Man fuhr immer mit dem Auto, das gab das höchste Tagesgeld. Und er hat dann dem Akademie-Direktor erzählt, ich hätte an dem Tag bei ihm im Garten gesessen und mich gesonnt – und hätte für diesen Tag eine Abrechnung gemacht und so getan, als sei ich nach Putbus gefahren. Also, solche Lügen konnte er auch verbreiten. (…)
Waren Sie nicht sauer?
Nein, ich kannte ja nun den Busch.
Aber wie kam er dazu? Hat er denn Ihre Abrechnungen geprüft?
Nee, nee. Rechnungen hat er nie geprüft. Aber wenn er böse war … Er wusste ja, wann ich nach Putbus fahre. Ich bin ja seinetwegen dahin gefahren wegen eines Heftes. Ich weiß nicht mehr, welches das war, ob das Majakowski war oder eines der Kästner-Hefte. Ich glaube, ich habe dort in der Druckerei Korrektur gelesen.
Ich habe in Buschs Briefen gelesen, dass es mitunter Schwierigkeiten gab, Papier aufzutreiben für die Aurora-Hefte, die ja relativ aufwändig gestaltet waren …
Eigentlich war das für ihn nicht so schwierig. Das Papier hat ja die jeweilige Druckerei aufgetrieben. Damit hatten wir gar nichts zu tun. Und wenn’s um Busch ging, hat die Akademie dann wahrscheinlich dafür gesorgt, dass die Druckerei Papier kriegte.
Und Sie haben die Redaktion gemacht, Texte rausgesucht und zum Teil selbst geschrieben. Hat er Ihnen vertraut?
Ob er zu jemandem Vertrauen hatte, möchte ich bezweifeln.
Glauben Sie, dass sich Buschs Bild in der Öffentlichkeit durch Ihr Buch veränderte?
Nein, das glaube ich nicht.
Wie hoch war eigentlich die Auflage?
Das waren 10.000.
Gab es eine zweite Auflage?
Nein, es gab keine zweite.
Lief der Verkauf nicht so gut?
Doch. Das ist soweit ich mich erinnere relativ schnell verkauft worden, in einem Jahr etwa.
Warum gab es keine zweite Auflage?
Wahrscheinlich weil kein Papier da war – oder irgendjemand nicht wollte. Ich glaub, der Ulbricht war damals am Ruder. Mir war das im Prinzip gleichgültig. Das hätte mich höchstens des Geldes wegen interessiert.
Wieviel Geld gab es denn dafür?
Ich glaub: 12 Prozent vom Verkaufspreis. Wie hoch der war, weiß ich nicht mehr. Später stand das immer hinten in den Büchern drin (nimmt das Buch zur Hand und blättert). Nee, das war damals wohl noch nicht Mode. (…) Über eine zweite Auflage gab es, so weit ich mich erinnern kann, zwischen mir und dem Verlag keine Gespräche. (…) Die Bilder im Buch waren alle von Busch privat – bis auf ganz wenige. (…) Ich hatte auch keinen Ansprechpartner beim Verlag. Nur nachher als es es fertig war und zum Amt für Literatur ging, also zur Zensur, hatte ich einen sogenannten Lektor. Aber wie gesagt: Busch war eine Person, an der sich keiner gerieben hat. Daher ist das Buch anstandslos bei der Zensur durchgegangen. Wobei man eine gewisse Selbstzensur betrieben hat. Ich wusste ja genau, was anstößig ist: wie zum Beispiel die Sache mit dem Kusche (Lothar Kusche, Schriftsteller und Feuilletonist; JV): Da hab ich eben das Kusche-Zitat genommen, statt selber was zu schreiben.
Sie sprechen von Kusches Artikel über Buschs Schweigen in den 50er Jahren. Darin wird kritisiert, dass Busch in der DDR als Sänger zu wenig präsent sei …
Ja, das lief auch bisschen quer. Aber das ist ja damals erschienen, deswegen konnte man das nicht beanstanden. Es ist ja publiziert worden. Wenn ich selber bestimmte Sachen geschrieben hätte, hätte die Zensur vielleicht eingegriffen.
Hätten Sie die Zeit der 50er Jahre gern genauer beschrieben?
Einige Sachen, ja.
Waren Sie auch der Ansicht, dass Busch zu Unrecht ins Abseits geraten war als Sänger?
Zu Unrecht ins Abseits geraten ist er nicht. Er hat sich ja selbst zurückgezogen. Aber man hätte ihn als Sänger lassen sollen und seine Sachen nicht als Proletkult verschreien oder irgendeine Zensur ausüben sollen. Denn er wollte den Staat nicht umstoßen und wollte niemandem wehtun und hat ja auch keinem wehgetan.
Konnten Sie damals privat etwas anfangen mit seinen Liedern?
Ja. Man kann eigentlich die Texte nicht von seinem Gesang trennen. (…) Früher haben mir die Lieder schon gefallen. Ich bin ja ein bisschen älter als Sie und kenne noch alte Platten von Lied der Zeit und auch noch aus der Spanienzeit, die er in Holland gemacht hat. Die hab ich schon gemocht.
Mochten Sie auch die Sachen, die Busch zu Beginn der 50er gemacht hat, wie „Ami go home!“?
Das kannte man natürlich. Das gab’s ja auch im Funk damals – bis er dann die Funkarbeit aufgegeben hat . Er hat sich dann, abgesehen vom Schauspiel, ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Aber im Grunde war der Gesang ihm wichtiger als das Schauspiel. (…)
Haben Sie sich gut verstanden mit Busch?
Ich bin damals bei Busch ein- und ausgegangen. Und es ging kein Mensch da ein und aus außer mir. (…) Ob er mich mochte, weiß ich nicht. Sagen wir so: Wir sind miteinander gut ausgekommen.
Hat er Ihnen nie gesagt, dass er Ihre Arbeit schätzt?
Nein! Das hat er wahrscheinlich zu niemandem gesagt. Er wirkte eigentlich völlig gefühllos. So dass es erstaunlich war, dass er noch ein Kind gezeugt hat. (…)
Ist Busch durch das späte Kind weicher geworden?
Nein, das kann ich nicht bestätigen. Er hat aber für das Kind einiges übrig gehabt, weil er vorher wahrscheinlich nie Kinder gehabt hatte. (…) Ein Wesenszug von ihm war, dass er ungemein rechthaberisch war. Das konnte manche Leute zur Verzweiflung bringen. Einmal kam zum Beispiel der Elektriker, um bei Irene etwas in ihrem Häuschen in Buckow zu reparieren. Und Busch, der dabei war, redete dem ständig dazwischen und wusste alles besser. Schließlich sagte der Elektriker: „Wenn du das alles besser kannst, machs doch selber!“ und packte seine Sache und ging.
Warum haben sie das so lange gemacht, wenn er Ihnen gegenüber nie Dankbarkeit gezeigt hat?
Weil er im Großen und Ganzen schon ziemlich freundlich war. Und wir meistens mit Liedern und seinem Gesang zu tun hatten und persönliche Sachen wenig oder so gut wie gar nicht zur Sprache kamen.
Wie kam es, dass er Ihnen das „Du“ angeboten hat?
Indem er eigentlich nur „Du“ gesagt hat und eines Tages meinte: „Du kannst auch Du sagen“. (…)
Sie beschreiben ihn beinahe als unnahbar. Das klingt erstaunlich, wenn man bedenkt, dass er sich viel in Schauspielerkreisen bewegt hat, dass er in den 30er Jahren in Filmen mit Stars wie George mitgespielt hat. Also in einer Welt gelebt hat, wo wahrscheinlich auch oberflächliche Freundlichkeiten einfach dazu gehörten. Konnte er sich da so ein Verhalten leisten?
Ich glaube nicht, dass er sich das geleistet hat, sondern das war sein Wesen. Er war damals auch noch nicht in der Emigration gewesen. Er war ja dann im Zuchthaus gewesen, hatte die Nachkriegszeit erlebt. Vielleicht ist er ein anderer geworden – ich weiß es nicht. Das kann ich nicht beurteilen, ich kannte ihn früher nicht. Ich kenne auch keine Leute, die ihn von früher kennen. Ich weiß nur einiges von Ihering, der ihn früher mal gesehen hat – aber auch Ihering hat ihn früher nicht gut gekannt. (…) Ihering schätzte Busch als Sänger und Schauspieler, vornehmlich als Schauspieler.
Sie sagen aber, dass Busch sich hauptsächlich als Sänger begriff.
Er hat sich vornehmlich als Sänger gesehen.
Hat er Ihnen das gesagt?
Ich kenne ihn wie gesagt seit 60 genauer und intensiver. Und was aus seinen Erzählungen von früher hervorging, hatte zu tun mit politischen Liedern, mit großen Veranstaltungen – das war ihm alles wichtiger als das Schauspielern. Das Schauspielern war mehr ein Geld-Verdienen.
Hatte das damit zu tun, dass er glaubte als Sänger, einen direkteren Kontakt zum Publikum zu haben?
Er war jemand, der sich mit den Texten, die er sang, identifizierte. Und es machte ihm Spaß, diese Texte zu singen. (…) Die Menge der Leute war ihm relativ gleichgültig. Ihm kam es mehr darauf an, was er sang.
War das Schallplatten-Machen auch ein Versuch, sich der Nachwelt zu erhalten?
Er hat sicher nicht an die Nachwelt dabei gedacht. Er hat das gemacht, weil’s ihm Spaß machte und weil’s ihm wichtig war zu singen. (…) Die Lieder waren ihm wichtiger als er selbst. Er hat ja nach 45 auch nicht viel Theater gespielt, sondern erst mal Lied der Zeit gemacht. Er ist erst wieder zum Theater gegangen, nachdem er Lied der Zeit sozusagen losgeworden war. Also seine Lieder und sein Gesang waren ihm immer wichtiger. Vielleicht war das auch schon in den 20er Jahren so, dass er mehr des Geldes wegen geschauspielert hat. Denn er hat ja auch damals viel gesungen bei KP-Veranstaltungen und so. (…)
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass er Anfang der 1930er Jahre im Begriff war, ein Star zu werden.
Er war jedenfalls in einem größeren Kreis bekannt. Aber die großen Rollen am Theater haben andere gespielt. (…) Er war zweifellos im Kommen. Er wäre sicher so 33, 34, 35 ein großer Star gewesen. (…)
Können Sie ein wenig von Ihrer Arbeit am Aurora-Plattenprojekt erzählen?
Die ersten Lieder haben wir nur auf Band aufgenommen. Er hat erst mal nur gesungen, um diese Lieder zu erhalten. Dass es dann zu der Schallplattenreihe Aurora kam, ist eher zufällig gekommen. Das hatte indirekt mit dem 13. August zu tun.
(Ende der ersten Kassette)
Wieso?
Weil Busch Anfang August 1961 eigentlich in Berlin singen sollte. Busch war aber zu dieser Zeit zur Kur in Bad Wiessee in Bayern. Auch am 13. August, als der Mauerbau begann. Und die alten Spanienkämpfer wollten, dass er bei ihrer Gedenkveranstaltung auftritt. Dadurch ist das erste Heft entstanden. Es gab bei uns ja nur eine Schallplattenfirma, die VEB Deutsche Schallplatten. Und nun kam Busch durch diesen Spanienabend, an dem er selbst nicht teilnehmen konnte, wieder in Berührung mit der Schallplattenfirma. Eigentlich hatte er ja nie wieder Schallplatten machen wollen, weil sie ihm damals Lied der Zeit verdorben hatten.
Warum hat er sich dann 1961 überreden lassen?
Weil er nicht hier war, weil er in Bad Wiessee war. (…) Er war zur Kur, als der Osten vom Westen abgeschnitten wurde. Und er ist erst zurückgekommen, als die Kur zuende war. (…) In Tegernsee, ganz in der Nähe, wohnte übrigens die Witwe von Tucholsky, die hat er auch besucht. (…) Die Spanienkämpfer, eine Organisation, die irgendwie zu tun hatte mit den Verfolgten des Naziregimes, kamen zu ihm und baten ihn, bei ihrer Veranstaltung aufzutreten. Und er war zu dieser Zeit nicht da. Und wer dann auf die Idee kam, die Platte zu machen, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich er selbst …
Das war der Wiederbeginn seiner Schallplattentätigkeit?
Ja, weil ja nur einer Schallplatten machen konnte, das war der VEB Deutsche Schallplatten.
Seine ehemalige Firma.
Sozusagen. Und die presste diese Platten für die Spanienkämpfer. Es gab also ein Heft nur für die Spanienkämpfer. Das waren alte, umgeschnittene Aufnahmen, die man eben nur beim VEB Deutsche Schallplatten umschneiden konnte. (Fetting steht auf, holt das Plattenheft und zeigt es mir)
Das war also eine limitierte Auflage extra für diesen Anlass. Haben Sie die vielen Texte zusammengestellt?
Ja, mit Busch zusammen. Mir war dieses Spanien-Thema nicht so vertraut, sodass ich das allein auch gar nicht hätte machen können. Das sind alles Sachen von Busch, die da drin sind, die er mal gesammelt hatte. Ich weiß nicht, ob da noch ’ne Widmung drin ist …
„Rauhe Klänge aus dem rauen Norden über Spaniens roter Erde – mit freundlichem Gruß…“
Jedenfalls sollte Busch 1961 zum 25. Jahrestag (Ende des Spanienkriegs, JV) singen. Und da er wusste, dass er da nicht konnte, weil er zur Kur in Bad Wiessee sein würde, kam er auf die Idee, eine Schallplatte zu machen. Es lag ihm sicher am Herzen, denn er wollte schon in den 30er Jahren in Holland eine Reihe mit Schallplatten machen. Das tat er ja dann auch mit den Aurora-Heften. So kam er wieder mit dem VEB Deutsche Schallplatten in Berührung.
Hier ist auch das Symbol der Internationalen Brigaden abgebildet, dieses dreieckige Emblem. Und hintendrauf steht: „Herausgegeben vom Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer in der Deutschen Demokratischen Republik, Unter den Linden 54“. Das war offenbar die zuständige Institution. Von Franz Dahlem ist auch ein Text drin, das Vorwort von Heinrich Mann …
Die Texte hat Busch alle selbst ausgesucht. Das war ihm wichtig.
Wie erklären Sie sich seinen Meinungsumschwung, auf einmal wieder Schallplatten zu machen?
Wieder Schallplatten zu machen, hat auch viel mit Eisler zu tun. Denn Eisler war der Meinung, dass er wieder mit Liedern an die Öffentlichkeit gehen müsse. Eisler hatte auch einige Lieder begleitet, wir hatten ja schon vorher in der Akademie seit 60 Bänder aufgenommen. Busch wollte alle seine Lieder wieder auf Band haben fürs Archiv. Als er dann wieder mit der Schallplatte in Berührung kam, hat das vielleicht seiner Eitelkeit ein bisschen Ansporn gegeben. Das Geld war es sicher nicht, denn Geld hatte er genug.
Warum hatte er so viel Geld?
Er war ja Nationalpreisträger. Der Preis war dotiert mit 25.000, 50.000 und 100.000 Mark – je nach Klasse. Und er hat den Nationalpreis zweimal gekriegt, einmal 25.000 und einmal 50.000 Mark. Dann hat er die höchste Gage gekriegt, die es in der DDR gab. Die betrug 4000 Mark pro Monat, pro Theater. Und da er zeitweise, zwei oder drei Jahre, am Deutschen Theater und am Berliner Ensemble engagiert war, bekam er von beiden Theatern 4000, also insgesamt 8000 Mark. Und er hat so gut wie nichts ausgegeben, weil er ein ganz solider Mensch war. Er war sehr bescheiden, wohnte zur Miete: einmal im Haus in der Heinrich-Mann-Straße und später in der Leonhard-Frank-Sraße, wo vorher der Langhoff gewohnt hatte. Dessen Jungs mussten dann da raus, der alte Eigentümer war ein Fabrikant gewesen, der gestorben war, und die Frau war nach 45 nach der Enteignung nach dem Westen gegangen. Aber Busch wohnte in diesen Häusern nur zur Miete. Und das Häuschen auf Hiddensee hat erst seine zweite Frau besorgt. Denn ihre Tochter war verheiratet mit dem Sohn des Intendanten vom Metropol-Theater, und der hat gewusst, wo was frei war.
Hat er das Geld im Westen angelegt?
Nee, das konnte man nur hier anlegen. Das musste man dann in West-Mark umtauschen. Nein, er hatte hier ein Konto bei der Sparkasse am Alex. Da hat er das Geld aufs Sparkonto gebracht. Sonst ist nichts gewesen. (…) Luxus war ihm gleichgültig. Als ich ihn kennenlernte, zu Tetes Zeiten, da war das so: Wenn er in die Stadt fuhr, dann fast immer, um Aufnahmen zu machen. Dann zog er sich an und wir stiegen in sein Auto und Tete saß am Steuer. Das war ein Skoda, der hieß, glaube ich, Felicia. Gut, das war jetzt nicht gerade der Wagen der Allgemeinheit …
Ist er selber auch gefahren?
Nein, gefahren hat ihn immer Tete. Ich weiß gar nicht, ob er den Führerschein hatte. Nach Tetes Tod habe ich ihn kurze Zeit gefahren, nachher dann hat Irene ihn gefahren. Aber selbst gefahren ist er nie.
Der am besten bezahlte Schauspieler in der DDR
Gab es noch andere Schauspieler in der DDR, die ähnlich hohe Gagen bekommen haben?
Busch war der einzige, der gleichzeitig an den beiden großen Theatern engagiert war und dadurch 8000 verdiente. Was die Gage anging gab es noch den Kleinau, der 4000 kriegte. Der war aus dem Westen ans Deutsche Theater gekommen. Hat sich später totgefahren. (…) Bis in die 60er Jahre hinein gab es bestimmt keinen, der mehr verdiente als Busch.
Hat Busch selber darauf geachtet oder darauf bestanden, gut bezahlt zu werden?
Ich glaube, man hat es ihm angeboten. Würde ich vermuten. Jedenfalls hat er keinen Theatervertrag unterschrieben.
Ging das dann per Handschlag?
Nee, alles so. Er hatte die Verträge zwar zu Hause, aber nicht unterschrieben. Er kriegte auch so das Geld.
Weil er ungern etwas unterschrieb?
Nein. Verträge unterschrieb er einfach nicht – jedenfalls zu DDR-Zeiten nicht mehr.
Seine Parteimitgliedschaft muss er doch einmal unterschrieben haben …
Damals, als die KPD nach 45 wieder gegründet wurde, muss es tatsächlich so gewesen sein. In die SED ist er ja nie eingetreten. In die SED wurde man aus der KPD übernommen. Das geschah auf Veranstaltungen, auf denen neue Parteibücher überreicht wurden – dadurch war man dann in der SED. Das weiß ich aber nicht mehr genau, wie das vor sich ging. (denkt nach) War das ein KPD- oder ein SED-Buch, was er da hatte? Ich glaube, es ist schon ein SED-Buch gewesen. (…) Jedenfalls wurde man durch die Vereinigung von KPD und SPD als KPD-Mitglied automatisch SED-Mitglied, es sei denn, dass man rausging. Und dadurch wurde Busch automatisch SED-Mitglied. Das Parteibuch bekam man dann entweder auf einer dieser Versammlungen oder man kriegte es zugeschickt. (…) Dann gab’s 50/51 die Überprüfung, und da hat er das Parteibuch zerrissen. Und er weigerte sich, zu einer weiteren Überprüfung zu gehen. (…) Nach seinen Äußerungen ist er zur ersten Überprüfung hingegangen und hat dort das Parteibuch zerrissen, also durchgerissen in zwei Teile und dann die Kommission verlassen. (…) Welche Kommission das genau war, wie die zusammengesetzt war, weiß ich nicht. Bei Prominenten wie Busch waren es sicher andere Leute als bei Studenten wie mir. Ich war damals Student, als die Überprüfung stattfand.
Hat es ihn genervt, dass er von Leuten überprüft werden sollte, die nicht seine Kragenweite hatten?
Nein. Ihn hat genervt, dass man ihm Fragen stellen wollte. Dass er sich überhaupt äußern sollte, dass man ihn überprüfen wollte. Da hat er das Parteibuch zerrissen.
Wollte er nicht seinerseits Fragen beantwortet haben? Warum er zum Beispiel Ende der 30er Jahre im Exil kein Visum für die Sowjetunion bekommen hatte?
Nein, das stimmt nicht ganz. Erst hat er ja ein Visum gekriegt. Er ist ja damals zunächst in die Emigration in den Westen gegangen. Dann ist er 35 in die Sowjetunion gegangen. Und in die Sowjetunion kam nur, wer von den Russen überprüft worden war. Also, man brauchte eine Einreisegenehmigung, man konnte nicht nach Russland emigrieren sozusagen, sondern nur einreisen. Er kam auf Einladung in die Sowjetunion und kam dann durch Pieck, als die Überprüfungen begannen und die Lager aufgefüllt worden sind und es in Spanien losging, wieder raus. Der Pieck hat ihn nach Spanien geschickt.
Woher wissen Sie das?
Durch ihn weiß ich das. Das hat er mir gesagt. Pieck hat viele Leute damals weggeschickt, zum Beispiel Piscator, der war damals in der Sowjetunion, weil er wahrscheinlich wusste, dass nun eine gewisse Überprüfung oder Verfolgung der Leute einsetzte. Der wollte die Leute schützen. So sind viele gen Westen gekommen. Denn man konnte aus der SU nur raus, wenn man wieder ein Visum hatte. (…) Pieck war damals der KPD-Vorsitzende in der Sowjetunion.
War Busch dem Pieck dafür dankbar?
Ja, ja. Mit Pieck hat er sich gut verstanden. (…)
Was wusste Busch von Stalins Verbrechen?
Man wusste das alles erst nach Stalins Tod – seit Chruschtschow. Man wurde ja vorher auch getäuscht. Da hieß es dann zum Beispiel in der deutschsprachigen Zentralzeitung, der DZZ, über Carola Neher, sie sei eine Spionin. Und ich nehme an, dass die Leute das damals glaubten. Was eben Josef Stalin gesagt hat und was in der Zeitung stand, das wurde ernst genommen. Das hat sicher auch Busch ernst genommen. Auch Kolzow, der Leiter der Prawda, ist damals umgekommen. Und Maria Osten, die Busch gut kannte, war mit Kolzow zusammen. Aber Busch hat diese schlimme Zeit eigentlich nicht mehr miterlebt, er war da schon im Westen. Ich vermute, dass die Leute das geglaubt haben, was offiziell verlautbart wurde, dass das Agenten waren und Saboteure. Das haben hier selbst lange nach 45 noch viele Leute geglaubt. Dabei sind ja wirklich nicht wenige zu Tode gekommen, andere sind aus leitenden Positionen entfernt worden wie Dahlem, der wurde später hier Staatssekretär. Die waren wahrscheinlich überzeugte Parteimitglieder und haben geglaubt, was verlautbart worden ist. (…)
Wie wichtig war Busch die Partei? Wenn er dieses zerrissene Parteibuch in einer Extra-Schatulle aufbewahrt hat, dann war ihm die Partei offenbar nicht ganz gleichgültig …
Er hat eben bestimmte Sachen aufgehoben. Das Parteibuch war ihm wahrscheinlich die Sache wert.
War er stolz drauf, das er es zerrissen hat?
Ich würde es so deuten, dass er stolz drauf war. (…) Es ist schwer, bei ihm solche Schlüsse zu ziehen. Er war ein in gewisser Weise gefürchteter Mann. Es hat sich keiner direkt mit ihm abgegeben. Und Freunde in dem Sinn hat er auch nicht gehabt, was wahrscheinlich an ihm selbst lag.
Wie war das für Sie, nachdem Sie das Buch über ihn geschrieben hatten? Gab es Resonanz?
Busch war ’ne große Persönlichkeit, die allgemein sehr geschätzt wurde. Das war in der DDR oder überhaupt in Deutschland einer der großen Künstler. Aber mein Buch über ihn hat mich nach der Veröffentlichung nicht mehr interessiert – das gilt für alle meine Bücher: weder wie es sich verkauft hat, noch wer es gelesen hat, wer es beanstandet oder gutgeheißen hat.
Gab es Leserbriefe?
Ja, sicher. Aber die habe ich alle weggeschmissen.
Waren es lobende oder ablehnende Stimmen?
Die meisten waren eigentlich lobend. Viele haben sich gefreut, dass da ein Busch-Buch erscheint. Diese Stimmen habe ich noch in Erinnerung.
In Ihrem Buch beschreiben Sie Busch vor allem als Schauspieler. Das steht ein wenig im Gegensatz zu der Beschreibung von Busch, die Sie jetzt geben, wo Sie mehr den Sänger hervorheben …
Das Buch ist fertig geworden zu einem Zeitpunkt, als der Schauspieler gerade von der Bühne gegangen war und bis dahin fast nur gespielt hatte – der Sänger tauchte gerade erst wieder auf. Für mich hat sich dann durch meine Arbeit an den Aurora-Platten und durch mein Bekanntsein mit ihm das Bild geändert. Der Gesang stand im Mittelpunkt. So schätze ich auch seine Interessen ein. Das kommt daher, dass er sich mehr mit Liedern beschäftigt hat als mit Rollen. Mit Rollen hat er sich nur beschäftigt, wenn er abends einen Auftritt hatte, dann ist er noch mal seine Rolle durchgegangen, hat sich auch mal abhören lassen. Weiter haben ihn seine Rollen, jedenfalls zu meiner Zeit, nicht mehr interessiert.
Sie hätten wahrscheinlich das Buch anders geschrieben, also mehr den Sänger in den Mittelpunkt gestellt, wenn Sie ein paar Jahre später mit dem Projekt beauftragt worden wären …
Also: Wenn ich es geschrieben hätte, hätte ich es sowieso anders geschrieben. Aber so ist es ja zum größten Teil nur mit Zensur von Busch entstanden.
Stehen Sie nicht mehr zu dem, was Sie damals geschrieben haben?
Doch, das schon. Aber es ist nicht das drin, was eigentlich drin sein müsste, um Busch richtig einzuschätzen.
Was müsste denn drin sein?
In erster Linie seine Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von allem. Und dass ihm das Singen das Wichtigste war.
Unabhängigkeit auch von der Politik?
Auch, ja. Da hat er sich eigentlich auch nicht drum gekümmert. Das kann aber auch daran liegen, dass er zu dieser Zeit politisch nicht mehr interessiert gewesen ist. Er konnte ja keinen Einfluss mehr ausüben, während er bis 33 einen gewissen Einfluss ausüben konnte oder sich zumindest eingebildet hat, durch seinen Gesang die Leute noch überzeugen zu können.
Hat er diesen Glauben später verloren?
Ich glaub schon, ja. Er war zwar beliebt, auch bei jüngeren Leuten. Aber er hat schon gemerkt, dass man damit wenig bewirken kann.
War er manchmal auch frustriert?
Nee, nee. Jedenfalls hat er es nie gezeigt. Es ging immer weiter bei ihm. Man hatte den Eindruck, dass er es eilig hatte, seine Lieder alle auf Band zu bringen und nachher auf Schallplatte – so viel er konnte. (…)
Hat er sich auch mal mit anderen Dingen beschäftigt als mit seiner Arbeit, zum Beispiel auf Hiddensee, wo er sich sehr wohlgefühlt haben soll?
Er hat sich eigentlich überall, wo er war, wohlgefühlt. Es sei denn, er musste wohin gehen, wo er nicht hin wollte. Zum Beispiel bei Akademie-Sitzungen, wobei er auch da freiwillig hingegangen ist – er hätte da nicht hinzugehen brauchen. Aber selbst auf Hiddensee hat er seine Texte mitgenommen und hat gesungen.
Hat er privat auch andere Sachen gehört als seine eigenen Lieder?
Radio hat er nie gehört. Fernsehen hat er auch nicht viel geschaut. Nachrichten haben wir ab und an mal geguckt. Auch für Sport hat er sich nicht besonders interessiert. Nee, er hat sich nur für sich interessiert, also für seine Lieder. (…) Er hat auch nicht groß wahrgenommen, was an anderer Musik in seiner Zeit gespielt wurde. Er war da wirklich ganz einseitig. Da war er ganz eigen, und ich glaube, so einen gibt’s auch kein zweites Mal.
Nun haben sich ja auch bildende Künstler mit Busch beschäftigt. Wie gefiel ihm das?
Ronald Paris hat mal ein Bild gemalt, auf dem Busch aussieht wie ein Säufer. Da ist auch ein kleiner Tisch drauf mit einer Flasche und einem Glas.
War Busch beleidigt?
Nö. Busch konnte man nur beleidigen, wenn man seine Lieder angriff. Mit Äußerlichkeiten nicht, das hat er gar nicht wahrgenommen. Dazu kreiste er zu sehr um sich selbst und um seine Lieder. (…) Das ist mein Eindruck. Das Bild, das ich von Busch seit der Akademie-Zeit, also seit 1960, habe, ist ein eitles in Bezug auf seine Arbeit. Eitel als Person war er nicht. Was ihm immer am Herzen gelegen hat, waren seine Lieder. (…) Wenn ihn jemand verehrt hat, mochte ihm das schmeicheln, aber das hat er sich nicht anmerken lassen. Er hat auch fast nur Leute an sich heran gelassen, die er kannte, Fremde so gut wie gar nicht. Wenn dann Leute zu ihm kamen, hat er sich schon im Mittelpunkt gesehen und hat meistens seine Bänder vorgespielt oder seine Platten.
(Ende der ersten Seite der zweiten Kassette)
Lassen Sie uns noch einmal über Ihre Arbeit an dem Aurora-Projekt reden. Worin bestanden Ihre Aufgaben?
Nach dem ersten Spanienheft, das ja aus Umschnitten bestand, kamen neue Aufnahmen hinzu. Und für diese neuen Aufnahmen habe ich die Musiker ausgesucht, koordiniert und auch bezahlt. Die bekamen ihr Geld gleich auf die Hand, ich glaube: 40 Mark pro Stunde. Das Geld kam von der Akademie.
Gab es Auflagen von der Akademie, was die Kosten betrifft?
Nein. Das wurde eingeplant. Wir brauchten meinetwegen 10.000 oder 1000.000 Mark im Jahr. Das hat die Akademie viel Geld gekostet. Eine Einzelplatte kostete im Verkauf 7,50 und ein Doppelheft, also zwei Platten, waren 15 Mark. Und die Akademie hat, wenn ich nicht irre, zwei Prozent gekriegt. Busch hat acht Prozent gekriegt. Der Rest waren Unkosten für die Schallplatte beziehungsweise für die Akademie.
Hat Busch das ausgehandelt?
Nee, das habe ich ausgehandelt. Ich wusste, was ein Verlag zahlt, wenn ein Buch gemacht wird. Ich selbst habe pro Aufnahmetermin 50 Mark gekriegt, und es gab meistens zwei Aufnahmetermine in der Woche. Die Lieder wurden teilweise 20, 30 mal aufgenommen. Außer dem Direktor, der die Verträge unterschrieben hatte, und dem Haushaltsmann, der das Geld bezahlte, wusste das in der Akademie wahrscheinlich kaum jemand, was das kostete.
Wie hoch war die Auflage der Aurora-Platten?
Immer 5000 Stück. Sowohl bei den doppelten wie bei den einzelnen. Die waren meist recht schnell verkauft.
Gab es mehrere Auflagen?
Teilweise erschienen die Lieder später dann auf großen Platten ohne Heft. Von den Aurora-Platten selbst gab es bei Tucholsky und den Spanienliedern mehrere Auflagen. Die Spanienlieder haben sich am besten verkauft. Das auflagenstärkste war das erste Aurora-Spanienheft. (…) Ich habe dann um 70 aufgehört mit dieser Arbeit und Busch nur noch sporadisch gesehen und gesprochen. Weil wir uns öfter mal erzürnt hatten, und dann kam er immer wieder an. Irgendwann habe ich dann mal Schluss gemacht. Und dann begann die „Rote Reihe“.
Gab es einen bestimmten Anlass?
Nee, einfach so. Ich habe mich rausgeredet, dass ich jetzt mit Büchern zu tun hätte. Ich hatte das lang genug gemacht, fast zehn Jahre lang. Das war dann irgendwann Zeitvergeudung, weil er ein Lied 20, 30 mal aufnahm und ihm trotzdem keine Fassung gefiel. Es war nicht so, dass diese Arbeit Routine gewesen wäre. Es war immer wieder neu und machte immer wieder Spaß, ihn zu erleben. Aber nachher war es vertrödelte Zeit, weil er älter wurde und noch unzufriedener war mit den Aufnahmen als er früher schon war.
Haben Sie ein Lieblingslied von ihm?
Eigentlich nicht, nein.
Hören Sie die Lieder heute noch?
Ab und an mal. Da spiele ich durch die Bank die Platten durch. Die Becher-Lieder liegen mir nicht so sehr, weil ich die Texte nicht so mag. Aber auch sonst habe ich keine besonderen Vorlieben. (…)
Was für Musik mögen Sie sonst gern?
Armstrong mochte ich immer, Gillespie auch. Aber ich höre nicht mehr viel Musik. (…)
Sind Sie Busch gegenüber noch mal rückfällig geworden nach 1970? Haben Sie sich noch mal überreden lassen?
Das letzte war ein Brecht-Heft, da ist die Platte gar nicht mehr fertig geworden. Ich habe das Heft da (holt es und zeigt es mir, der Titel lautet „An die Nachgeborenen“). Danach kam dann die „Rote Reihe“ mit jeweils einer kleinen Platte, zehn oder zwölf sind da erschienen und so weit ich weiß auch immer 5000 pro Heft. Das lag an der Papierknappheit in der DDR, dass da nicht mehr erschienen sind. (…) Anfang der 70er habe ich jedenfalls aufgehört und habe dann bis 78 noch fest bei der Akademie der Künste gearbeitet und danach bei der Akademie der Wissenschaften.
Waren Sie auf Buschs Beerdigung?
Nein. Ich war nicht eingeladen. Dass da NVA-Offiziere Spalier gestanden haben, hätte Busch übrigens nicht gefallen, denn er hatte mit dem Militär nichts im Sinn.
Als dann in den 80er Jahren die große Busch-Bildbiografie an der Akademie entstand, hat man Sie da um Rat gefragt?
Nein, nein.
Haben Sie es gelesen?
Ja, ich hab es gekauft oder geschickt gekriegt und gelesen.
Wie finden Sie es?
Ich fand’s nicht schlecht. Aber gut fand ich’s auch nicht.
Was hatten Sie auszusetzen?
Oh, das weiß ich heute nicht mehr. Das ist zu lange her.
Ich finde es erstaunlich, dass man sich damals gar nicht an Sie gewandt hat.
Ich glaube nicht, dass man mich als Fachmann gesehen hat oder heute als Fachmann sieht.
Immerhin sind Sie derjenige gewesen, der die 60er Jahre hindurch bei Busch am meisten ein- und ausging. Im Archiv finden sich Ansichtskarten, die Sie an Busch geschrieben haben. Würden Sie sagen, dass Sie befreundet waren?
Naja, „befreundet“ kann man nicht sagen. Denn Freunde hatte er so gut wie gar nicht.
Das Ehepaar Henselmann?
Der Architekt? Glaub ich nicht.
Hat er denn gar keine Freunde gehabt? Wie ist es mit Eisler?
Freunde würde ich nicht sagen. Das waren alles mehr oder weniger gute Bekannte. Ich würde mich auch nicht als Freund bezeichnen. Ich hab ihn gut gekannt.
Sie waren auch zu den Geburtstagen immer bei Busch. War das dann ein alljährlicher Pflichttermin?
Nein, das war sozusagen ein Spaßtermin. Aber unter Freundschaft verstehe ich doch etwas anderes: eine gewisse gefühlsmäßige Innerlichkeit und ein Vertrauen seinerseits oder ein Vertrauen meinerseits – das fehlte.
War Busch auch mal bei Ihnen zu Hause?
Ja, zwei-, dreimal – aber zufällig, weil er mich abgeholt hat zu Aufnahmen. Sonst nicht. Er ging auch sonst überhaupt zu keinem. Er kam bloß kurz rein, Tete saß unten im Wagen, und er wartete, bis man angezogen war und den Mantel oder die Jacke anhatte.
Haben Sie sich privat mal auf ein Bier getroffen?
Nein. Er hat eigentlich nie Bier getrunken. Meistens trank er Wasser.
Was machte denn Spaß mit ihm?
Er war eine von seiner Kunst besessene Figur. Das war packend.
Hat er Sie nicht manchmal auch zur Weißglut gebracht mit seiner Akribie?
Eigentlich nicht. Ich bin ein Typ, der sich gar nicht ärgert. (lacht)
Auch nicht, wenn man Ihre Texte auseinandernimmt?
Auch das interessiert mich nur in geringem Maße.
Dann waren Sie ja genau der Richtige für dieses Buchprojekt mit Busch …
Wahrscheinlich, ja.
Wie hat er Ihnen denn klargemacht, dass er Textpassagen geändert haben möchte?
Er hat die gestrichen. Ich habe dann nachgefragt, und dann hat er erklärt, warum er dieses oder jenes nicht oder nicht so haben will. Also habe ich was anderes draus gemacht und ihm vorgeschlagen. Er war dann entweder einverstanden oder nicht. Und dann ist die Stelle eben weggeblieben oder so geworden wie er es wollte und ich geschrieben habe. Ich habe noch einige gestrichene Seiten hier irgendwo liegen.
War das anregend, mit ihm den Text zu besprechen oder war das eher diktatorisch von seiner Seite?
Nein, diskutieren konnte man mit ihm gar nicht. Man hat sich mit ihm geeinigt, würde ich sagen. Sehr kurz und bündig. Er sagte: „Das will ich nicht“, und bei bestimmten Sachen wusste man: Da bleibt er sowieso dabei. Dann hat man gar nicht erst nachgehakt. Bei anderen Sachen hat er Ja gesagt, dann wurde es eben so gemacht. Das war relativ schnell durchschaubar und klar, sodass man wusste, was er wollte und was nicht und wo es gar keinen Zweck hat, mit ihm zu reden. Also ließ man manche Sachen lieber gleich weg und schlug sofort was anderes vor.
Bevorzugte er einen sachlichen Stil beim Schreiben?
Ja, kurz und direkt. Das war das A und O bei ihm.
Das russische Busch-Buch von Schneerson …
… das war ihm zu gefühlsmäßig und zu blumig.
Würden Sie Schneerson als Freund von Busch sehen?
Ob Busch ihn als Freund bezeichnet hätte, weiß ich nicht. Schneerson den Busch sicher. Wenn er aus Russland nach Deutschland kam, war er entweder auf Einladung von Busch hier oder auf Einladung eines Verlags. Aber bei Busch gewohnt hat er nicht. Untergebracht war er meistens durch die Akademie. Bei Busch hat keiner gewohnt, bei Busch konnte auch keiner wohnen. Es gab kein Gästezimmer. Es war alles sehr freundlich, aber auf Gäste eingerichtet war man nicht. Das Haus war schon gastfreundlich: Man konnte alles haben, man konnte alles sagen. Es war zeitweise, zu Tetes Zeiten, gute Atmosphäre; man konnte sich benehmen, wie man wollte und sich gehen lassen, wie man wollte.
Was heißt das? Man konnte die Füße auf den Tisch legen?
Ja, ja. Das hat keinen gestört. Das war sehr leger und zwanglos oder sagen wir: gleichgültig bei ihm. Er hat auch auf niemanden Rücksicht genommen, hat sich benommen, wie er es für richtig hielt. Das hat aber nicht aufdringlich gewirkt und hat keinen gestört, er hat auch keinen dadurch beleidigt, oder so was. Er war zu allen Leuten sehr freundlich. Es gab eben keine große Unterhaltung bei ihm. Wenn jemand kam, dann hat er ihm seine Platten oder Bänder vorgespielt und meistens den Gast beobachtet, um zu erfahren, wie das, was der gerade hört, ankommt.
Sollten die Zuhörer dann auch was dazu sagen, Kritik äußern?
Das wiederum hat ihn meist schon nicht mehr interessiert. Weil er eigentlich mit allem, was er jemals gemacht hat, unzufrieden war. Es gibt eigentlich nichts auf diesen Platten, was ihn zufrieden gestellt hat. Zufriedenheit mit seinen Liedern kannte er wahrscheinlich überhaupt nicht. (…)
(Exkurs über Tete und Irene)
Busch kam gegen Ende der 70er Jahre in eine Nervenklinik. Haben Sie ihm die Krankheit angemerkt?
Solange ich Busch erlebt habe, und das war bis eine Woche bevor er in die Heilanstalt nach Bernburg gebracht worden ist, war er völlig normal. Seine Frau wollte ihn, so geht die Sage, loswerden, abserviert haben. Das hat man sich jedenfalls erzählt. Ich hab ihn dann auch nie wieder gesehen.
Aber er hat doch noch seine Geburtstage in Berlin gefeiert, also jedenfalls seinen achtzigsten …
Da war ich nicht.
Sie meinen also, dass er gar nicht krank gewirkt hat?
Ich kann nur sagen, dass er eine Woche bevor er in die Klinik kam, völlig normal war. Also, wie immer. Wenn man seinen Zustand als normal bezeichnen will … egozentrisch war er immer. Aber in verwirrtem Zustand habe ich ihn nie erlebt. (…)
Haben Sie noch Erinnerung an Buschs Reaktion auf die Biermann-Ausbürgerung? Wie kam es zu der deutlichen Stellungnahme gegen Biermann im ND?
Das hat sicher sie gemacht. Sie hat vieles hinter seinem Rücken gemacht und hatte gute Beziehungen nach oben. Sie war ein strammes Parteimitglied. Busch war ja nicht mehr direkt parteigebunden, auch der Staat kümmerte ihn nicht besonders. Finanziell war er völlig abgesichert und arbeitsmäßig auch: Was er machen wollte, konnte er machen, und die Akademie hat es ihm bezahlt. Busch hat übrigens auch so gut wie keine Zeitung gelesen.
Hatte Busch eine Meinung zu Biermanns Liedern?
Auch nicht. Das hat ihn, soweit ich weiß, gar nicht interessiert.
Hat Busch überhaupt registriert, dass es Liedermacher gab, dass es die Singebewegung gab?
Ja, ja. Der Biermann war öfter im Hause. Er kam zu den Geburtstagen mit seiner Gitarre an.
Hat er auch was gespielt?
Er wollte. Aber im Hause des Sängers war nichts zu singen. (lacht) Busch hat seine Bänder vorgespielt, und da kam Biermann nicht zum Schuss. Ich würde sagen: Er hat keinen gestört, er war ein Zuhörer wie die anderen.
Biermann hat ja auch „Spaniens Himmel“ auf Schallplatte aufgenommen …
Sicher hatte Biermann irgendwelche Interessen an Busch. Aber ich habe Biermann nicht so gut gekannt, dass ich darüber Genaueres sagen könnte. (…)
Interview: Jochen Voit
Foto: unbekannt
(Textfassung autorisiert von Dr. Hugo Fetting am 17. 12. 2005)

Eva Kemlein
über Ernst Busch und: ihr Leben in der Illegalität in Berlin und die wieder aufblühende Kulturszene der Stadt nach 1945
„Busch musste da sein, wo seine Bühne war.“
(Gespräch am 23. Januar 2004 in Berlin)
Eva Kemlein ist Jahrgang 1909. Die Tochter wohlhabender jüdischer Eltern wird am 4. August in Charlottenburg geboren. An der Letteschule Berlin erhält Eva Kemlein (damals noch Eva Graupe) ihre Berufsausbildung als Medizinisch- Technische Assistentin. Das Fach Fotografie gefällt ihr am besten. 1933 heiratet sie Herbert Kemlein („das war ein bunter Vogel, ein richtiger Vagabund“), mit dem sie per Motorrad nach Griechenland fährt, wo die beiden vier Jahre leben und journalistisch arbeiten. 1937 kommt es zur Ausweisung aus Griechenland, es folgt die Scheidung der „Mischehe“ und die Rückkehr nach Berlin. Eva Kemlein bleibt in Berlin bei ihrer Mutter, der Vater ist inzwischen gestorben, die beiden Brüder sind im Exil. Sie lernt den 21 Jahre älteren Schauspieler Werner Stein kennen und lieben. Mit seiner Hilfe überlebt sie den Nationalsozialismus – als „Illegale“ mitten in der Reichshauptstadt.
1945 beginnt sie als Fotoreporterin für die Berliner Zeitung zu arbeiten und macht viele heute berühmte Aufnahmen in der Trümmerstadt Berlin. Doch ihre große Leidenschaft wird die Theaterfotografie. Mit ihrer Kamera dokumentiert sie, obgleich sie im Westen lebt, 40 Jahre lang hauptsächlich Ost-Berliner Theatergeschichte. Im August 2004 stirbt Eva Kemlein in Berlin. Ihr rund 300.000 Negative umfassendes Archiv befindet sich im Besitz des Berliner Stadtmuseums.
23. Januar 2004: Eva Kemlein(94) lebt seit fast 60 Jahren in der Künstlerkolonie am Laubenheimer Platz. Wir sind um 15 Uhr verabredet. Mit der U-Bahn fahre ich zum Breitenbachplatz und laufe zum Steinrückweg 7, wo gerade eine Frau, die einen kleinen Hund auf dem Arm hat, die Haustür aufschließt. Während ich, den Fuß in der Tür, das Klingelschild suche, ist sie schon im Treppenhaus. Oben vor der Wohnungstür begegnet mir die Frau wieder, sie ist auf dem Weg nach unten – der Hund ist verschwunden. Ich läute bei Eva Kemlein und warte. Am Telefon hat sie gesagt, dass sie eine Weile braucht, bis sie den Weg zur Tür schafft. Es dauert vier Minuten. Eva Kemlein ist unglaublich klein, sehr freundlich und hat ein verschmitztes Lächeln. Der Flur ihrer Wohnung ist mit Querstangen an den Wänden ausgestattet, an denen sie sich entlanghangelt, um ins Wohnzimmer zu kommen. Ansonsten sieht es so aus, als hätte sich in den letzten Jahrzehnten nicht allzu viel verändert in diesen Räumen. Auf dem mit weinrotem Stoff bezogenen Sofa hat sich, so erzählt sie mir, in den 1940er Jahren schon Ernst Busch ausgestreckt. Ouzo, der Cocker, begrüßt mich fröhlich, er sei gerade vom Gassigehen zurück, sagt Eva Kemlein. Ich stelle die mitgebrachten Blumen ins Wasser und wir fangen an zu reden. Meine Gesprächspartnerin erweist sich als sehr ausdauernd beim Beantworten meiner Fragen. Als 90 Minuten Busch-Talk um sind, reden wir noch zwei Stunden ohne aufzunehmen weiter über ihr Leben – vielleicht das interessantere Gespräch. (Eva Kemlein starb sechs Monate später, wenige Tage nach ihrem 95. Geburtstag)
JV: Sie lebten von 1942 bis 1945 mit ihrem Lebensgefährten Werner Stein in Berlin im Untergrund. Als der Krieg vorbei war, konnten Sie sich endlich wieder frei in der Stadt bewegen. Wie kam es, dass Sie hierher in diese Wohnung in der Künstlerkolonie am Laubenheimer Platz gezogen sind?
Eva Kemlein: Mein Lebensgefährte war ja Schauspieler. Und ihm war in unserer illegalen Zeit eine Frau begegnet, die ihn kannte von seiner Bühnentätigkeit. Und die wollte ihn begrüßen, das hatte er aber abgelehnt, weil es viel zu gefährlich war, auf der Straße Menschen zu begegnen, die ihn kannten. Der wollte er nun, nachdem alle Gefahren beseitigt waren, erklären, warum er sich damals nicht zu erkennen gegeben hatte. Und dafür sind wir hierher gegangen. Und kamen hier in dieses Haus rein und begegneten unserm Gegenüber (sie zeigt zum Fenster). Das war nicht hier, sondern ein paar Querstraßen weiter in der Laubenheimer Straße. Und wie die erfuhren – wir hatten mit denen Flugblätter gemacht – , dass wir das waren, da haben die gesagt: „Bei uns gegenüber is ’ne Wohnung frei, das wissen wir, da waren Nazis drin, die kommen bestimmt nicht zurück. Und wenn einer Anspruch auf ’ne Wohnung hat, dann seid ihr das.“ Und so sind wir an die Wohnung in der Laubenheimer gekommen. Das war 1945. Und 1952 sind wir dann hierher in den Steinrückweg gezogen, weil die Wohnung in der Laubenheimer sehr viel teurer war. (…) Es ist ein sehr, sehr schönes Wohnen hier in jeder Beziehung. Und ich denke, dass ich hier auch mein Lebensende noch erleben werde (lacht).
Sie sind damals 1945 gleich auf die Straße gegangen, als es wieder möglich war, und haben fotografiert. Sie haben ihre Leica über den Krieg gerettet und sind dann bald bei der Berliner Zeitung untergekommen…
Ja, die haben mich hier rausgeholt. Da kamen zwei Männer in die Laubenheimer Straße. Mein Mann war ein ganz aktiver, sehr überzeugter Sozialist, kein Funktionär, aber ein ganz überzeugter Sozialist vom Herzen und vom Geist her. Also ein wunderbarer Mann war das, muss ich immer wieder betonen, der wirklich sein Herzblut und seinen Kopf dafür gegeben hat.
Sind sie durch ihn auch in diese Kreise gekommen, die Flugblätter gegen Hitler hergestellt haben?
Ja. Ich habe dabei eine Partnerschaft mit ihm gehabt, aber der Kopf war natürlich er. Und er hatte nur zwei junge Studenten damals miteinbezogen in diese Flugblatt-Aktion, der geistige Kopf war er. Und die beiden Jungen – Bulgaren waren das – haben mitverteilt. Das musste ja alles genau durchdacht sein, wie man das aufgezogen hat. Das war ja alles mit Lebensgefahr verbunden, ist ja klar.
Wann war das?
Das war im Laufe unserer Illegalität. Wir sind illegal geworden, erst ich und dann er auch, 1942. Also wir haben drei Jahre durchstehen müssen, wobei wir eigentlich immer gefährdet waren.
Dennoch haben sie die Gefahr auf sich genommen und sich mit diesen Flugblättern gewehrt und auf die Weise noch gefährlicher gelebt.
Das hat er alles so unglaublich organisiert. Zum Schluss dieses Flugblattes hat er zum Beispiel genau beschrieben, alles natürlich nur ausgedacht, wo diese Flugblätter gemacht worden sind: in einem Haus, wo eine Polizei unten drin war. Und dann mussten wir zur Vervielfältigung Wachsblätter haben und ’ne Maschine. Und wieviel wir da gemacht haben, das hat er alles unten reingeschrieben: „Sie brauchen nicht zu suchen“, hat er geschrieben, „es ist alles versenkt in irgendeinem See“ (lacht).
Er ist also das Risiko eingegangen, aber er hat es auch kalkuliert und war vorsichtig auf seine Weise…
Ganz, ganz genau durchdacht.
(Exkurs zur „Mutter“ am BE und zu Peymann – EK findet die neue Inszenierung „verwässert“)
Als Fotografin haben Sie dokumentiert, wie sich Ernst Buschs Aussehen 1945 verändert hatte und weiter veränderte, nachdem er im Zuchthaus durch Bombeneinschlag eine Gesichtsverletzung erlitten hatte. Das sind medizinisch genaue Aufnahmen. Haben Sie ihn dazu überreden müssen oder wie war das?
Er hat immer dazu gesagt: „Aber du darfst darüber nicht öffentlich sprechen!“.
War das Eitelkeit?
Ja, er wollte das nicht. Überhaupt hat er über diese ganzen schlimmen Jahre nie gesprochen. Wir waren befreundet mit ihm. Was glauben sie, was das hier für Diskussionen waren zum Beispiel auch über seine Rolle, über den Galilei. Erst wollte er die Rolle überhaupt nicht spielen. Er hat immer gesagt: „Ich kann das nicht! Ich will das nicht!“ Das wurde in Amerika ja schon gespielt. Von einem sehr bekannten, berühmten Schauspieler…
…Charles Laughton…
…ja, und er hat immer gesagt: „Ich bin das nicht! Ich bin ’n ganz anderer Typ!“ Brecht wollte ihn unbedingt für die Rolle haben. Und da hat mein Stein immer zu ihm gesagt: „Das ist die Rolle deines Lebens. Wenn Du das spielst, wird das die Rolle deines Lebens!“ Und letzten Endes hat er es ja auch gespielt. Wunderbar, wunderbar!
Das war, nachdem Busch schon wieder Erfolg hatte am Theater. Wenn wir jetzt mal zurückgehen in die Zeit, als sie in die Laubenheimer Straße gezogen sind. Im Mai 1945 ist eines ihrer berühmtesten Fotos entstanden, es zeigt Ernst und Eva Busch vor ihrer alten Wohnung in der Bonner Straße 11. Wie kam es zu dieser Aufnahme?
Naja, er war aus’m Zuchthaus Brandenburg bis hierher gelaufen. Es gab ja gar keine Möglichkeit, anders hierher zu kommen. Und er kam hierher in die Bonner Straße, von wo aus er geflüchtet war, ging rauf in die dritte Etage, wo er gewohnt hatte mit der Eva Busch. Und da war die Wohnungstür offen; das war keinem von uns klar, warum diese Wohnungstür offen war. Da ist er reingegangen, und da stand alles genau so, wie er es verlassen hatte – also es war eine ganz, ganz wahnsinnige Zeit. Und dann hat er hier ja eine Frau gehabt: die Eva Busch. Die beiden hatten ja vorher schon nicht mehr zusammengelebt. Er hat dann hier am Laubenheimer Platz eine andere Frau, eine Partnerin gefunden…
…Margarete Körting.
Genau. Und der Mann von dieser Körting, der war irgendwo – ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo der war. Er lebte in einer anderen Stadt, war auch Schauspieler. Sie lebte also hier am Platz.
Und war getrennt von ihrem Mann, räumlich getrennt jedenfalls…
Räumlich. Und mit der hat er eine Freundschaft gehabt.
Die beiden haben bis zu Margarete Körtings Tod im Jahr 1963 zusammen gelebt.
Ja, das war ’ne Strindberg-Ehe. Sie war ihm nicht gewachsen, wollte ihn immer halten. Aber das ging bei so einem Menschen, wie es Busch war, überhaupt nicht.
Kam sie auch vom Theater?
Ja, sie war auch am Deutschen Theater als Schauspielerin. Aber sie hat dann gar keine Rollen mehr gespielt.
Hat sie sich ganz um Busch gekümmert?
Ja, auch. Eben in einer Form… Sie wollte ihn immer halten, und das kann man nicht. Tete hat drei kleine Hunde gehabt, die hab ich auch fotografiert.
Sie haben auch Busch mit einem Hund fotografiert. War das wohl einer dieser Hunde von Margarete Körting?
Ja.
Busch selber hatte wahrscheinlich keine Hunde, oder?
Er war sehr, sehr tierlieb. Ich hatte ja immer Cocker. Wenn ich mit denen da hinkam zu ihnen… Ich war oft in Niederschönhausen, wo sein Haus dann war, das wissen sie ja…
Ja, in der Heinrich-Mann-Straße. Aber auf ihrem Foto vom Mai 45 ist ja nun die Eva Busch zu sehen…
Das war alles ein Zufall. Sie hat ja nicht hier gelebt. Sie lebte ja damals schon in Paris mit einer Freundin zusammen.
Deswegen ist sie auch so gut angezogen, oder? Man glaubt kaum, wenn man das Foto sieht, dass es im Jahr 45 inmitten der Trümmerstadt Berlin aufgenommen ist. Sie hat einen Pelz an, schicke Schuhe, eine Zigarettenspitze in der Hand…
Das kann schon sein. Apropos, ich würde auch gerne eine… (zeigt auf die Zigarettenschachtel auf dem Tisch, ich gebe ihr Feuer, wir rauchen). (…) Busch war einer, der den Menschen unheimlich treu geblieben ist, denen er mal nahe stand. Er war ja ein sehr spröder Mensch. Er war ja Norddeutscher… (…)
Das Zusammenleben mit ihm scheint nicht ganz einfach gewesen zu sein…
Nein, das war es nicht. Er kam öfter rüber zu uns, manchmal mehrmals am Tag, war ja kein weiter Weg. Er ging einmal durch die Wohnung, hat kein Wort dabei gesprochen, und verschwand wieder (lacht). Dann wussten wir, mein Lebensgefährte Werner Stein und ich: Aha, Busch hat wieder irgendwie Stress.
Stress? Mit wem denn?
Ach, mit Gott und der Welt. Wissen Sie, er war schwierig, sehr schwierig. Weil er zunächst mal alles ablehnte, was man ihm vorschlug.
War so ein Besuch bei Ihnen für ihn eine Art Erholung?
Ja (lacht), also irgendwie brauchte er das. Zum Beispiel wie er nachher rübergezogen ist, er blieb ja hier nur bis ’55 oder so (= ’51, JV), dann ist er nach Treptow gezogen und von da aus nach Niederschönhausen, weil er sagte, in Treptow sei die Luft schlecht. Weil da dieses Elektrizitätswerk war…
Er fand, dass dadurch die Luft verpestet wird?
Ja, er fand es. Da wo er gewohnt hat, war die Luft bestimmt nicht verpestet, aber er fand es eben. Da konnte er ja auch schon alles bekommen, was er wollte.
Warum?
Weil er schon wieder ganz bekannt war durch Rollen, die er dann schon gespielt hat.
Wie sehen Sie seinen Schritt von Westen nach Osten? Hat sich das abgezeichnet?
Naja, es war dem Intendanten und dem ganzen Ensemble wichtig, dass die Schauspieler, die bei ihm auf der Bühne waren, auch drüben lebten, weil man nie wusste, wann die Grenze kommen würde. Man sah, dass die Entwicklung ganz unterschiedlich war. Der Westen wurde unterstützt von den Amerikanern mit Geld usw., mit Anschauung – also da passte eigentlich keiner hin, der links orientiert war.
Aber Ihr Lebensgefährte Werner Stein war ja auch links…
Ja, absolut. Aber die Partei, in der er war, in der wir waren, die wollte den Westen nicht entblößen und wollte nicht, dass alle rüberziehen, weil das eine Entblößung der ganzen Anschauung gewesen wäre.
War das die KPD?
Die KPD. Er war sonst überhaupt nicht irgendwie Funktionär. Aber in dem Punkt, hat er immer gesagt, hat die Partei Recht, und ich bleibe hier.
Das war so eine Art taktische Vorgabe der Partei?
Ja, ganz genau.
Und Busch ist sozusagen wegen des Jobs rübergegangen?
Weil er mit Brecht und Weigel auch sehr eng verbunden war. Er hat die großen Rollen, wirklich die ganz großen Rollen gespielt. Das fiel bei uns ja weg. Und er musste da sein, wo seine Bühne war. Eben aus der Perspektive, die man voraussehen konnte, dass eben diese Teilung da war: amerikanisch orientiert, das ging einfach nicht.
Sie sagen: „Er musste da sein, wo seine Bühne war“. Heißt das auch, dass er die Bühne brauchte, um sich darzustellen?
Ja, natürlich. Aber Brecht und Weigel brauchten ihn vor allen Dingen.
Hat ihm das viel bedeutet?
Er hat’s jedenfalls nie geäußert. Aber es war klar, es war ganz klar. Eben weil man voraussehen konnte, wie die Entwicklung, die Entfremdung der beiden Teile sich weiter fortsetzen würde.
Busch hat ja im Exil durchaus versucht, in die USA zu kommen. Sie glauben nicht, dass er vielleicht damit geliebäugelt hat, im Westen zu bleiben?
Nein, das hat er nicht. Auch dass er nach Amerika wollte, das glaube ich nicht. Wir alle… in unserem Kreis ist das nie eine Idee gewesen. Zum Beispiel meine Familie (die Geschwister in Südamerika, JV) konnte nicht verstehen, dass wir hier bleiben. Weil sie überhaupt nicht wussten, oder man kann fast sagen: bis heute vielleicht sogar nicht sehen, warum man in einem Land bleiben kann, in dem eine solche Politik gewesen ist…
…wo solche Verbrechen möglich waren.
Ja. Deshalb glaube ich auch nicht, dass Busch je so gedacht hat.
Ich würde gerne nochmal auf das berühmte Foto von Ernst & Eva zurückkommen. Ich habe hier eine Reproduktion von dem Bild und würde gerne nochmal wissen, wie sich das zugetragen hat. Haben Sie die beiden einfach auf der Straße getroffen?
Das war ein ganz großer Zufall: Ich hab die beiden gesehen, wie sie vor ihrer Haustür standen, da hab ich gesagt: „Kinder, ihr müsst ’n Moment warten!“ Dann bin ich, ich war nicht immer so schlecht zu Fuß, ganz schnell rauf, damals wohnten wir noch in der Laubenheimer, also es war noch näher. „Ich hol nur rasch die Kamera, das muss ich festhalten!“ Und so ist das Bild entstanden.
Die beiden hatten also noch ein bisschen Zeit, sich zurechtzumachen. Auf dem Bild sehen sie fast aus wie Filmstars …
Also, er kam hier zurück, wie gesagt, von seinem Fußmarsch mit einem braunen abgetragenen Jackett, und ich hab das ganz schnell fotografiert. (…) Die haben ihn dann eingekleidet und von Kopf bis Fuß versorgt mit allem, was er nicht hatte. Er kam hierher, wie gesagt, ganz armselig. Aber er hat dann auch sehr schnell wieder eine Rolle gespielt in einem englischen Stück (= „Leuchtfeuer“). (…) Naja, er kam hierher ganz abgerissen und wurde – wie gesagt – dann sehr schnell versorgt mit allem, was er brauchte. Denn sein Name war damals noch bekannt, noch bekannt. Ich freue mich deshalb, dass Sie heute die Arbeit über ihn schreiben, weil ich es so wichtig finde, so einen Menschen noch ins Gedächtnis zu holen. Und ich glaube, dass… Wie es immer so schön heißt: „Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze“. Er war ein wunderbarer Schauspieler und als Mensch sehr schwierig.
Was hat Sie persönlich fasziniert an Busch? In den 20er und 30er Jahren haben Sie ihn ja noch nicht gekannt. Kann man sagen, dass Sie ihn für sich erst ab 1945 entdeckten?
(…) Ja, das kann man sagen. (…) Ich bin dann eben in andere Kreise gekommen (durch Werner Stein). Mein Elternhaus war ja sehr harmonisch und sehr liberal und links eingestellt durch die Schulzeit.
Durch die Schulzeit?
Ja, wir hatten damals einen Direktor, der schon ganz linksliberal war.
Ungewöhnlich.
Nein, in den 20er Jahren ging ja die Entwicklung in diese Richtung: nicht ausgesprochen links, aber linksliberal kann man sagen. Meine Haltung dazu war ganz positiv und eben durch das Elternhaus auch überhaupt nicht eingeschränkt. (…) Mich hat einfach diese ganze politische Richtung sehr interessiert in den 20er Jahren, die ja eben doch sehr aufgeschlossen dafür waren: die ganze russische Kunst, die Malerei, Tolstoi… das alles fand ich ganz hochinteressant
Waren die linken Männer auch die interessanteren Männer?
Ja, auf jeden Fall.
Hatten die irgendwas Abenteuerliches, oder was war das Interessante?
Ja, erstens abenteuerlich, haben Sie ganz richtig gesagt, das war’s. Und die ganze Kunst: Theater und Malerei, es kam ja unheimlich viel Interessantes aus Russland – damals Sowjetunion – auf mich und auf uns zu. Und da mein Elternhaus wie gesagt sehr liberal war, wurde ich da überhaupt nicht eingeschränkt. Ich meine, mein Vater war kein Linker, aber er war ganz liberal und ein wunderbarer Vater, der – denke ich heute – sehr interessiert war, was bei mir los war, bei uns in der ganzen Zeit. (…) Ich bin ja dann mit dem Kemlein zusammen gewesen, von dem ich dann ja sehr bald geschieden wurde. Da hat er immer gesagt: „Wenn du denkst, dass du mit ihm glücklich wirst – ich leg dir keinen Stein in den Weg.“ Das hat er genau so gesagt. (…)
(Ende der ersten 45 min.)
Wie würden Sie Busch als Schauspieler beschreiben?
Er hatte eine ganz klare Form in seinen Rollen. Er hat überhaupt nichts gemacht. Er war als Schauspieler eben auch ein kluger Mann, was bei wenigen Schauspielern der Fall ist: dass sie selber die Rolle so denken, ich sage immer: wie ein Bildhauer ein Stück Lehm formt, ganz neu durchdacht. Die meisten – das wird vielleicht verletzen, wenn ich das so sage – lernen nur auswendig und sprechen nach, was ein Autor geschrieben hat. Er war ein denkender Schauspieler, er hat darüber nachgedacht. Und er kam hierher und hat mit meinem Stein über irgendwelche Rollen so lange diskutiert …
Und der Stein, wie Sie ihn nennen, hat ihm Mut gemacht?
Ja, der hat gesagt: „Wenn Du die Rolle spielst, dann ist das die Rolle deines Lebens!“ Das ging hier fast bis zum Hauen gegenseitig. Wenn sie diskutiert haben, hat der Busch gesagt: „Siehst du, das sagt mir doch kein Mensch!“ Dann hat der Stein ihm geantwortet: „Naja, Kunststück, du schreist gleich und verängstigst diejenigen, die versuchen, dir was zu sagen.“ Busch wurde immer gleich ganz laut, darum hat der Stein ihm das gesagt. Da hat er gelacht und gesagt: „Naja, was soll ich machen?“
Trotzdem war er Ihnen sympathisch.
Ja, weil wir gesehen haben, was er wirklich war. Das Schreien und das so schnell Ungeduldig-Werden, seine ganze Existenz war einfach so dramatisch. Er hat ja diese Verletzung im Zuchthaus bekommen …
… die Sie sehr genau im Bild festgehalten haben, auch den Prozess der Besserung.
Er wollte das selber sehen. Er hat ja ständig daran gearbeitet durch Reiben und Kneten der Backe. Er hat immer gesagt: „Aber wehe, du veröffentlichst das! Ich will nicht, dass du das jemandem zeigst.“
Also waren die Fotos nur für private Zwecke gedacht?
Ja, weil er selber sehen wollte, wie das aussieht. Für ihn waren die Bilder wichtig.
Er hat die Bilder sozusagen bei Ihnen in Auftrag gegeben, um seinen Zustand zu dokumentieren.
Ja.
Wie sehr beeinträchtigte ihn diese Verletzung tatsächlich?
Sie dürfen nicht vergessen: Er kam zurück, nachdem er schreckliche Jahre erlebt hatte. Das hat ihn natürlich mitgeformt. Denn sein ganzes Denken und Leben war ja ganz anders als bis 33. Er hat viel Geld verdient und viel gespielt damals vor der Hitlerzeit. Dann kam der große Einbruch für uns alle, aber für ihn ganz besonders. Dass er erst in Russland war, von da aus weitergegangen ist …
Wissen Sie, warum er damals von Moskau nach Spanien gegangen ist?
Er sagte mal, der Boden sei ihm dort zu heiß geworden. Dann begegnete ich mal irgendjemandem, mit dem ich ins Gespräch kam und dem ich von Busch erzählte – das ist lange her, sodass ich das nicht mehr so ganz genau weiß – aber der dann zu mir sagte, als er meine Haltung zu Busch bemerkte, dass man vorsichtig sein müsse mit Busch. Der kam aus Russland, der, mit dem ich das Gespräch damals hatte.
Was meinte der mit „vorsichtig“?
Antikommunistisch. Das ist natürlich Quatsch. Er war von seiner ganzen Biografie her, der Busch, einfach links.
Vielleicht war er nicht mit allem einverstanden, was die Partei in Moskau tat.
Das ist der Unterschied zwischen Links-Sein und Funktionär-Sein wie bei Honecker. Ich denke – obs stimmt, weiß ich nicht -, dass dieses Funktionär-Dasein und als Funktionär so eine große Rolle gespielt zu haben, die DDR vernichtet hat. (…)
Wie kam Busch mit den Funktionären in der DDR zurecht? Sie haben ja auch nach seinem Umzug in den Osten mit Busch Kontakt gehalten.
Er war frustriert von diesen Menschen, die die DDR kaputt gemacht haben. Er konnte ja ganz anders denken als Honecker. Pieck war noch ein ganz warmherziger Mensch. Aber Honecker und Ulbricht haben enormen Schaden angerichtet.
In einem Interview mit Jutta Arnold (Berliner Gespräche) haben Sie erzählt, dass Ulbricht Ihren Mann gedemütigt hat …
… vernichtet, kann man sagen.
Wie ist das abgelaufen?
Kann ich Ihnen erklären: Er war ein ganz temperamentvoller Mann, der auch ganz aktiv war für die Partei, ohne drin zu sein. Wir waren beide nicht drin. Aber sein ganzes Denken und Arbeiten war im Sinne der Partei. Und das war für die Funktionäre schon ein Gegensatz. (…) Das Denken dieser Funktionäre war sehr eng, sehr beschränkt. Sie waren wunderbare Parteianhänger, aber sie waren in allem nur für die Partei.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs versuchte die Partei dann möglichst schnell Einfluss zu gewinnen auf die beginnende kulturelle Arbeit in Berlin, an der sich ja ganz verschiedene Menschen beteiligten …
Ja, und dazu gehörten er und natürlich auch Busch. Den Stein entfernte man dann von seiner Position, weil Ulbricht nicht wollte, dass ein jüdischer Intellektueller in eine wichtige Position kam. Der Stein hat immer zu mir gesagt: „Eine Partei braucht Mitglieder für die Arbeit, die nötig ist: um die Menschen zu unterrichten und zu fördern. Aber sie ist sehr begrenzt im Denken.“ Es gibt eben diesen Gegensatz zu den Menschen, die nur innerhalb der Partei leben.
Aus heutiger Sicht ist eine derartige Loyalität gegenüber einer Partei schwer zu verstehen. Busch hat ja auch das Loblied „Die Partei hat immer Recht“ gesungen.
Das war damals eine Konzession, die man gemacht hat. (…)
Lassen Sie uns über Buschs private Seite sprechen. Sie haben vorhin schon angedeutet, wie schwierig seine Beziehung mit Margarete Körting war …
Nachdem Tete, so wurde sie genannt, gestorben war … das war ein ganz schneller Tod … Also, ich hab ihn (Werner Stein) verloren 63. Und ein paar Wochen später, das war im Mai, bekam ich ein Telegramm, es gab ja – nebenbei bemerkt – keine Telefonverbindung. Da stand drin: „Tete tot“. Ich hab mich sofort ins Auto gesetzt, ich konnte damals natürlich fahren, und bin rübergefahren zu ihm.
Das ging so einfach?
Ja, und später hatte ich immer ’n Visum, immer. Weil ich eben vom ersten Erscheinen der Berliner Zeitung an dabei war. Also, ich bin dahin gefahren, und ich wusste, dass das ’ne Strindberg-Ehe war, ganz furchtbar. Tete wollte ihn wie gesagt immer festhalten, und das ging nicht.
Hatten Sie sich mit Tete gut verstanden?
Ich?
Ja.
Na, man musste sie tolerieren. Das war sehr schwierig.
Inwiefern?
Naja, wir haben gesehen, wie die beiden gar nicht miteinander auskommen konnten. Das war ganz klar, für jeden sichtbar.
Haben sich die beiden eigentlich unmittelbar nach Buschs Befreiung aus dem Zuchthaus kennengelernt?
Ja, die war alleine. Und sie hat ihn wunderbar versorgt. Aber sie war keine Frau, die ihn fesseln konnte. Er wurde von ihr sehr gut versorgt, aber es war ihm unheimlich lästig.
Die beiden haben ja auch nie geheiratet …
… ich auch nicht übrigens (lacht). Es war ihm wirklich lästig. Da gab es eine ulkige Geschichte: Sie hat immer so getan, als ob sie ’n Kind von ihm bekäme. Wir haben nie darüber gesprochen. Aber eines Tages sagt er: „Also, ’n Kind kriegt die von mir nicht!“ (…)
(zwischendurch wird Ouzo mit Bananenstücken gefüttert)
Wurde es schwierig, als auf einmal seine erste Frau Eva wieder auftauchte?
Das war typisch für Busch. Wenn er einmal Vertrauen zu einem Menschen hatte, war er ihm unheimlich treu. Das ist ein ganz wesentlicher Zug von ihm. (…) Die beiden haben aber nicht mehr irgendwelche Beziehungen zueinander gehabt. Tete war trotzdem auf alle eifersüchtig, die ihn irgendwie fesseln konnten. (…)
Und wie haben Sie Busch erlebt, als Sie 1963 rüberfuhren, um ihn nach Tetes Tod zu besuchen?
Das war komisch! Da standen plötzlich in dem ganzen Haus, in dem er ja dann gelebt hat, das war voll von ihren Fotos, von ihren Bildern. Überall sah man sie. Wobei man wusste, wie schlecht sie zusammen gelebt hatten.
Er hatte all diese Fotos aufgestellt?
Ja, überall standen Fotos von ihr.
Also hat er sie doch sehr geliebt auf eine gewisse Art?
Er war treu. Er war ein treuer Mensch. (…) Zum Beispiel gab es eine junge Frau, die wir auch sehr gut kannten, zu der wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis hatten, die war die persönliche Referentin von der Weigel. Auf die war sie eifersüchtig und hat von ihr immer erzählt: „Naja, das Zopfmädchen …“ oder so. Also, sie war wahnsinnig eifersüchtig, und das konnte er natürlich überhaupt nicht vertragen. (…)
Hatten Sie später, als er mit Irene verheiratet war, auch noch Kontakt zu Busch?
Ja, es war ein sehr guter Kontakt. Einmal beispielsweise war Irene in Kiel, da wurde eine Ausstellung eröffnet über ihn. Da ist sie hingefahren, er ist schon nicht mehr hingefahren. Und in der Zeit, als sie in Kiel war, bin ich ein paar Mal zu ihm gefahren. Und da ist er einmal mit mir in seinem Garten gewesen, der direkt an den Friedhof grenzt. Und da hat er so ein Leiterchen gehabt, da ist er raufgeklettert und hat gesagt: „Guck mal, da werd ich bald liegen“. Da muss er schon fast 80 gewesen sein. (…) Er war ja dann in einem Heim in Bernburg, Irene hat ihn dort besucht. Ich konnte ihn da nicht mehr besuchen.
Wie würden Sie Buschs Beziehung zu Irene charakterisieren?
Die Irene war eine sehr kluge Frau. Und die hat alle Feindschaften, die man ihm dann entgegenbrachte, weil man sein ganzes Leben nicht verstand und gar keine Geduld mehr für ihn hatte, die hat ihn aus allem zurückgeholt. Und er hat dann im Zusammenleben mit ihr die größte Auszeichnung von der Regierung bekommen, die es damals gab. (…) Sie hat ihn wunderbar verstanden. Diese Frau war für ihn ein Glück, das muss man sagen. (…) Kennengelernt hatten sie sich am Theater durch die Weigel. Sie war ja die Referentin.
Ganz grundlos war Tetes Eifersucht also nicht gewesen.
Sie war auf jeden eifersüchtig, auf jeden. Sie war ihm einfach nicht gewachsen, und darunter hat sie selber schwer gelitten. (…)
Buschs erste Ehe mit Eva hat gerade mal zwei Jahre gehalten. Haben die beiden eigentlich zusammengepasst?
Nein, sie passten sicher nicht zueinander. Aber zu wem passte er? Er passte eigentlich zu keinem. Aber trotz alledem war er ein ganz treuer Mensch. Wie soll ich Ihnen das beschreiben? Wo er von den Menschen nicht enttäuscht wurde …, oder wo man seine Meinung teilte oder wo man über die ganze Situation in der Welt einer Meinung war … Also, mit Kapitalisten hat er es auf gar keinen Fall verstanden. (…) Eines muss ich noch erzählen: Als ich draußen bei ihm war, während Irene in Kiel war, und ich mich von ihm verabschieden musste, um hier wieder herzukommen, hat er seinen Arm um meine Schulter gelegt – werd ich nie vergessen, weil es so selten bei ihm war, dass er so was machte – und hat zu mir gesagt: „Komm bald wieder“. Das werd ich nie vergessen.
War er sonst nicht so körperlich, nahm er einen nicht in den Arm?
Nein! Er hat nie gezeigt, dass er irgendwo jemanden mochte, hat er nie gezeigt. Aber man hat’s gefühlt.
War er äußerlich ein sehr harter Mensch?
Ja, kann man sagen. Er hat kein Gefühl gezeigt. Ein typischer Norddeutscher.
War er ein Frauentyp?
(überlegt lange) Ich glaube schon. Weiß es nicht so genau, aber ich glaube schon. Erst mal hat es eine Frau gereizt, dass er diese Rollen spielte und dass er viel Geld verdient hat. Und er war ganz großzügig. Geld spielte bei ihm eine ganz große Nebenrolle. Das war ihm wurscht. (…)
Bei seiner Firma Lied der Zeit hat er sich wohl auch weniger um das Finanzielle gekümmert als um das Künstlerische …
Ja, da hat übrigens mein Stein ganz intensiv mit ihm gearbeitet und diskutiert in dieser Zeit: was er machen soll, wie er’s machen soll vor allen Dingen.
Kannten sich die beiden schon von vor dem Krieg, der Stein und der Busch?
Ich glaube nicht.
Das heißt, sie haben sich durch die Nachbarschaft kennengelernt.
Ja. Wie gesagt: Sechs-, siebenmal am Tag kam er her, ging durch die Wohnung, guckte böse, ganz böse, wenn jemand da war, das fand er schlecht, und verschwand wieder, ohne ein Wort geredet zu haben. Das war auch ’ne ganz typische Sache für ihn: Er kam dann, wie er in Niederschönhausen lebte, da kam er auch ganz oft. Dann kam er hier rein. „Ach“, sagt er, „hier ist doch ’ne ganz andere Luft“, legte sich hier auf die Couch und machte es sich gemütlich (lacht).
Hat er Ihnen auch seine Musik vorgespielt?
Hier nicht. Bei ihm zuhause hat er das getan, ganz laut. Er nahm gar keine Notiz davon, ob einer das wollte oder nicht. Das war auch ganz typisch für ihn: Ich hörte das ja gerne, seine ganzen Sachen. Und ich war ja schon alleine und kam sehr oft dahin. Und da hab ich zu ihm gesagt: „Das finde ich toll!“ – „Das findest du toll?“, hat er zu mir gesagt. „Ja“, sag ich, „das ist wunderbar!“. Da hat er gesagt: „Naja, du verstehst ja auch nichts davon.“ (lacht) Genauso hat er’s gesagt. (…) Na, er hat das gesagt, was er dachte. Ich fand das sehr gut, auch wenn das nicht alle hören wollten. (…) Busch war ein spröder, oft verletzender Mensch. Und es wäre ihm auch wurscht gewesen, wenn er gemerkt hätte, dass er jemanden mit seiner Art verletzte. Und er war kurz in seinen Äußerungen, wenn es nicht gerade ums Theater ging. Einmal kam er hier vorbei, weil er zu Piscator ging, der 70. Geburtstag feierte. Erwin Piscator wohnte hier in der Nähe. Alles, was er zu mir sagte, war: „Komm mal mit!“ Das war seine Art, jemanden einzuladen. (…) Der Sänger Paul Robeson zum Beispiel war ein ganz anderer Typ, sehr verbindlich. Einmal wollte ich die beiden zusammen fotografieren, aber Busch hat sich aus irgendwelchen Gründen geweigert. Leicht hat er es einem nicht gemacht, der Busch. (…)
Foto: Katja Worch
Interview: Jochen Voit
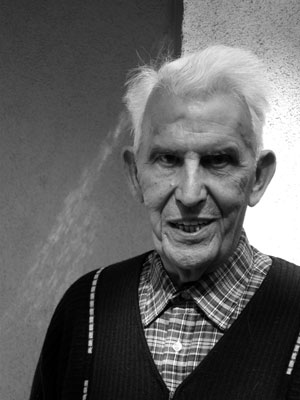
Rolf Lukowsky
über seine Arbeit als Komponist und Chorleiter in der DDR und seine langjährige Zusammenarbeit mit Ernst Busch
„Für Busch war immer der Text das Wichtigste, die Musik war Nebensache!“
(Gespräch am 8. September 2006 in Bernau)
Rolf Lukowsky ist Jahrgang 1926. Er stammt aus Berlin und wächst in einem katholischen Elternhaus auf. Der Vater ist Organist in der Kirche und komponiert Instrumental- und Chorwerke, die Mutter ist von Beruf Schneiderin. Rolf Lukowskys Interesse für Musik wird frühzeitig geweckt: Schon als Schüler singt er im Domchor St. Hedwig unter der Leitung von Domkapellmeister Dr. Karl Forster und tritt als Chorsänger in der Staatsoper in Berlin auf. Eine konkrete politische Prägung erfährt er nach eigener Aussage zu Hause nicht: „Mein Vater und meine Mutter lebten nur in der Kirche und für die Kirche, um Politik haben sie sich nicht gekümmert.“ Allerdings sorgt der Vater dafür, dass Rolf Lukowsky nicht zum Jungvolk oder zur Hitlerjugend kommt. „Stattdessen habe ich die katholischen Jugendorganisationen Quickborn und Neudeutschland, ND hieß das damals, durchlaufen,“ erklärt Lukowsky. Nach der Grundschule besucht er das von Jesuiten geleitete Canisius-Kolleg bis zur Schließung durch die Nationalsozialisten im Jahr 1940. Er wechselt auf ein anderes Gymnasium, absolviert 1943 den Reichsarbeitsdienst in Ostpreußen, meldet sich freiwillig als Reserveoffizier und wird als Luftwaffenhelfer eingezogen. Lukowsky: „Mein Jahrgang gehörte zu denen mit den meisten Verlusten. Aus meiner Klasse, der damaligen letzten, überlebten nur vier oder fünf, alle anderen sind gefallen.“ Als Soldat wird er an der Westfront eingesetzt und verwundet. „Um Russland bin ich drum rumgekommen,“ erzählt er, „obwohl die Bewerber zum Reserveoffizier fast alle dorthin geschickt wurden. Aber wir waren irgendwo mal abgehauen, und deswegen hat man mich nicht zum Unteroffizier befördert, und dadurch brauchte ich nicht nach Russland – das hat mir vielleicht das Leben gerettet.“
Das Ende des Zweiten Weltkriegs, den 8. Mai 1945, erlebt Lukowsky an der Elbe. Von dort aus macht er sich mit einem defekten Fahrrad auf zu seinen Eltern, die er in Herzberg (Elster) südlich von Berlin trifft. In der SBZ arbeitet er zunächst in der Landwirtschaft („Man musste ja was tun!“), bevor er einen Neulehrerkurs belegt, um Musik- und Deutschlehrer zu werden. Kurzzeitig überlegt er, nach Bonn zu gehen, um dort Medizin zu studieren, verwirft die Idee aber wieder, als er über seine Tante, die dort studiert, von der schlechten Versorgungslage im Rheinland erfährt. Lukowsky entscheidet sich schließlich für die Musik und den sozialistischen Teil Deutschlands; er wird Mitglied der FDJ und gründet 1948 seinen ersten Chor. Ab 1954 absolviert er ein zweijähriges Studium in Musikerziehung für die Oberstufe an der Martin-Luther-Universität Halle. Anschließend folgt er seinem Professor an die Humboldt-Universität nach Berlin, wo er 1959 in Musikpädagogik promoviert. Parallel leitet er große Chöre wie den Buna-Chor in Halle (1950-1956), mit dem er auch in der Bundesrepublik auftritt, was nicht immer ganz reibungslos funktioniert: „1953 sind wir von westdeutschen Grenzern aus dem Zug rausgeholt worden – warum, weiß ich auch nicht, vielleicht hatte der Verfassungsschutz was gegen unser Programm“, erzählt Lukowsky lächelnd. Neben explizit politischen Gesängen (in der jungen DDR meist „fortschrittliches Liedgut“ genannt, was „Zeit“- und „Arbeiterlieder“ einschließt) umfassen die Programme seiner Chöre, für die er Bearbeitungen und Kompositionen schreibt, klassische Werke und Folklore („Aber wir haben nie ‚Holla-di-ho’ gesungen!“). Lukowsky, der 1956 Mitglied der SED geworden ist, arbeitet nach seiner Habilitation 1961 als Dozent für Musiktheorie und Chorleitung an der Humboldt-Universität. Darüber hinaus arbeitet er mit mehreren Chören und spielt insgesamt über 1000 Musikwerke für Radio, Fernsehen und Schallplatte ein. Seit Ende der 50er Jahre ist er außerdem beim FDGB fürs Musikalische zuständig. Lukowsky: „Zusammen mit zwei Kollegen war ich verantwortlich für alles, was musikalisch vom Bundesvorstand aus initiiert wurde.“ Als späterer Leiter des Redaktionskollegiums der FDGB-Liedblätter wählt er mit drei weiteren Chorfachleuten die Stücke aus, die dann den Weg in Betriebe und Kulturveranstaltungen der Gewerkschaft finden. Zu seinen Aufgaben gehört insbesondere die musikalische Seite der seit 1959 veranstalteten Arbeiterfestspiele. Bei der Vorbereitung der 7. Arbeiterfestspiele, die 1965 in Frankfurt/Oder stattfinden, lernt er Ernst Busch kennen, woraufhin sich eine mehr als zehnjährige Zusammenarbeit mit dem Sänger entwickelt. Lukowsky arrangiert und komponiert Lieder für Busch, probt ausführlich mit ihm und begleitet ihn im Studio und bei Auftritten auf dem Klavier oder der Orgel. Bis 1978 entstehen zahlreiche Aufnahmen und mehr als ein Dutzend Aurora-Schallplattenhefte, an denen der Komponist, Arrangeur und Pianist maßgeblich beteiligt ist. Abgesehen von Busch arbeitet Rolf Lukowsky noch mit vielen anderen Sängern zusammen, im Bereich des Arbeiterliedes mit Hermann Hähnel. Als Vorsitzender des Berliner Komponistenverbandes der DDR übernimmt er auch administrative Aufgaben.
Rolf Lukowskys mit Preisen ausgezeichnetes kompositorisches Werk ist äußerst umfangreich und besteht aus geistlichen und weltlichen Liedern, Kantaten, Oratorien und Kammermusiken. Insbesondere seine Volksliedsätze gehören bis heute zum Standardrepertoire zahlreicher Chöre. Rolf Lukowsky ist verheiratet und lebt mit seiner Frau Marion in Bernau bei Berlin.
___________________________________________________________________________
Jochen Voit: Als Chorleiter, Arrangeur und Komponist haben Sie bereits in den 50er Jahren viel Erfahrung mit Arbeiterchören in der DDR gesammelt. Wie würden Sie das typische Lied-Repertoire dieser Chöre beschreiben?
Dr. Rolf Lukowsky: Das ist eine gute Frage, denn das wird oft falsch oder einseitig dargestellt. Jedes Programm, übrigens auch bei den Arbeiterfestspielen, hatte einen Anteil an Zeit- und Arbeiterliedern, der vielleicht 10 bis maximal 30 Prozent betrug. Das variierte je nachdem, welchen Sinn dieses Programm hatte. War es zum Beispiel ein Eröffnungsprogramm bei den Arbeiterfestspielen, dann wurde auf diese Lieder natürlich mehr Wert gelegt. War es aber ein Konzertprogramm im Sinne der Arbeiterfestspiele, dann wurde zu Beginn ein Arbeiterlied gesungen und dann vielleicht ein Friedenslied zum Abschluss. Ansonsten ging es die ganze Palette durch: vom Volkslied bis hin zum romantischen Chorlied.
Sie haben mit Ihren Chören in den 50er Jahren auch Auftritte im Westen gehabt. Haben Sie bei solchen Gelegenheiten eher mehr oder eher weniger Arbeiterlieder gesungen?
Mehr, denn diese Festivals waren ja links determiniert. Zum Beispiel waren wir zwei- oder dreimal bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Die holten sich ständig aus den sozialistischen Ländern Gruppen verschiedener Art für ihre Veranstaltungen. Da war immer viel Publikum, Arbeiterpublikum vor allem. Die politische Richtung war nicht immer eindeutig definiert, aber auf jeden Fall ging es gegen den Krieg, gegen die Aufrüstung. Aber auch in diesen Programmen war das deutsche Volkslied sehr gut vertreten, dazu kamen immer wieder Eigenkompositionen. Ich habe damals zum Beispiel nach dem Text eines befreundeten Autors für meinen Chor ein Elbeschiffer-Lied geschrieben. Darin geht es um nichts weiter als um die Schiffe, die von da nach dort fahren und um das Leben der Leute auf diesen Schiffen. Das haben wir richtig schön plastisch auf der Bühne dargestellt, und das kam unheimlich gut an.
Wollten Sie immer auch Lieder schreiben, die populär, also im besten Sinne „volkstümlich“ sind?
Auch, aber – um Gottes Willen – nicht nur! Ich habe immerhin Musikerziehung und Musikwissenschaft studiert, und später war ich Dozent für Musiktheorie, das heißt: man hat von mir ein bestimmtes Können erwartet, das ich ja auch an Studenten weitergeben wollte. Also, es ging da schon um mehr als nur ums Volkstümliche. (…)
(Exkurs zu Rolf Lukowskys Promotionsthema: seinen Untersuchungen der Großterz aufwärts, für die er Messungen von Mönchsgesängen in abgeschiedenen Klöstern durchgeführt hat; Ziel sei es gewesen, zu untersuchen, ob und inwieweit „Menschen in ihrer Singeweise im Lauf der Jahrhunderte durch Hörgewohnheiten und Musikpraxis“ beeinflusst wurden)
„Möglichst viel a cappella“ – Interesse für die menschliche Stimme
Hat Ihre akademische Arbeit die praktische Arbeit mit den Chören beeinflusst?
Ja, sicher. Die Forderung, die sich für mich aus meinen Studien zur menschlichen Stimme ergab, war ganz einfach: Möglichst viel a cappella mit den Chören zu singen, also ohne Begleitung durch Instrumente! Weil sich bei Chören, wenn sie gut geschult sind, intuitiv ein anderes Stimmungsprinzip ergeben kann, als wenn sie von einem Orchester oder Klavier begleitet werden. (…)
Welche Rolle haben die Texte bei Ihren Bearbeitungen und Kompositionen gespielt? Ging es Ihnen eher um zeitlose Aussagen oder um konkret politische Inhalte?
Zunächst einmal möchte ich sagen, dass alle Texte, die ich vertont habe, immer eine politische Aussage hatten. Es musste keine, wie soll ich sagen, keine tagespolitische Aussage, keine vornehmlich aggressive Aussage sein. Es geht in diesen Texten, die ja zum Teil von bedeutenden Dichtern stammen, um das Leben der Menschen, es geht um das Zusammenleben, um das Miteinander, das Untereinander, Füreinander. Das können Sie in jedem meiner Lieder nachlesen.
„Busch war durch und durch Kommunist – deswegen haben sie ihn ja auch aus der Partei rausgeschmissen.“
Würden Sie sagen, dass Sie Sozialist sind von Ihrer politischen Einstellung her?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Natürlich war ich in der Partei wie alle anderen in vergleichbaren Positionen auch. Aber sagen wir mal so: Ich denke sozialistisch. Allerdings wäre ich unter anderen Umständen wahrscheinlich nie Sozialist oder Kommunist geworden – ganz im Gegensatz zu Ernst Busch, der ja wirklich durch und durch Kommunist war. Deswegen haben sie ihn ja auch damals aus der Partei rausgeschmissen. Wäre er kein Kommunist gewesen, hätte er sich gebeugt. So aber hat er Kontra gegeben. Sie kennen ja die Geschichte mit seiner Parteiüberprüfung … Wissen Sie, dass mein Leben so verlaufen ist, hat viel mit meinem musikalischen Elternhaus zu tun. Wenn ich nach dem Krieg zum Medizinstudium nach Bonn gegangen wäre, hätten sich die Dinge völlig anders entwickelt. Aber es hat eben doch die Musik durchgeschlagen, was kein Wunder ist bei dem Vater! Mein Vater ist eigentlich auch ein bekannter Komponist in der DDR gewesen, nur sind von ihm längst nicht so viele Sachen gedruckt worden wie von mir.
Wann sind Ihre ersten Lieder gedruckt worden?
Das erste Lied war „Fleißig, nur fleißig ihr Mädel und Jungen“. Das wurde später sogar als Kennungssignal im Kinderfernsehen verwendet. Der Text von Joachim Würzner war eigentlich auch nicht tagespolitisch, sondern einfach als freundliche Aufforderung gedacht, …
…nicht faul zu sein.
Genau. Das war das erste Lied, das von mir gedruckt wurde. Das muss 1949/50 gewesen sein. Das Lied lief dann auch im Radio und wurde ins Pionier-Liederbuch aufgenommen. Ich bin dadurch nicht reich geworden, aber ich war zu der Zeit schon in der AWA, da gab es immerhin 20 Mark im Jahr, die konnte man auch gebrauchen. (…)
(Exkurs zum Punktesystem der AWA, der „Anstalt zur Wahrung der Aufführungsrechte auf dem Gebiete der Musik“)
Das Besondere an Busch: „Er bringt es so überzeugend, dass man ’s auch glaubt!“
Wann haben Sie zum ersten Mal von Ernst Busch gehört?
Das muss ungefähr 1947 gewesen sein. In der Nazi-Zeit habe ich natürlich nichts von Busch mitgekriegt. Mein Vater hatte auch weder Radio noch Schallplattenspieler. Mein Onkel und meine Tante, die beide Zahnärzte waren, hatten zwar einen Plattenspieler, aber wenn ich dort hinkam, habe ich vielleicht mal die „Dichter und Bauer“-Ouvertüre rausgesucht und abgespielt. Da gab es keine Busch-Platten, das war ein großbürgerlicher Haushalt, abgesehen davon war mein Onkel in der NSDAP. Nach Kriegsende hatte ich dann ein eigenes Radiogerät, aber das lag im Keller unter den Kartoffeln. Es war ja bis 1946 verboten, so einen Apparat zu besitzen. Wahrscheinlich habe ich die ersten Busch-Lieder tatsächlich durch meine Arbeit mit den Chören kennengelernt. Als ich 1948 Lehrer geworden bin, habe ich ja gleich einen Pionier-Chor gegründet, mit dem wir sogar ein Jahr später nach Dresden zu Tonaufnahmen gefahren sind. Jedenfalls kann ich sagen, dass ich etwa ab 1949 alle wesentlichen Lieder von Ernst Busch kannte – aber weniger durch Platten, sondern durch Liedblätter und weitergereichte Transkripte, die man so bekam.
Haben Sie Busch als Person, als Figur in der Öffentlichkeit, in dieser Zeit wahrgenommen?
Natürlich.
Wie geschah das? Durch Theaterbesuche?
Nein, aber man wusste einfach, wer er war. Jeder kannte Ernst Busch, und jeder kannte Hanns Eisler. (…)
Wie fanden Sie Busch denn damals als Interpret?
Einmalig.
Was war so einmalig?
Einmalig ist, dass er das, was er singt, so überzeugend bringt, dass man ’s auch glaubt. Das ist bis zu seinem Tode so gewesen, und deswegen hat er es sich auch so schwer gemacht in manchen Dingen …
Busch-Lieder im Chor: „Black and White“ und „Ami, go home“
Welche seiner Lieder gehörten zum Repertoire Ihrer Chöre, also etwa des Buna-Chores?
Wir haben ja alle gängigen Arbeiterlieder gesungen. „Vorwärts und nicht vergessen“ und viele andere, das war sozusagen Standard. Und auch die neueren Lieder von Busch waren dabei. „Black and White“ zum Beispiel, das war ein großer Renner bei uns: „Gib uns die Hand, mein schwarzer Bruder“. Auch „Ami, go home“ war ein Hit– und zwar meines Wissens sogar noch, bevor es Busch auf Platte aufnahm, denn Text und Melodie gab es auch in gedruckter Form bei Lied der Zeit. Busch gab ja das kleine rote Liederbuch „Internationale Arbeiterlieder“ heraus. Und ich habe mich natürlich bemüht, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich habe mir damals, was ich übrigens heute noch mache, sämtliche Liederbücher, die es gab, gekauft.
Sämtliche?
Sämtliche.
Sie müssen drei Zimmer voller Liederbücher haben …
Hab ich auch. Sofern ich sie kriegen konnte, habe ich mir selbst bei Auslandsreisen alle Liederbücher gekauft. Das war auch professionelles Interesse, denn in den meisten, also in den späteren Liederbüchern, sind ja Sachen von mir drin. Und ich wollte immer alles gedruckt haben, damit ich damit arbeiten konnte. Abgesehen davon: Welcher Komponist will nicht seine Werke zu Hause haben? (…) Manchmal habe ich mir auch Bücher gekauft, in denen nur ein oder zwei Lieder waren, die ich verwenden wollte. Ich habe ja ständig Bearbeitungen für meine Chöre gemacht.
„Er wurde gebeten, mitzumachen“ – Busch und die Arbeiterfestspiele
Wann haben Sie Busch persönlich kennengelernt?
Das war viel später. Da war ich schon Vorsitzender des Komponistenverbandes hier in Berlin. Ich war damals verantwortlich für die musikalische Seite der Arbeiterfestspiele im Bundesvorstand, aber nicht hauptamtlich, sondern nur als Berater. Und da kam es dann dazu, dass zwei führende Vertreter des FDGB Bundesvorstandes zu Ernst Busch gegangen sind und ihn gebeten haben, ob er eventuell bei den Arbeiterfestspielen mitmachen würde. Busch wollte natürlich nicht.
Warum nicht?
Na, er wollte ja gar nicht mehr auftreten. Denken Sie an ’53! Das war zwar nun schon eine Weile her, aber Busch hatte immer noch seine Probleme mit den Funktionären. Und sie mit ihm. Er hat mir erzählt, dass der Holtzhauer (Vorsitzender der Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten 1951-1954; JV) immer auf die andere Straßenseite ging, wenn sie sich begegneten. Das war auch so. Busch nannte ihn immer „Holzhacker“. So richtig versöhnt war er nicht. Und er hatte ja Recht: Busch hatte zum Beispiel verhindert, dass Anfang der 50er Jahre zum Deutschlandtreffen oder zu den Weltfestspielen, ich weiß nicht mehr genau, die alte Hymne des faschistischen Rumänien veröffentlicht wurde. Er hatte sich die Noten angesehen und gemerkt, dass es die falschen waren. Also schickte er sie zurück zum FDJ-Zentralrat. Daraufhin kriegte Busch als Antwort, es habe alles seine Richtigkeit, die Hymne soll aufgenommen werden. Und da hat Busch gesagt: „Wenn das so ist, dann kann mich die FDJ am Arsch lecken, das wird nicht aufgenommen!“ Dann hat sich natürlich die FDJ, das war damals ja wohl Honecker, beim ZK beschwert. So kam Busch bei der Partei in Verruf …
„Er hat Kästner geholt – die hätten ihm die Füße küssen müssen!“
Hat Ihnen Busch das erzählt?
Natürlich. (…) Da hatte sich Honecker einfach als FDJ-Sekretär überschätzt, zumal Busch ja seine Gründe hatte. Busch wäre nun der Letzte gewesen, der eine faschistische Hymne auf Platte aufgenommen hätte. Aber das war mit Sicherheit nicht der einzige Grund dafür, dass sich Busch zurückgezogen hatte. Er hatte ja auch seinen Verlag abgegeben und gesagt: „Macht euren Dreck alleine!“ Ihm war dann später eigentlich nur noch seine Schallplattenreihe wichtig, die auf Aurora erschien. Und da sind ja schöne Sachen entstanden, zum Beispiel die Platte mit Kästner. Dass er Kästner hierher nach Berlin, in die DDR, geholt hat, das war doch eine Großtat. Die hätten ihm die Füße küssen müssen! Ein west-deutscher Autor dieser Größenordnung! Kästner war noch nie in der DDR gewesen und hat hier mit uns im Studio in der Brunnenstraße seine Texte eingesprochen. Gerade an diesem Tag wurde meine jüngste Tochter geboren, und ich war im Studio und musste Klavier spielen. Irgendwann sagte ich dann: „Ich muss jetzt ins Krankenhaus, ich habe gerade eine Tochter bekommen!“ Da hat der Kästner sofort zwei Flaschen Sekt aus der Kantine geholt, und wir haben angestoßen. Also, es gab auch sehr schöne Momente bei dieser Arbeit. Aber zurück zu den Arbeiterfestspielen, …
… bei denen Sie erstmals mit Busch zusammengearbeitet haben …
Ja, wir haben uns kennengelernt bei der Vorbereitung der Festspiele in Frankfurt/Oder, das muss 1965 gewesen sein. Wir haben damals drei Lieder von Busch im Eröffnungsprogramm gebracht, die er natürlich selbst ausgesucht hatte: „Lob des Kommunismus“, „Grabrede über einen Genossen“, „Lerne das Einfachste“. Und nun ging es darum: Playback oder nicht Playback? Denn wir haben ja das ganze Eröffnungsprogramm als Playback gefahren. Er wollte erst nicht, hat sich dann aber überzeugen lassen, dass es mit Playback besser wäre. Das Problem war aber, dass die vorliegenden Aufnahmen von der technischen Seite her nicht gut genug waren. Wir brachten die Aufnahmen ja stereophon, wir brauchten sie modern. Ich bin dann also zu ihm nach Hause und habe gesagt, dass wir die Lieder noch mal nach seinen Vorgaben einspielen würden. (…)
„Lukowsky, wir schmeißen alles weg! Wir fangen noch mal völlig von vorne an!“
Was hat Busch dazu gesagt?
Busch fand das in Ordnung, weil er die Lieder, glaube ich, sowieso noch mal neu aufnehmen wollte. Nun brauchten wir noch einen Chor. Ich hatte ihn, und zwar einen sehr guten. Wir haben also meinen Studiochor genommen, ich habe das Ganze dirigiert, auch das Orchester – und so sind unsere ersten gemeinsamen Aufnahmen in der „Schallplatte“ im Studio Brunnenstraße entstanden. Busch hat das akzeptiert, und von da an hat er keinen anderen mehr genommen.
Waren Sie sich sympathisch?
Sicher. Ich meine, er hätte gut und gerne mein Vater sein können. Ich nenne ihn immer „väterlicher Freund“, obwohl er nie mein Freund im herkömmlichen Sinne war. Wir blieben immer per Sie, und er hat mich manchmal, das muss ich schon sagen, ziemlich komisch behandelt. Aber das fachliche Urteil, das hat er akzeptiert. Wobei die letzte Entscheidung immer bei ihm selbst lag. Wenn er sich ein Stück, das er produziert hatte, sagen wir mal, hundertmal angehört hatte, kam der Anruf: „Lukowsky, haben Sie Zeit?“ Ich wohnte in Prenzlauer Berg, er wohnte in Pankow. Ich fuhr dann mit dem Auto rüber, und er empfing mich: „Lukowsky, wir schmeißen alles weg! Wir fangen noch mal völlig von vorne an!“ (Lachen) Ich habe dann auch sämtliche Bearbeitungen für ihn gemacht, die es ja noch nicht gab. Sehr viel Spaß hat mir zum Beispiel „Kohlen für Mike“ von Boris Blacher gemacht, ein wunderschönes Stück, das ich für zwei Klaviere und Schlagzeug arrangiert habe. Oder der „Haßgesang“ von Weill, für den es auch keine Partitur gab.
Wie haben Sie reagiert, wenn er alles wegschmeißen wollte?
Das war schon in Ordnung, es war ja mein Geld.
Wie sind Sie denn bezahlt worden? Pro Stunde?
Er hat sich darum nicht gekümmert, das hat die Akademie gemacht. Aber die Proben wurden überhaupt nicht bezahlt.
Aber Sie haben doch nicht aus Spaß mit ihm geprobt …
Das gehörte dazu, wenn ich Aufnahmen machte. Die Studioaufnahme wird bezahlt, und die Proben gehören selbstverständlich dazu. Ich meine, heute ist das anders, da würde jeder die Proben stundenweise abrechnen. Einige meiner Kollegen haben das damals übrigens auch gemacht. Aber meine Aufnahmen wurden nach meinem Rundfunktarif bezahlt, das hat Hugo Fetting erledigt, der die Redaktion der Plattenhefte machte. Als der später nicht mehr dabei war, machte das der Rudolf Engel, der Bruder von Erich Engel, und am Schluss dann Hans Bunge. Die Bezahlung wurde ganz normal ausgehandelt, aber was wichtiger war: Ich bekam für meine Bearbeitungen und Kompositionen von der Akademie Geld, und das Produkt ging ja nach der Fertigstellung in den Verkauf und wurde über die Aufführungszahlen in den Medien bei der AWA registriert, sodass die Sachen auch etwas einbrachten. Aber ich habe bei dieser Zusammenarbeit mit Busch nicht auf den Pfennig gesehen, das habe ich sowieso nie gemacht.
Ist das immer so abgelaufen, dass Busch angerufen hat und Ihnen den Auftrag gegeben hat, dieses oder jenes Stück mit ihm zu machen?
Natürlich. Busch hat immer gesagt, wer was zu machen hat. Das galt auch für die Bearbeitungen. Ich habe ihm die Musiker aus dem Funk besorgt – die besten, die es gab. Er hatte auch bestimmte Favoriten, zum Beispiel den Trompeter Franz Witecki, das war der Solotrompeter vom Rundfunk-Symphonieorchester. Und er wollte unbedingt immer den Ernst König, der spielte Banjo und Gitarre … und den Günter Wäsch, der spielte Klarinette. Das waren natürlich hervorragende Musiker, übrigens auch hervorragend bezahlte Musiker. Zum Teil spielten da auch persönliche Dinge eine Rolle, man kannte sich und war miteinander eingespielt.
„Gib mir mal ’n Mikrofon, ich will nämlich den Leuten was sagen!“
Lassen Sie uns noch mal auf die Arbeiterfestspiele zurückkommen …
Wir fingen wie gesagt mit diesen drei Aufnahmen an, und ich muss sagen: Sie sind sehr gut geworden, vor allem die „Grabrede“. Und auch Busch war anscheinend zufrieden. Ihm kam es ja darauf an, dass der Text deutlich zu verstehen war. Deswegen haben wir ihn auch überzeugen können, dass Playback auf diesem großen Platz, auf dem das Konzert stattfinden sollte, notwendig wäre. Wir haben auch gesagt: Was ist, wenn es regnet und das Mikrophon kaputt geht? Also, die Eröffnungsveranstaltung in Frankfurt ging mit Playback über die Bühne. Hat wunderbar geklappt. Und das haben wir dann 1967 wiederholt auf dem riesigen Altmarkt in Dresden. Da waren, ich schätze mal, an die 100.000 Leute da. Dass dann mittendrin welche gingen, na gut, das war nicht zu ändern. Ich wäre auch gegangen, wenn man mir nur einseitig politische Sachen vorgesetzt hätte. Aber nicht bei Busch! Und bei Busch ist auch niemand weggegangen. Der kam sehr gut an …
Hat Busch dann nur die Lippen bewegt beim Auftritt?
Nein, Busch hat voll gesungen. Ich kann mich noch entsinnen, dass er vor seinem Auftritt in Frankfurt zu mir gesagt hat: „Gib mir mal ’n Mikrofon, das auch angestellt ist, ich will nämlich den Leuten was sagen!“ Er hat also zum Publikum gesprochen, danach wurde das Mikrofon abgestellt, das Band wurde abgefahren und er sang weiter in das Mikrofon. Demzufolge war natürlich der Eindruck, er würde das live machen, viel größer. Er konnte wunderbar synchronisieren, das klappte gut. Wir hatten auch dieselben Musiker auf der Bühne, die das im Studio eingespielt hatten. Die konnten natürlich so laut spielen, wie sie wollten, das Band war lauter. Und ich habe das Ganze dirigiert. Diese Eröffnungsveranstaltungen sind übrigens alle auch vom Fernsehen übertragen worden. (…)
Hat der FDGB eigentlich Einfluss genommen auf die Lieder-Auswahl von Busch?
Nein, das hätte Busch auch nicht akzeptiert. Aber insgesamt war dieses Programm ein höchst politisches Programm, würde ich sagen. (…)
Erinnern Sie Sich noch an Einzelheiten des Auftritts 1965 in Frankfurt?
Ja, ich weiß noch, dass ich den großen Chor des Instituts fürMusikerziehung der Humboldt-Universität dabeihatte, das waren 120 Sänger. Die haben die Eröffnung gestaltet, und dann kam „Anmut sparet nicht noch Mühe“ von Fidelio F. Finke, das sang ein Mädchenchor von 50 Studentinnen. Und auf einmal fing es furchtbar an zu regnen. Die standen da in ihren weißen Blusen, und es goss. Danach wollten wir eigentlich aufhören, aber dann kam Busch und sagte durchs Mikrofon: „Wir machen weiter!“ denn jetzt war er dran. Er sang dann mit meinem Kammerchor im Hintergrund „Lerne das Einfachste“. Ich glaube, er hat bei diesem Konzert sogar noch ein Lied mehr als in Dresden gesungen. Das war das legendäre ”Black and white”. Die Organisation dieser Veranstaltungen machte übrigens Knut Vietze, der sicher auch mit Busch zu tun hatte.
Welchen Stellenwert hatten die Arbeiterfestspiele Ihrer Meinung nach in der DDR?
Einen sehr hohen. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen, denn so was gibt es ja nicht mehr! Überlegen Sie mal, wie hoch allein die Aufwendungen für die künstlerischen Darbietungen waren! Das würde heute die Kulturbudgets von ganz Deutschland übersteigen.
War die Qualität hoch?
Die war sehr hoch. Und die würden wir heute gar nicht mehr erreichen, weil es ja keine so hervorragenden Laienchöre mehr gibt. Wir haben bei den Arbeiterfestspielen ja nicht mit Rundfunk-Chören gearbeitet, sondern hauptsächlich mit Laien, und die waren sehr gut. Da hätten sich damals schon viele professionelle Ensembles was abschneiden können. (…)
„Nachdem Adolf Fritz Guhl gestorben war, wurde ich sein Klavierbegleiter.“
Was, glauben Sie, hat Busch von den Festspielen gehalten? Er hat sich ja offenbar erst ein bisschen geziert …
Nein, das glaube ich nicht. Er hat schnell gemerkt, was er an uns hat. Er hat ja dann fast nur noch „meine Männer“ haben wollen für seine Aurora-Aufnahmen. Wir haben den gesamten Walter Mehring eingesungen und viele Arbeiterlieder neu aufgenommen. Ab und zu, zum Beispiel für „Arbeiter, Bauern“, hat er auch den Leipziger Rundfunkchor genommen, weil den damals Adolf Fritz Guhl dirigierte, der auch sein Klavierbegleiter war. Nachdem Guhl gestorben war, hat er sich erinnert, dass ich auch Klavier spielen kann. Und von da an war ich sein Begleiter – sowohl im Studio, als auch bei Konzerten. Als Mitte der 70er Jahre Luis Corvalán hier in Berlin war, hat Busch noch mal, obwohl er erst nicht wollte, ein Lied geschrieben. Der Text war von ihm und Heinz Kahlau, die Melodie hatte sich Busch nach einer Vorlage selbst gemacht. Wir haben das Lied dann im Palast der Republik aufgeführt.
Wissen Sie noch, ob Busch selber die Idee dazu hatte?
Die hatte er selber. Er kannte Luis Corvalán wohl persönlich und wollte ihm diese Botschaft direkt übermitteln.
Haben Sie noch weitere Veranstaltungen gemeinsam bestritten?
Ja, einige. Es gab wohl eine Veranstaltung, für die er seinen Freund Grigori Schneerson geholt hat. Aber der lebte in Moskau und war auch nicht immer abkömmlich um eben mal nach Berlin zu düsen. Und mittlerweile hatte er sich an mich gewöhnt und wollte mich auch nicht mehr losgelassen.
Haben Sie das gerne gemacht?
Natürlich, ich bin ja auch Pianist.
Ja, schon, aber hatten Sie auch die Zeit? Sie hatten doch viele Verpflichtungen durch Ihre Kompositionstätigkeit und Ihre Chöre …
Die Zeit hab ich mir genommen! Gerade die Aufnahmen haben mir Spaß gemacht, auch wenn Busch es einem nicht immer leicht gemacht hat . Es gibt da ’ne schöne Story: Ich war damals eigentlich auf dem Klavier, na, man kann fast sagen: unfehlbar. Das war nützlich, weil Busch doch bei Aufnahmen vielfach aussetzte, weil er husten musste oder sich ärgerte, wenn er ’s nicht genau so hinkriegte, wie er wollte. Er rief dann „Verdammt noch mal!“, und wir fingen wieder von vorne an. Also, ich musste die Lieder beliebig oft in gleicher Perfektion spielen, und das war kein Problem für mich. Ich glaube, es hat Busch innerlich gewurmt, dass mir nie ein Fehler passierte. Jedenfalls kann ich mich an eine Aufnahme erinnern, bei der ich irgendwie mal abgelenkt war, und da ging mir ein Ton daneben, und ich hörte auf und rief: „Verdammt!“ Da geriet Busch fast in Verzückung: „Hahaha! Er hat sich verspielt! Er hat sich verspielt!“ Er war so froh, dass ich auch mal einen Fehler machte … Das waren so Momente, in denen ich gemerkt habe, dass er schon auch persönlich dabei war und registriert hat, was der andere macht. (…)
(Exkurs über den Einsatz der Hammond-Orgel im Lied „Dem Revolutionär Jesus zum Geburtstag“; Lukowsky ist nicht sehr glücklich über die damalige Wahl des Instruments)
Busch sagte: „Der Text ist das Wichtigste, die Musik ist Nebensache!“
Worauf hat Busch denn bei den Aufnahmen am meisten Wert gelegt?
Dass seine Stimme gut zu hören war. Er hat zu mir gesagt: „Ich bin kein Sänger, ich bin Schauspieler! Der Text ist das Wichtigste, die Musik ist Nebensache!“ Das habe ich akzeptieren müssen. Das Verhältnis zwischen seinem Gesang und den Instrumenten war extrem ungleich. Er wollte immer 80 Prozent Gesang, 20 Prozent Musik. Das hat er exakt so bestimmt. Und das war mein großer Ärger, wenn wir Sachen mit Riesenorchester gemacht haben, weil er dann drauf gesungen und hinterher gesagt hat: 80 Prozent möchte ich haben, den Rest kriegt das Orchester. Das würde sich normalerweise kein Tonmeister von irgendeinem anderen sagen lassen.
Aber Bernd Runge hat das so machen müssen?
Ich denke schon. Bei den Chören war er etwas gnädiger, aber auch die hätten meiner Meinung nach lauter und dadurch zupackender sein können. Zum Beispiel beim „Lied der Ströme“, das er mit dem Rundfunkchor Leipzig gemacht hat – wunderschöne Aufnahme, aber der Chor müsste eigentlich lauter sein. Ich habe mich aber davor gehütet,dort hineinzureden. Denn ich kannnte Buschs Einstellung. Er hatte noch einen anderen Tick: Frauenstimmen konnte er nicht leiden, er wollte immer nur Männer! Frauen sollten möglichst kaum zu hören sein und im Hintergrund bleiben. Jetzt hatte dieser Eisler aber dummerweise auch Sachen für gemischten Chor geschrieben. Da musste er die Frauenstimmen ertragen, aber es war ihm nicht recht. Er hat das sehr deutlich gesagt. Einige Stücke für gemischten Chor sind sogar im Nachhinein, zum Teil von den Komponisten selbst, für Männer umgeschrieben worden. Ob das auf sein Bestreben hin geschah, weiß ich nicht.
Also stimmt das Klischee, dass er die Härte bevorzugt hat …
Ja. Unsere Männer mussten da dermaßen reinpusten! Wir haben das, als die Schallplatte mehrere Mehrspur-Studiogeräte anschaffen konnte, auf 16 Spuren aufgenommen: zwei Spuren für ihn, zwei Spuren für das Orchester und zwölf Spuren für den Chor. Das wurde dann viermal synchronisiert in Stereo. Und das konnte ihm nicht hart und nicht laut genug sein. (…) Im Nachhinein würde ich natürlich gerne einiges anders abmischen. Wenn ich zum Beispiel an das letzte Stück denke, das ich für ihn gemacht habe: das „Lied vom Klassenfeind“, das ja sein Schwanengesang war. Er selbst kam nicht mehr dazu, die Platte herauszubringen, das hat seine Frau dann getan. Das war ja auch die Tragik, dass er von einem bestimmten Zeitpunkt an zwar noch die Absicht hatte, Lieder aufzunehmen, es aber geistig und auch körperlich nicht mehr konnte.
Haben Sie diesen Verfall bemerkt?
Nein, ich habe das nicht mitbekommen. Solange wir zusammen gearbeitet haben, war davon kaum etwas zu spüren. (…)
Hatte Busch bei der Arbeit was Diktatorisches?
Natürlich. Wenn Busch sagte, dass etwas so gemacht werden sollte, dann wurde das so gemacht. Es war ja seine Produktion – zwar im Auftrag der Akademie, aber es blieb doch seine Produktion. Herr Gandert, hervorragender Tonmeister der Schallplatte, der Vorgänger von Herrn Runge, hatte andere Auffassungen seiner akustischen Tätigkeit.Bei der nächsten Platte war er nicht mehr dabei. Auch Hugo Fetting ist ja irgendwann nicht mehr dabei gewesen, woraufhin Engel kam, der zwar ein berühmter Mann war, aber vielleicht doch nicht für die Zusammenarbeit mit Ernst Busch prädestiniert erschien. Ich habe mich für diese Dinge aber nur am Rande interessiert.
Ernst Buschs Beerdigung: „Honecker kam mit seinem Volvo vorgefahren.“
Wie lange haben Sie mit Ernst Busch zusammen gearbeitet?
Tja, das muss bis etwa ein Jahr vor seinem Tod gewesen sein. Ich war dann natürlich auf seiner Beerdigung.
Wissen Sie noch, wie die Beerdigung ablief?
Ja. Wir warteten alle zur festgesetzten Zeit vor dem Haus. Dann kam Erich Honecker mit seinem kleinen Volvo vorgefahren, stieg hinten aus und ging ins Haus rein. Er kam dann mit Buschs Frau und Sohn wieder raus, und wir gingen gemeinsam zum Friedhof, der war ja gleich hinter seinem Haus. Das Grab war schon für die Urne vorbereitet, direkt hinter seinem Garten. Honecker und Irene sind vorneweg gegangen und das Gefolge hinterher. Ich glaube, der Kulturminister war auch da. Am Grab erklang dann „Wenn das Eisen mich mäht“ vom Band, das hatte sich Busch gewünscht. Ich meine, das war sogar eine Aufnahme, bei der ich gespielt hatte. Die Urne wurde versenkt, und dann war die Sache eigentlich schon erledigt. Wir gingen alle an der Witwe vorbei, Honecker war bald wieder weg, und wir sind dann auch nach Hause gegangen.
Es war ja nicht direkt ein Staatsbegräbnis …
Nein, das hätte Busch auch nicht gewollt. Er hätte sich nicht einmal gewünscht, dass Erich kommt, aber der ist nun mal gekommen. Mein Eindruck war, dass die Funktionäre, die da waren, nicht in offizieller Funktion gekommen waren, sondern einfach als Mitfühlende. (…)Als Busch noch gelebt hat, hat er sich ausdrücklich verbeten, dass man eines Tages ein Staatsbegräbnis für ihn veranstaltet. Er hatte zwar nichts gegen den Staat, aber Busch hatte sich mit den Machthabern nie ganz versöhnt. Sein Kommunismus war vielleicht mehr gefühlsmäßig, er hätte zum Beispiel jederzeit was abgegeben von dem, was er hatte, wenn es irgendjemand nötig gehabt hätte. Er war absoluter Kommunist, und er wäre sogar noch weiter gegangen.
Hat er Ihnen auch was geschenkt?
Nein, das brauchte er nicht, ich hatte ja selber genug. Das wusste er auch. Was ich von ihm kriegte, das waren die Partituren mit seiner Unterschrift und mit vielem Dank. Aber das hat mir ehrlich gesagt nicht viel bedeutet, weil ich so etwas nicht gesammelt habe. Unterschriften von großen Leuten haben mich nie interessiert. (…) Ich habe mich eigentlich immer nur für die Musik interessiert. Und Busch hat sich immer nur für seine Lieder interessiert. Für alles andere war seine Frau zuständig. Sie war es, die für Ernst eine Schreibmaschine mit Großschrift besorgte, die gab es ja nur im Westen. Die brauchte er für seine Texte, weil er die häufig vergaß und die kleinen Schreibmaschinen-Texte nicht mehr lesen konnte. Seine Frau hat dann die Texte für ihn abgetippt…
„Herr Busch, ich mache Ihnen das!“ – Das „Lied vom Klassenfeind“
Sie müssen sehr viel bei ihm zu Hause gewesen sein …
Ja, ich musste ja ständig proben mit ihm. Wenn ich zu ihm kam, machte seine Frau uns Kaffee und ein paar Brötchen, wir frühstückten dann gemeinsam und besprachen, was zu erledigen war. Seine Frau beteiligte sich nicht an den Diskussionen, das musste sie auch nicht, denn die drehten sich um rein musikalische Dinge. Sehr putzig war die Geschichte, als es um den „Klassenfeind“ ging: Da brachte er eine Notiz von Eisler, ein paar Noten auf einem Stück Notenpapier, ein Teil einer Melodie, die ich weiter verarbeiten sollte. Was er nicht erwähnte und was ich auch nicht wusste, war, dass dieser „Klassenfeind“ (Text: Bertolt Brecht) von Eisler bereits richtig vertont worden war. „Richtig“ heißt hier, dass die Komposition auch gedruckt war. Aber Busch hatte das Stück nie gesungen, weil es viel zu schwer war. Und jetzt hatte er diese eine Zeile auf einem Stück Papier, da hatte Eisler etwas hingekritzelt, was kaum zu verwenden war. Da sagte ich: „Herr Busch, ich mache Ihnen das!“ Und er: „Also los!“ – Ich machte mich sofort an die Arbeit, ohne wie gesagt die schon vorhandene Vertonung Eislers zu kennen. Ich hatte zwar die roten Bände der Eisler-Reihe zu Hause stehen, hatte die aber nicht komplett durchgeackert, weil ich mich immer um die Lieder gekümmert habe, die gerade gebraucht wurden. Ich habe ja mit vielen verschiedenen Sängern gearbeitet und aufgenommen, zum Beispiel mit HermannHähnel oder auch mit meiner Frau, die viel in dieser Art gesungen hat. Jedenfalls vertonte ich nun den „Klassenfeind“ und gab Busch anschließend die fertige Partitur. Oben hatte ich drauf geschrieben: „Lied vom Klassenfeind“, Worte: Bertolt Brecht, Musik: Rolf Lukowsky. Und wissen Sie, was er gemacht hat? Er hat die Partitur genommen, „Rolf Lukowsky“ durchgestrichen und „Hanns Eisler“ drüber geschrieben und darunter: „Bearbeitung: Rolf Lukowsky“. Da habe ich ihm dann sagen müssen: „ Herr Busch, so geht das nicht! Entweder wir vergessen das Ganze, oder mein Name kommt da wieder hin!“ Er hat dann gesagt: „Na gut, machen wir es halt so.“ Auf der Partitur hat sich das aber nicht geändert, die liegt heute noch so im Archiv.
Keine besonders saubere Art, mit Urheberschaft umzugehen …
Das hat er sich herausgenommen. Es kam aber noch besser: Er arbeitete hin und wieder auch mit einem Akkordeonisten zusammen, einem hervorragenden Bandoneon-Spieler. Der kam zu ihm, wenn ich nicht konnte oder Busch gerade anders disponiert hatte. Und eines Tages sehe ich das „Lied vom Klassenfeind“ bei Busch liegen, und da steht als Komponist der Name dieses Musikers drauf. Ich sage: „Was soll denn das nun wieder?“ Irgendwie hatte er vergessen, dass ich das gemacht hatte. Also, er hatte da was durcheinander gebracht, denn eigentlich war er sonst sehr genau und wusste immer: Das hat Eisler gemacht, das ist von Weill, dieses stammt von dem und dem. Naja, zum Schluss haben wir es ja hingekriegt, und auf der Platte sind die Angaben alle wieder richtig.
„Ich glaube, dass Busch mehr retrospektiv gelebt hat.“
Haben Sie manchmal diese Lücke bei Busch gespürt, die Eisler hinterlassen hat? Gab es dieses Gefühl: Dem fehlt offenbar sein Leib- und Magenkomponist?
Nee, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass Busch mehr retrospektiv gelebt hat. Er wollte all die Sachen, die er in den 30er Jahren bei Gloria und anderen Firmen aufgenommen hatte, noch mal neu aufnehmen. Vor allem auch die Sachen, die er im Spanischen Bürgerkrieg in einem Keller in Barcelona mit einem Gitarristen eingespielt hatte, „Peter, mein Kamerad“ und „Abschied von Spanien“ und all diese Lieder. Diese Aufnahmen waren zwar musikalisch hervorragend, aber technisch natürlich katastrophal. Ihm war klar, dass diese Platten, die übrigens auch schnell kaputt gingen, den modernen Ansprüchen nicht mehr genügten und auch nicht gesendet werden konnten. Er hatte in Spanien nichts weiter als ein kleines Mikrophon gehabt und einen einfachen Rekorder, das hat er mir erzählt. Hinzu kam folgendes: Eine amerikanische Plattenfirma hat sich damals die Songs genommen und ohne die Genehmigung von Busch, also widerrechtlich, neu herausgegeben Das war eine frühe Form der Musikpiraterie, und Busch war ziemlich sauer deswegen. Denn die hatten seine Lieder ja einfach geklaut und als „Originalaufnahmen aus Spanien“ verkauft. Das war auch ein Grund, warum er all das neu aufnehmen wollte. Und was den Eisler betrifft: Sein Tod hat Busch schon getroffen, aber seine direkte Zusammenarbeit mit Eisler war ja bereits vorher vorbei gewesen. (…)
Hat Sie das nicht gestört, dass Busch so sehr, wie Sie sagen, retrospektiv gearbeitet hat?
Nein, überhaupt nicht. Es haben sich ja zwischendurch interessante Dinge ergeben wie zum Beispiel die Platten mit Kästner. Abgesehen davon hatte ich genug andere Dinge zu tun, sodass ich mir über sein Repertoire nicht den Kopf zerbrochen habe. Ich konnte all die Aufgaben, die ich in dieser Zeit hatte, ja kaum bewältigen. Allein für die Arbeiterfestspiele habe ich ständig komponiert und bearbeitet. Das ging bis 1988, als die letzten Arbeiterfestspiele im Bezirk Frankfurt/Oder stattfanden. (…)
Sie haben sich, man kann sagen, drei Jahrzehnte lang um die Musik bei den Arbeiterfestspielen gekümmert. Wie haben sich die Festspiele im Lauf der Zeit verändert?
Zunächst einmal wurden sie immer größer. Und zweitens wurden sie qualitativ immer besser, weil sich die Qualität der einzelnen Gruppen verbesserte. Diese Gruppen, die dort auftraten, mussten sich für eine Teilnahme bewerben, da gab es regelrechte Ausscheide. Es gab eine Kommission, die in den entsprechenden Betrieb fuhr, und feststellte, ob die Gruppe in der Lage war, ein oder mehrere Konzerte zu geben. Denn alle, die eingeladen wurden, gestalteten dann in den Städten und Betrieben des Bezirks, in dem die Festspiele stattfanden, ein Programm. Und das musste natürlich ein bestimmtes Niveau haben. Etwas ganz anderes waren die zentralen Programme, zu denen auch bekannte Künstler verpflichtet wurden. Bei solchen Anlässen war jemand wie Busch natürlich ein Zugpferd, den kannten die Leute. Die Älteren haben ihn sowieso verehrt, aber auch die Jüngeren wussten, wer er war. Aber im Mittelpunkt bei den Arbeiterfestspielen standen nicht die Stars, sondern eher normale Leute, die sich auf die Bühne gestellt haben und ihre Sache sehr gut gemacht haben. Das war eigentlich das Entscheidende!
Sie haben gesagt, dass Busch sich vor allem als Schauspieler gesehen hat. Hat er auch gemerkt, dass die Leute mehr in ihm sehen als den Künstler? Dass er auch eine sozialistische Symbolfigur war?
Ja, das musste er ja merken. Zum Beispiel hat der bekannte Kritiker Herbert Ihering jeden Montag bei ihm angerufen und gefragt: „Hallo Ernst, wie geht ’s Dir?“ Das war ganz normal, Busch nannte ihn den „Montagsmann“. Dann war Busch ein persönlicher Freund von Franz Dahlem und anderen bekannten Leuten in der DDR. Viele haben sich mit Anfragen und Bitten an ihn gewandt, und seine Aufnahmen waren auf der ganzen Welt bekannt. In Moskau wurden seine Lieder sehr erfolgreich herausgegeben. Also, er saß schon ganz oben, das muss man sagen.
„Man musste einfach die Fähigkeit haben, auf Durchzug zu stellen.“
War es auch so was wie eine Ehre für Sie, mit ihm zusammenzuarbeiten?
Nein. Dass er aufgrund seiner Erfahrung und seiner Biographie über vielen Dingen stand, war völlig klar. Und er wusste auch, dass ich das nie angezweifelt hätte. Aber deswegen habe ich ihm trotzdem im musikalischen Bereich meine Meinung gesagt. Ich habe gesagt: „Herr Busch, ich möchte gerne, dass zumindest diese Stelle noch ein bisschen sauberer wird, ich meine jetzt: in der Tonhöhe!“ Dann hat er gesagt: „Ist mir scheißegal – Hauptsache der Text kommt rüber!“ Er kriegte eben manche Spitzentöne in der Höhe nicht mehr richtig. Daran wollte ich mit ihm arbeiten. Heute wäre das kein Problem, man würde einfach mit dem Computer etwas nach oben korrigieren. Auch Runge hat ganz vorsichtig auf solche Dinge hingewiesen. Aber da stieg Busch nicht drauf ein. (…)
Zum Schluss würde ich gerne wissen, was Ihnen rückblickend die Arbeit mit Busch bedeutet hat. Welchen Stellenwert hatte dieser Job für Sie?
Es war innerhalb meiner musikalischen Betätigung schon eine sehr wichtige. Wobei ich sagen muss, dass ich zu der Zeit auch ohne Busch alle Hände voll zu tun hatte. Nur damit Sie die Relationen verstehen: Ich habe pro Woche mit meinen eigenen Chören mindestens fünf, sechs Tonaufnahmen im Rundfunk oder in der „Schallplatte“ gemacht. Zusätzlich habe ich für den Rundfunkjugendchor in Wernigerode jeden Monat zehn bis zwanzig Aufnahmen vornehmlich mit meinen eigenen Sachen vorbereitet, arrangiert und bei Bedarf Grundbänder mit Orchester produziert. Dann kam Busch mit vielleicht vier bis sechs Terminen im Monat. Also, Sie sehen, es war eine recht breit gefächerte Tätigkeit. Und zwischendurch saß ich zu Hause und habe Noten geschrieben …
Ja, aber unterschied sich die Arbeit mit Busch nicht sehr von den anderen Tätigkeiten, die Sie jetzt genannt haben?
Nicht so sehr, wie Sie vielleicht denken. Wenn ich heute zurückblicke, ist mir wichtig, dass ich über meine Aufnahmen, es sind über 1000 insgesamt, sagen kann: Die haben wir abgeliefert, und die sind da! Egal, mit wem, und egal, ob in guter oder hervorragender Qualität, denn sonst hätte sie der Funk oder die „Schallplatte“ nicht genommen – die Sachen sind da, und sie sind mein Lebenswerk. Und da gehört Busch natürlich dazu. Genauso wie Hermann Hähnel, der ja ein Nachfolger von Busch war. Ich könnte Ihnen sogar einige Aufnahmen vorspielen, wo Sie nicht hören würden, ob es sich um Busch oder Hähnel handelt. Aber eines ist schon richtig, und darauf wollen Sie wohl hinaus: Die Stimme von Ernst Busch, die ja wirklich mehr vom Schauspielerischen geprägt ist, die macht ihm keiner nach. Die wird es nicht mehr geben, nie wieder, die ist einmalig. An der Interpretation von Arbeiterliedern haben sich ja viele andere versucht. Und für meine Begriffe hat es nur der Hermann Hähnel so richtig gepackt. (…) Aber diese Ära ist vorbei. Und zwar endgültig. Nicht nur, weil es keiner mehr kann, sondern auch, weil es keiner mehr will. Die Zeiten haben sich geändert. Insofern ist das Thema Ihrer Dissertation wirklich ein historisches. Wahrscheinlich sehe ich die Sache heute anders als damals. Aber ich kann nun nicht sagen, dass ich besonders stolz darauf bin, mit Busch gearbeitet zu haben. Es gehörte dazu. Die Gelegenheit hat sich ergeben, und ich habe sie wahrgenommen. (…) Er hatte wie jeder Künstler seine Höhen, und er hatte seine Tiefen. Das Bemerkenswerte an ihm bleibt seine Einmaligkeit als Sänger und auch als Schauspieler. Und was seine berühmten Tiraden betrifft gegen irgendwelche ihm missliebigen Genossen oder wegen anderer Dinge: Da musste man einfach die Fähigkeit haben, auf Durchzug zu stellen. Damit hatte ich kein Problem. Untergeordnet habe ich mich deswegen nicht.
Interview: Jochen Voit
Foto: Jochen Voit
(Textfassung autorisiert von Dr. Rolf Lukowsky am 19. 12. 2007)

Margrit Manz
über ihre Mutter Charlotte Wasser und deren große Leidenschaft für Ernst Busch
„Mein Gefühl war, dass er seine Zeit gehabt hatte und zu denen gehörte, die man in Ruhe lassen sollte.“
(Gespräch am 29. August 2006 in Berlin-Wannsee)
Margrit Manz ist Jahrgang 1954. Sie wächst als einziges Kind von Charlotte und Artur Wasser in Berlin auf. Da ihre Eltern, die beide als Lektoren arbeiten, beruflich stark eingespannt sind, lebt sie bis zu ihrem sechsten Lebensjahr zeitweise bei Verwandten in Kreuzberg im amerikanischen Sektor. Kurz vor dem Bau der Berliner Mauer holen Artur und Charlotte Wasser ihre Tochter zu sich nach Ost-Berlin, wo sie auf die Schliemannschule in der Greifswalder Straße geht, eine Schule mit Sprachenschwerpunkt. Margrit Wasser durchläuft die DDR-Jugendorganisationen (Pioniere und FDJ) und entwickelt, gefördert durch die Kulturbegeisterung der Eltern, frühzeitig künstlerische Neigungen. Dem großen Interesse ihrer Mutter an Ernst Busch, das sich in exzessivem Abspielen von Busch-Platten im heimischen Wohnzimmer äußert, steht sie allerdings eher skeptisch gegenüber. Nach dem Abitur 1972 besucht sie die Staatliche Schauspielschule; 1974 heiratet sie den Schauspieler Horst Manz. Bis in die 80er Jahre spielt sie Rollen am Theater und im Fernsehen, macht Hörspiele im Radio und arbeitet als Sprecherin für Schallplattenproduktionen. Nach der Wende 1989 folgt die berufliche Neuorientierung: ”Da war plötzlich diese Neugier auf die Welt”, sagt Margrit Manz. Die neu gewonnene Freiheit habe bei ihr zur ”Entdeckung der Straße” geführt, aber auch zur Wiederentdeckung der von Kindheit an vertrauten Welt der Bücher. 1990 ist sie Mitbegründerin der literaturWERKstatt berlin, gestaltet Programme und betreut Buchprojekte. Von 2000 bis 2008 ist sie Intendantin des Literaturhauses Basel. Aktuell betreut sie einen Künstleraustausch zwischen der Schweiz und China. Margrit Manz lebt in Basel. Unser Gespräch findet am Wannsee im Haus des Literarischen Colloquiums Berlin statt.
Zum besseren Verständnis des Interviews seien einige biografische Angaben zu Charlotte Wasser vorausgeschickt – mein Dank gilt Frau Sabine Wolf, der Leiterin des Literaturarchivs im Archiv der Akademie der Künste in Berlin, die mir autobiografisches Material aus dem Nachlass Charlotte Wassers zur Verfügung gestellt hat.
__________________________________________________________________________
Charlotte Wasser ist Jahrgang 1914. Sie wächst in Breslau gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Herbert in bescheidenen Verhältnissen auf, der Vater ist Schneider, die Mutter Hausangestellte. Obwohl sie aus der Arbeiterklasse komme, so schreibt Charlotte Wasser in einem in den 1960er Jahren verfassten Lebensbericht, sei sie ohne jedes Klassenbewusstsein erzogen worden; die Eltern ”sehnten sich heraus aus dieser Armut und vertrauten dem Lotterielos mehr als ihren eigenen Kräften.” Nach Abschluss der Volksschule 1928 arbeitet Charlotte Wasser (damals noch: Charlotte Sille) als Hilfskraft in einem Milchgeschäft und als Hausangestellte in Breslau. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 bedeutet für sie zunächst keinen biografischen Einschnitt, ihre vierjährige Haushaltstätigkeit sorgt für eine trügerische Kontinuität: ”Diese Arbeit, die mich sehr von den Menschen isolierte, trug mit dazu bei, daß ich politisch blind blieb. Von den Kommunisten hatte ich nur die Vorstellung mitbekommen, daß sie Unordnung stifteten, nicht arbeiten wollten, sich Freitags betranken und dann ihre Familien prügelten. Ich sehnte mich aber nach Bildung und einem geordneten Leben, zu dem die Arbeit als fester Bestandteil gehörte. Den Faschismus sah ich damals nur von dem Gesichtspunkt aus, daß er den Menschen Arbeit und Brot versprach und für Ordnung sorgte. Ansonsten hielt ich Politik für eine Sache, die mich nichts anging, um die sich andere zu kümmern hatten.” Von 1937 an absolviert Charlotte Wasser eine Lehre als Verkäuferin in einem Lebensmittelgeschäft in Berlin. 1937, kurz bevor sie nach Berlin geht, lernt sie Artur Wasser kennen, den sie zwei Jahre später heiratet. Ihr Mann, so schreibt sie später, habe alles daran gesetzt, ihr ”falsches Bewusstsein (ich nenne es heute die Kleinbürgerideologie) zu zerschlagen”; ihm habe sie ihre politische Entwicklung zu verdanken.
Artur Wasser (1912-2004) ist gelernter Maschinenschlosser und überzeugter Kommunist, seine Mitgliedschaften im Kommunistischen Jugendverband, in der Revolutionären Gewerkschafts-Opposition (RGO) und in der Roten Hilfe Deutschlands (RHD) haben ihn bereits in der Weimarer Republik in berufliche Schwierigkeiten gebracht. Während des Nationalsozialismus gerät er wegen kommunistischer Propagandatätigkeit ins Visier der Geheimen Staatspolizei (Gestapo), die den bereits 1939 zur Deutschen Wehrmacht eingezogenen Artur Wasser im Jahr 1941 für zwei Monate im Gefängnis Brünn inhaftiert. Danach arbeitet er bei Rheinmetall-Borsig in Breslau, steht aber weiterhin unter Beobachtung der Gestapo. Von 1942 an ist er als Soldat in Südfrankreich im Einsatz. Im August 1944 begeht er Fahnenflucht und gerät in amerikanische Kriegsgefangenschaft.
Charlotte Wasser lebt während des Zweiten Weltkriegs in Breslau, wo sie 1941, wenige Tage nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion, wegen einer unbedachten Bemerkung gegenüber einem Straßenpassanten festgenommen wird (”Ich hatte meine Freude über den baldigen Sieg der Sowjetunion zu offen bekundet”). Sie verbringt fünf Monate in Einzelhaft im Untersuchungsgefängnis Breslau, ehe sie im Februar 1942 ”wegen Vorbereitung zum Hochverrat” angeklagt wird. Aus Mangel an Beweisen spricht man sie frei. Daraufhin wird sie als Bürohilfskraft im Fliegerhorst Breslau-Gandau dienstverpflichtet. In den letzten Kriegsmonaten versteckt sie einen litauischen Kriegsgefangenen (in einem zweiten Lebensbericht von C.W. heißt es: ”einen Polen”) bei sich zu Hause, weswegen ihre Wohnung von sowjetischen Übergriffen verschont bleibt und sie bis Ende 1946 in Breslau bleiben kann. In dieser Zeit arbeitet sie als Verkäuferin. Gemeinsam mit ihrer Mutter übersiedelt Charlotte Wasser schließlich nach Berlin, wo sie 1947 ihren aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Mann trifft. Beide treten in die SED ein und finden über Weiterbildungsmaßnahmen den Weg in die Kulturpolitik. Artur Wasser wird von der Bezirksparteileitung an die auf Geheiß der Sowjets gegründete Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät (Gewifa) der Leipziger Universität delegiert. Charlotte Wasser begleitet ihren Mann und besucht als Gasthörerin ebenfalls Vorlesungen. Von 1949 an lebt das Ehepaar Wasser in (Ost-) Berlin. Artur Wasser wird zunächst wissenschaftlicher Bibliothekar an der Berliner Stadtbibliothek, dann Lektor des Amtes Buch und Büchereiwesen in der Abteilung Volksbildung des Magistrates von Groß-Berlin. Charlotte Wasser arbeitet von 1950 an als Lektor (so die damalige Berufsbezeichnung auch für Frauen) in verschiedenen Institutionen, nebenbei absolviert sie ein zweijähriges Studium für Kulturschaffende an der Abenduniversität, ein einjähriges Direktstudium an der Bezirksschule der SED und besucht einen dreimonatigen Lehrgang an der Bezirksschule der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF). Die beruflichen Stationen bis zum Beginn ihrer freiberuflichen Tätigkeit im Jahr 1960 sind: Lektor für neue deutsche Literatur im Deutschen Schriftstellerverband (1950/51), Lektor im Verlag Neues Leben (1951/53), Lektor im Verlag Kultur und Fortschritt (1954), Referent für sowjetische Literatur im Zentralvorstand der DSF (1955/59). In den 60er, 70er und 80er Jahren ist Charlotte Wasser, wie sie selbst es ausdrückt, ”freiberuflich tätig als Autor literarischer Porträts und Literaturpropagandist”. Sie spezialisiert sich auf biografische Darstellungen von Künstlern, deren Persönlichkeit und Lebenswerk sie bewundert. Nicht nur Schriftsteller werden von ihr porträtiert, sondern auch Maler (Picasso), Politiker (Lenin) und Schauspieler (Ernst Busch). Ihre bevorzugte Darstellungsform ist der Dia-Ton-Vortrag (auch ”Tonband-Bildstreifen” genannt), wobei sie diese Art der Kulturvermittlung vor allem in Schulen und in Kulturhäusern verschiedener (Ost-) Berliner Wohngebiete betreibt. Am stärksten wirkt sie in Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Pankow. Unterstützt wird sie bei ihrer Arbeit von SED-Kreisleitungen, FDGB-Kreisvorständen und den Räten der Stadtbezirke. Einige ihrer Tonband-Bildstreifen finden über die Hauptstadt der DDR hinaus Verbreitung. Insbesondere ihr Porträt über Ernst Busch, dessen erste Version 1967 fertiggestellt ist, erreicht ein großes Publikum und erntet viel positive Resonanz. Der Dia-Ton-Vortrag dient als Lehrmaterial im Ausland und läuft an zahlreichen Moskauer Schulen. Auch aus anderen Ostblock-Staaten erhält Charlotte Wasser Lizenzanfragen, sodass ihr Busch-Porträt schließlich in mehrere Sprachen übersetzt wird und bis in die 80er Jahre hinein immer wieder gezeigt wird. Dem Protagonisten ihres erfolgreichsten Vortrags bleibt sie bis zu dessen Tod im Jahr 1980 freundschaftlich verbunden. Charlotte Wasser stirbt 2001.
—————————————————————————————————
Texte von Charlotte Wasser über Ernst Busch:
– Charlotte Wasser: Ernst Busch. Sein Leben und Wirken in Lied, Wort und Bild. Erläuterungsheft zum Tonband-Bildstreifen. Hrsg. v. Rat des Stadtbezirks Berlin-Fried-richshain u. d. FDGB-Kreisvorstand Berlin-Friedrichshain. (Ost-) Berlin o.J. (vermutl. 1967).
– Charlotte Wasser: Ernst Busch zum 95. Geburtstag. In: Pankower Brücke 12/1994, S. 13.
———————————————————————————————————
JV: Bevor wir über die intensive Beschäftigung ihrer Mutter mit dem Leben und Werk von Ernst Busch reden, würde ich gerne etwas über die Zeit vor 1945 erfahren. Hat Charlotte Wasser Ihnen davon erzählt, wie sie aufgewachsen ist?
Margrit Manz: Ja, sie hat manchmal davon gesprochen. Sie stammte aus zutiefst ärmlichen Verhältnissen. Das war ein proletarisches Milieu, aber nicht so eins, wie es später in der DDR gerne verklärend dargestellt wurde, sondern eins, in dem sich all die Tragödien abspielten, die in dem ideologischen Schwadronieren über die Kraft der Klasse nicht vorkamen. Sehr oft war gerade hier das menschliche Miteinander verkümmert, und das war das Tragische. Armut kann ja sehr hart und böse und aggressiv machen. Meine Mutter fand es verrückt, dass ausgerechnet dort, wo der Kommunismus seine Basis hatte, die Männer unter der Woche ihre Frauen verprügelten und dann am Wochenende auf die Straße gingen, um für ein besseres Leben zu demonstrieren – mit der Gleichberechtigung der Frau auf der Fahne. Diesem Milieu wollte sie entfliehen und zwar nicht, um in eine andere Klasse hineinzukommen, sondern einfach, um diese Primitivität nicht mehr täglich erleben zu müssen. (…) Sie war ein bildungshungriger Mensch, das heißt, sie hat intuitiv erfasst, dass die Bildung ihr ermöglichen würde, in andere Kreise zu gelangen, also Menschen kennenzulernen, die sie interessieren könnten. Sie hatte ja kaum Menschen, mit denen sie sich austauschen konnte. Durch einen großen Zufall hat sie dann meinen Vater gefunden, der wie sie auf der Suche war und auch diesen Bildungshunger hatte. (…)
Das heißt, Ihre Mutter durfte auch keine höhere Schule besuchen …
Das war ihr größter Schmerz gewesen. Meine Großmutter hatte sie aus der Schule rausgenommen, als sie 14 war. Der Lehrer kam damals sogar extra ins Haus und sagte: ”Ihre Tochter ist so intelligent, lassen Sie sie doch weitermachen! Sie bekommt auch ein Stipendium von der Stadt!” Aber meine Großmutter sagte: ”Es geht nicht nur ums Schulgeld, sie muss was zum Haushalt dazuverdienen!” (…) Das war eine wahnsinnig harte Zeit, und meine Mutter hatte damals schon diese Neugier und diese Sehnsucht nach Kultur. Sie spürte, dass sich ihr die Welt nur durch Wissen erschließen würde, denn durch ihre Herkunft und ihren Stand war ihr die Welt ja zunächst verschlossen. (…)
Sie sagen, Ihr Vater war ähnlich bildungshungrig wie Ihre Mutter. Wie haben sich Ihre Eltern kennengelernt?
Meine Mutter arbeitete in Breslau in einem sogenannten Milch-Häuschen, wo es allerlei Milchspeisen gab und heißen Kakao und solche Sachen. Dorthin kam mein Vater und bestellte sich eine Milch, worauf die beiden ins Gespräch kamen. Das wiederholte sich mehrmals, und sie hat mir erzählt, dass regelmäßig die Milch überkochte, weil sie so abgelenkt war, wenn sie miteinander sprachen, bis dann ihr Chef meinte: ”Wenn das noch mal passiert, schmeiß‘ ich Sie raus!” So hat es angefangen zwischen meinem Vater und meiner Mutter, im Milch-Häuschen. Es ist ein großes Glück gewesen, das ein Leben lang, man kann wirklich sagen: bis zum letzten Atemzug, gehalten hat. Sie war ja schon über 20 Jahre alt gewesen damals, was ungewöhnlich war. Bei ihr zu Hause hieß es immer: ”Du musst früh heiraten!”, und alle Mädchen ihres Alters um sie herum waren schon verheiratet. Aber sie hat sich gesträubt und geweigert, bis sie Artur Wasser begegnet ist, das war Mitte der 30er Jahre. Mein Vater kam wie meine Mutter aus armen Verhältnissen und sollte auch ein Stipendium bekommen, was er abgelehnt hatte, weil er der Meinung war, dass man erst was Handfestes lernen sollte. Er wurde Maschinenschlosser, also was sehr Bodenständiges, machte aber noch eine Zusatzausbildung als Flugzeugmechaniker, was während des Krieges dann eine Rolle spielte. Nebenbei hat er sich privat weitergebildet, hat sich selbst Bücher angeschafft und viel gelesen, hat Englisch gelernt anhand von eigener Lektüre, was dazu führte, dass er alles falsch aussprach, weil er die Sprache ja nie gehört hatte. Und er hat als überzeugter Kommunist aktiv im Untergrund mitgearbeitet, hat Flugblätter verteilt und ist bei geheimen Treffen dabei gewesen. Er war schon früh in einer kommunistischen Jugendorganisation gewesen. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, dass mein Vater für sie der politische Lehrmeister gewesen sei, also im sehr positiven Sinne: dass er ihr sozusagen die Welt auf eine Art neu erschlossen hat, die dann ihr Leben doch sehr bestimmt hat. Sie hat das verstanden als aktive Teilnahme am weltlichen Geschehen, was sie bis dahin nicht gekannt hatte. Sie sagte, sie sei vorher ein apolitischer Mensch gewesen.
”Sie war des Hochverrats angeklagt und saß deswegen im Zuchthaus.”
Wie haben Ihre Eltern den Zweiten Weltkrieg überstanden?
Mein Vater wurde früh eingezogen. Kurz bevor er in den Krieg musste, haben meine Eltern noch geheiratet. Was mein Vater im Krieg erlebt hat, hat er nur sehr bruchstückhaft erzählt. Er war auf einem Begleitboot, das U-Boote unterstützt hat bei den großen Fahrten durch die Meere. Für einen Menschen, der mit großen Wasseransammlungen nicht so vertraut war, obwohl er ”Wasser” hieß, war das sehr schwierig. Er hat gesagt, dass er oft Panik hatte. Man musste jeden Abend mit Rettungsring schlafen gehen, weil das Begleitboot, wenn bombadiert wurde, zuerst dran war. Er war später auch auf dem Land in Südfrankreich eingesetzt, wo er dann übergelaufen ist. Er hat die kleine Gruppe versprengter Soldaten um sich herum noch überredet, nicht weiterzukämpfen und sich in Gefangenschaft zu begeben. Damit war der Krieg für ihn vorbei. (…) Mein Vater kam in amerikanische Gefangenschaft, wurde in die Südstaaten verlegt, wo er in einem Camp untergebracht war und auf die Felder gejagt wurde, um Baumwolle zu pflücken. Irgendwann hatte er dann den Spitznamen ”Professor Waters”, weil er sich da als Lagersprecher hervorgetan hat und den Leute erzählt hat, wie die politische Zukunft aussehen würde. Die Amerikaner haben ihm dann gesagt: ”Mann, übertreiben Sie ’s nicht! Sie machen ja hier aus dem Camp ’n kommunistisches Umerziehungslager!” Aber es gab auch weniger freundliche Hinweise, ernsthafte Drohungen von Mitgefangenen, die seine Weltanschauung nicht teilten. Dann wurde mein Vater nach England verlegt, wo er auf einem Fliegerhorst Flugzeuge reparierte. Er kam, ich glaube, 1947 zurück aus der Gefangenschaft. (…) Er konnte dann natürlich sehr gut Englisch, hat aber die Sprache, und das ist wohl typisch für die Zeit, wieder ein bisschen zur Seite getan, denn sie gehörte ja nicht zum Freundschaftsbereich der sozialistischen Gemeinschaft, in der er sich nun befand. (…) Beide, mein Vater und meine Mutter, sind übrigens vor 1945 für kurze Zeit im Gefängnis gewesen: Meine Mutter war des Hochverrats angeklagt und saß deswegen im Zuchthaus in Breslau, und auch mein Vater war im Gefängnis eingesperrt wegen aufrührerischer Aktivitäten – ich weiß den genauen Wortlaut der Anklage nicht, es ging um illegale politische Tätigkeit. Er hat deswegen nie jemandem Vorwürfe gemacht, sondern hat gesagt: ”Ich bin halt einfach erwischt worden.” Und meine Mutter ist wegen einer fast blöden Geschichte verhaftet worden: Mein Vater hörte immer, wenn er auf Heimaturlaub war, die verschiedenen Rundfunksender ab und sagte irgendwann: ”Keine Angst! Der Krieg dauert nicht mehr lang!” Das hat meine Mutter voller Glückseligkeit wiederholt, als jemand dabeistand, der fest an den sogenannten Endsieg glaubte. Der sagte dann: ”So? Wie kommen Sie denn darauf?” Und der hat sie denunziert. Meine Mutter ist im Sommer 1941 verhaftet worden und saß dann in ihrem dünnen Kleid schlotternd im Gefängnis, ohne zu wissen, wie lang man sie festhalten würde. Das muss furchtbar gewesen sein für so eine junge und, verglichen mit meinem Vater, in gewisser Weise naiv denkende Frau. Zum Teil war sie auch in Einzelhaft, das war alles nicht lustig. Aber sie hat später daraus nie Kapital geschlagen. In der DDR gingen ja gelegentlich Formulare rum, die man ausfüllen und sich damit als Verfolgte des Naziregimes zu erkennen geben konnte. Sie sagte immer: ”Das gilt nicht mir, sondern denjenigen, die im Konzentrationslager gesessen haben und denen Schaden zugefügt wurde aufgrund ihrer Herkunft.” Auch mein Vater hat keine Vergünstigungen in Anspruch genommen. Beide sagten: ”Wir haben unsere Weltanschauung gewählt und dazu stehen wir. Das muss nicht vergütet werden. Ein jüdischer Mensch zum Beispiel hat sich seine Herkunft nicht ausgesucht, er ist völlig ungerechtfertigt verfolgt worden, und ihm steht Wiedergutmachung zu.”
”Meine Mutter hatte im Krieg einen Deserteur bei sich versteckt.”
Eine selbstlose Haltung – sie hätten sich leicht Vorteile im DDR-Alltag verschaffen können …
Sicher, meine Eltern sind darauf auch angesprochen worden von Bekannten: ”Ach, Gott, bist du dumm, warum machste denn das nich‘?” Ich fand ’s eigentlich klasse, dass meine Mutter das nicht in Anspruch genommen hat. Denn wenn man diese Vergünstigungen annahm, war man in gewisser Weise erpressbar: Wenn mal Meinungen gefragt waren, staatskonforme Meinungen selbstverständlich, dann mussten meistens die anderen ran – meine Eltern mussten sich bei solchen Gelegenheiten selten äußern. Diejenigen, die Geld bekamen als Verfolgte des Naziregimes, gehörten zu den Gruppen, die beispielsweise bei der Biermann-Ausbürgerung besonders aufgefordert waren, Stellung zu beziehen, also sich von Biermann zu distanzieren und dem ”Klassenfeind” eins auf die Mütze zu geben. Und meine Eltern wollten, später jedenfalls, frei sein von diesem Gruppendruck.
Wobei Ihre Eltern ja auch eingebunden waren, denn sie waren beide in der SED …
Ja, das stimmt, sie sind ganz früh in die SED eingetreten. Meine Eltern trafen sich ja nach der Rückkehr meines Vaters in der Sowjetischen Besatzungszone wieder. Das war eine bewusste Entscheidung. Mein Vater war von den Engländern gefragt worden, in welche Zone Deutschlands er möchte, und er hatte sofort gesagt: ”In die Sowjetische.” Das hörten die Engländer natürlich nicht so gerne, aber für ihn war das eine klare Sache. Meine Mutter hatte das Kriegsende in Breslau erlebt, wo sie in den letzten Monaten noch einen Litauer bei sich in der Wohnung auf dem Hängeboden versteckt hatte. Das war eine irrsinnige Geschichte, die ich nur kurz erwähnen möchte: Dieser junge Mann ist desertiert, er wollte den Krieg nicht länger mitmachen. Meine Mutter hat ihn versteckt, wodurch sie sich in Todesgefahr begab, denn überall war zu lesen: ”Wer Deserteure versteckt oder auch nur weiß, wo sie sich verbergen und es nicht meldet, der wird mit dem Tode bestraft.” Aber sie hat das durchgehalten in einem Mietshaus, wo die Blockwarte ziemlich scharf waren. Der Litauer hat dann ’45 bei den russischen Behörden erreicht, dass an der Wohnungstür meiner Mutter ein schützender Hinweis angebracht wurde: ”Hier hat eine Frau heroisch Widerstand geleistet”, so was in der Art stand da drauf. Dadurch war meine Mutter vor den ersten Plünderungen der Roten Armee geschützt, die damals überall stattfanden. (…) Dann mussten die Deutschen raus aus Breslau, und meine Mutter hat die Koffer gepackt und sich auf den Weg nach Westen gemacht. (…) Sie hatte Glück, weil die Schwester meiner Großmutter in Berlin lebte und gesagt hat: ”Ihr könnt zu mir kommen, ich nehm‘ Euch auf!” So ist meine Mutter gemeinsam mit ihrer Mutter in Berlin gelandet, wo sie erst mal Unterschlupf fanden.
”Die DDR ermöglichte meinen Eltern ein zweites Leben.”
Die Entscheidung, in der Sowjetischen Besatzungszone und dann in der DDR leben zu wollen, war für Ihre Eltern selbstverständlich …
Ja, das war der einzige Ort in Deutschland, wo es ihrer Ansicht nach in eine neue Zeit aufbrach. Die alte Zeit kannten sie zur Genüge – diese Zeit sollte keinesfalls wiederhergestellt werden, und das schien der Sozialismus zu garantieren. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, dass nach ’49 ihr zweites Leben begann. Sie hat es ihr ”eigentliches Leben” genannt, was sie dann in der DDR geführt hat.
Wie kam es dazu, dass ihre Mutter dann zu einer so umtriebigen Kulturvermittlerin geworden ist? Die Rolle, die sie im Kulturleben der DDR gespielt hat, war ja eine besondere, zumal sie eigentlich gar nicht die Voraussetzungen von Haus aus dafür mitbrachte.
Das ist richtig. Man muss sich die Aufbruchstimmung der ersten Zeit vor Augen halten. Am Anfang gab es ja Freiräume, die man sich heute kaum mehr vorstellen kann. Meine Mutter musste sich in der Sowjetischen Besatzungszone bei einer Behörde melden und wurde da gefragt: ”Was würden Sie gerne beruflich machen?” Darauf sagte meine Mutter: ”Ich würde sehr gerne in der Kultur arbeiten. Literatur, das wär‘ das Schönste!” – ”Na, wunderbar, dann gehen Sie nach Leipzig an die Universität und studieren Politik und Literatur!” Meine Eltern sind Ende der 40er Jahre gemeinsam nach Leipzig gegangen, haben an der Universität Vorlesungen gehört, wo es ja tolle Professoren gab wie Ernst Bloch. Meine Mutter war Gasthörerin, weil sie immer den Kontakt zu Berlin halten wollte, und mein Vater war richtig eingeschrieben und hat dort, ich glaube, knapp drei Jahre studiert. Bald kam dann das Angebot für meine Mutter von dem 1946 gegründeten Verlag Neues Leben, sich um die nachwachsende Literatur zu kümmern, also am Aufbau junger Autoren mitzuwirken. (…) Und mein Vater wurde schließlich Lektor beim Akademie-Verlag. Das war natürlich eine wunderbare Entwicklung für die beiden, die sich nun mit den Dingen beschäftigen konnten, die sie schon immer interessiert hatten. Die DDR ermöglichte meinen Eltern ein zweites Leben. Das haben sie beide selber so gesehen. Es war ein erfülltes Leben, das reich war an Wissen und Wissensvermittlung, denn beide verstanden sich nicht nur als Kultur-aufsaugende Menschen, sondern immer auch als Weitergebende, das war ihnen ganz wichtig.
Wie äußerte sich das?
Ich erinnere mich zum Beispiel an unzählige Diskussionsabende, die bei uns zu Hause abliefen. Das waren private Treffen, durchaus große Runden, bei denen alle möglichen Themen besprochen wurden, meist ging es um Literatur und Kunst und Politik, und ich durfte als Kind oft dabeibleiben, bis ich vor Müdigkeit die Augen nicht mehr offen halten konnte. Also, abends klingelte und klopfte es ständig bei uns an der Tür, weil wir meistens Gäste hatten. Das sprach sich natürlich rum. Besonders meine Mutter wurde im Lauf der Jahre zu einer Art Institution, du konntest mit ihr keine zehn Schritte in unserem Stadtteil gehen, ohne dass sie von irgendjemandem angesprochen wurde. Sie war Ausleihstation für Bücher und leistete Lebensberatung in allen möglichen Fragen: Sie half gerne anderen Leuten, die mit Problemen zu ihr kamen. (…) Ich habe jetzt zeitlich einen Sprung gemacht, wir befinden uns nun am Ende der 60er Jahre. Ich bin 1954 geboren und habe anfangs viel Zeit bei Onkel und Tante in West-Berlin verbracht, weil meine Eltern sich doch sehr um ihre Ausbildung und ihren Beruf und ihre Weiterbildung bemühten. Erst ’61, kurz vor dem Mauerbau, bin ich endgültig rübergeholt worden zu meinen Eltern nach Ost-Berlin. Das war eine abenteuerliche Aktion mitten in der Nacht, als es hieß ”Zieh dich ganz schnell an!” und ich auf irgendwelchen Schleichwegen auf die andere Seite verfrachtet wurde. Das ging ja sozusagen gegen die Laufrichtung der vielen anderen Leute, die von Ost nach West hüpften. Bei mir verlief der Weg umgekehrt, und ich bin bald danach in Ost-Berlin eingeschult worden. Von da an ging mein Weg im Osten den normalen Gang. Dass man nicht mehr zurück in den Westen gehen konnte, war natürlich schlimm, aber das wusste damals keiner, ich als Kind schon gar nicht. (…)
”Sie flog mehrmals raus, weil sie sich weigerte, Menschen preiszugeben.”
Ihre Mutter war nicht allzu lange Mitarbeiter im Verlag Neues Leben. Hat Sie dort Schwierigkeiten bekommen?
Ja, meine Mutter ist aus dem Verlag Neues Leben rausgeschmissen worden, weil sie sich gewisse Eigenmächtigkeiten geleistet hat, die nicht geduldet wurden. Die genauen Details der Geschichte kenne ich nicht, ich kann nur Bruchstücke davon erzählen: Man hatte ja nach ’49 versucht, deutsche Künstler zurückzuholen und sie in der DDR anzusiedeln. Darunter waren auch Grete und Franz Carl Weiskopf. Sie war vor allem für ihre Kinderbücher bekannt, die sie unter dem Pseudonym Alex Wedding geschrieben hatte, er war auch Schriftsteller und war kurze Zeit tschechoslowakischer Botschafter in Peking gewesen. Nun hatte man meiner Mutter vom Verlag aus gesagt: ”Kümmer‘ dich doch mal ’n bisschen um die beiden, dass die heimisch werden!”, was sie auch getan hat. Sie half beim Organisieren einer Wohnung und solche Dinge. Aber dann muss irgendwas vorgefallen sein, und sie wurde plötzlich wieder vom Verlag zurückgepfiffen. Die Weiskopfs könnten auch gut allein zurechtkommen, hieß es. Und dieses Wechselbad: erst Hilfe zu leisten und sich dann wieder zu verdünnisieren, das war für meine Mutter undenkbar. Sie war diesen Menschen zugetan, hatte ihr Vertrauen erworben und sollte nun auf einmal ohne Erklärung das Weite suchen. Das war ja so ein bisschen das Motto in der DDR: Misstrauen säen. Leute erst miteinander vertraut zu machen und ihnen dann zu sagen: ”Du, man weiß eigentlich gar nicht, wer der andere genau ist …”, um den anderen später wieder unter merkwürdigen Umständen zurückzuholen. Meine Mutter hat diese Tour nicht akzeptiert und das auch im Verlag gesagt. Sie hat damit gedroht, diese Anweisung den Weiskopfs mitzuteilen, woraufhin man ihr gekündigt hat. Was genau aus Sicht der SED gegen die Weiskopfs vorlag, ist mir schleierhaft, vielleicht die Tatsache, dass sie aus einem bourgeoisen jüdischen Elternhaus kamen und in den USA in der Emigration gewesen waren, aber das wusste man ja alles von vornherein.
Glauben Sie, dass Ihre Mutter diese Order des Verlags den Weiskopfs mitgeteilt hat?
Ich würde wetten, dass sie das getan hat. Denn für sie ging es um die Frage: Zu wem gehöre ich? Und das waren immer die Menschen, und nicht die Institutionen. (…)
Was hat Ihre Mutter dann gemacht?
Wie das manchmal so ist, wenn solche Sachen passieren, gab es auch hier einen aufrechten Menschen, der sie aufgefangen hat. Das ist ihr öfter passiert, dass jemand vom Schriftstellerverband oder ein Mitarbeiter eines Verlages anfragte, ob sich die Charlotte im Verband oder im Verlag nicht um die Autorenförderung kümmern möchte. Allerdings flog sie auch dort schnell wieder raus, weil sie unter Druck geraten war, und auch bei ihrem nächsten Job passierte ihr das. Sie war Sekretär, was ja ein bisschen mehr ist als Sekretärin, bei Johannes R. Becher, und auch der wies ihr nach kurzer Zeit die Tür. Es war eigentlich immer dasselbe Spiel: Sie flog raus, weil sie sich weigerte, Menschen preiszugeben. Sie hat nicht akzeptiert, dass ihr die Macht befehlen wollte, wie man sich bestimmten Menschen gegenüber zu verhalten hätte. ”Das war unmenschlich, das konnte ich nicht machen!”, so war ihre Begründung. Sie hat in den 50er Jahren aber nicht nur Ärger gehabt, sondern auch viele schöne Begegnungen mit Autoren, die sich heute zum Teil noch daran erinnern. Volker Braun gehört dazu, der damals vor ihrem Schreibtisch stand und ihr das erste Manuskript hingelegt hat. (…)
Also, sie hat auch inhaltlich mit den Autoren über deren Texte gesprochen …
Ja, sie hat sich nicht nur um Organisatorisches gekümmert, sie hatte ein gutes Gespür für Literatur. Sie las die Texte und merkte schnell, was spannend war, und an welchen Stellen etwas nicht stimmte, wo es langweilig wurde und die Geschichte nicht aufging. Darüber konnte man mit ihr reden.
Wissen Sie Näheres über die Episode mit Johannes R. Becher? Diese Sache fällt ja ’n bisschen aus dem Rahmen, an so einen Job kommt man nicht einfach so, denke ich …
Dazu kann ich leider wenig sagen. Sie hat davon kaum etwas erzählt. (…) Ich weiß nur, dass Becher sie rausschmiss, weil der eine Zeugin brauchte, um jemanden in die Pfanne zu hauen, und diese Zeugin wollte meine Mutter nicht sein. Es ging um eine Äußerung, die jemand auf einer Abendgesellschaft gemacht hatte, bei der meine Mutter mit am Tisch gesessen hatte. Ein paar Tage später sagte Becher: ”Nicht wahr, Charlotte, Du erinnerst Dich doch, dass der das gesagt hat?” Und darauf sagte meine Mutter: ”Nein, ich habe geschlafen.” Das war ’s: ”Danke, pack Deine Sachen!”, bekam sie zu hören und war die Stelle los. Mit dieser Aussage war sie sozusagen von der Fahne gewichen.
Sollte sie etwas bezeugen, was sie gar nicht mitbekommen hatte?
Sie hatte es sehr wohl mitbekommen. Aber sie sagte: ”Ich habe geschlafen”, was so viel hieß wie: ”Mit mir kannst Du nicht rechnen!” Und genau so ist es von Becher auch verstanden worden. (…)
”Eine der sozialistischen Maximen war: ’Man muss auch unfehlbar im Privaten sein!’”
Dieser Eigensinn Ihrer Mutter ist bemerkenswert. Und zwar auch deswegen, weil sie ja grundsätzlich mit der DDR voll einverstanden war und vom Typ her keine Querulantin war …
Nein, sie war keine Querulantin. Aber wir würden das heute schon politisch auslegen wollen, denn es waren ja Direktiven von oben, die dieses verquere Verhalten ausgelöst haben. Meine Mutter hat sich einfach verwahrt gegen solche Zumutungen; sie hat Menschen, die ihr lieb und teuer waren, nicht denunzieren mögen. Das war schon auch politisch! Sie hatte ja die Konsequenzen zu tragen. Sie hat übrigens später, nach der Biermann-Ausbürgerung 1976, gemeinsam mit meinem Vater und Kurt und Jeanne Stern gegen den Ausschluss ihrer Kollegen, also der „Biermann-Fraktion“, aus dem DDR-Schriftstellerverband gestimmt. Diese vier waren damals die einzigen, die dagegen waren – leider vergeblich. Also, sie hat nicht alles unwidersprochen hingenommen. Vor allem an dieser gängigen Methode, anderen zu schaden, um sie hinterher wieder auf die Beine zu holen, wollte sie sich nicht beteiligen. So wie sie mir diese Geschichten aus den 50er Jahren erzählt hat, spielten Disziplinierungsmaßnahmen auch auf der privaten Ebene in dieser Zeit eine große Rolle. Erwachsene Leute sollten noch mal ordentlich im Sinne der Partei erzogen werden. Wenn jemand neben seinem ehelich angetrauten Partner noch ein Verhältnis nebenher hatte, musste der teilweise vor versammelter Parteimannschaft die Hüllen fallen lassen. Der musste dann so eine Selbstbezichtigung wie bei Mao über sich ergehen lassen. Ganz furchtbare Dinge! Ich hab mit meiner Mutter darüber diskutiert und gesagt: ”Wie geht das? Das ist doch eine Privatangelegenheit, wenn jemand eine Geliebte hat! Hat man das nicht getrennt?” Sie hat dann gesagt: ”Nein, damals sollte man gewissermaßen der ganze Mensch sein in der Politik. Man muss sich ganz hingeben können und auch unfehlbar im Privaten sein.”
Wovon bei Johannes R. Becher nicht die Rede sein konnte …
Ohne Zweifel, nein. (…)
Ende der 50er Jahre war Ihre Mutter …
… bei der DSF, der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, beschäftigt. Sie hat da erste vorsichtige Versuche gestartet, über von ihr verehrte Autoren und Autorinnen öffentlich zu sprechen. Der erste dieser russischen Autoren war Daniil Granin, den sie auch betreut hat. Sie schrieb auch erste Texte über Schriftsteller, merkte aber bald, dass sie über ihre Lieblinge wesentlich besser mündlich erzählen konnte als schriftlich, und dass sie damit auch Menschen erfreuen konnte. Als ich Kind war und anfing, die Dinge zu begreifen, fiel mir auf, was sie da von anderen unterschied: Meine Mutter wollte nicht nur ihr Zeug ablassen, sondern die Menschen wirklich erreichen. Sie wollte etwas anrühren in ihnen, was dann die Verbindung herstellte. Sie hat sich also zum Beispiel die Frage gestellt: Wie schafft man es, jemanden wie Daniil Granin (den damals bestimmt noch nicht sehr viele kannten) den Leuten mit seinen Themen und seiner Sprache nahezubringen?
Konnte ihre Mutter Russisch?
Nee, das war ein wunder Punkt. Meine Mutter hatte mal intensiv Russisch gelernt, ich hab noch ihre ganzen Hefte gefunden mit den Vokabeln. Aber sie hat die Sprache zu wenig angewandt, und so war sie irgendwann weg. Sie hat sich, soweit ich mich erinnere, immer dolmetschen lassen, wenn es darauf ankam. Im Fall von Daniil Granin ging es ohnehin, weil seine Frau der deutschen Sprache mächtig war.
”Sie wollte reintauchen in das Leben dieser Künstler, in deren Bildung und Lebensweg.”
Mitte der 60er Jahre hat Ihre Mutter dann angefangen, sich sozusagen professionell mit Ernst Busch zu beschäftigen. Haben Sie eine Vorstellung, wie es dazu gekommen ist?
Zunächst hat sie sich mit Alex Wedding beschäftigt. Nach dem Tod von Franz Carl Weiskopf im Jahr 1955, war Grete Weiskopf, also Alex Wedding, allein, und meine Mutter, die mit beiden sehr gut befreundet gewesen war, hat irrsinnig viel Zeit mit Alex Wedding verbracht. Manchmal ist meine Mutter eine ganze Woche lang bei ihr geblieben. Manchmal fuhren die beiden 14 Tage irgendwohin. Also, ich hab meine Mutter in der Zeit, in der ich zu Hause lebte, relativ selten gesehen. Auch bei Ernst Busch ist meine Mutter dann ein- und ausgegangen, wobei sie bei Busch nicht gewohnt hat, wie sie das bei Alex Wedding zeitweise getan hat.
Hat sich Ihre Mutter mehr für andere Menschen, also für Künstler, interessiert, als für ihre eigene Familie?
Ich weiß nicht, ob es das trifft. Sie hat in den anderen eine unglaubliche Bereicherung auf verschiedenen Ebenen gesehen. Sie wollte reintauchen in das Leben dieser Künstler, in deren Bildung und Lebensweg, in deren Arbeitsweise und Ästhetik. Sie ist immer sehr intensiv auf Menschen zugegangen. Und über Alex Wedding hat sie erstmals so einen Dia-Ton-Vortrag erstellt, wie sie es anschließend auch bei Busch und anderen Künstlern gemacht hat. Die Arbeiten davor waren eher Kurzporträts, aber ihre Beschäftigung mit Alex Wedding war der Beginn dieser auch auf Öffentlichkeit zielenden Auseinandersetzung mit Künstlerbiografien. Für sie bedeutete das, den anderen einen kreativen Menschen in allen Facetten nahebringen. Wobei sie nicht im Sinn hatte, intime Details zu erzählen. Sie ist sehr diskret mit den Dingen umgegangen, die sie von den Leuten wusste, mit denen sie gerade lebte. Also, sie war sehr verschwiegen, was dazu führte, dass ihr viel anvertraut wurde: Sie bekam Tagebücher zu lesen und wurde in alle möglichen Gefühlslagen eingeweiht.
Sie hat diese Dinge nicht weitergegeben, das heißt: sie hat sie in sich behalten …
Ja, und sogar als ich später sagte: ”Erzähl mir davon! Dann hab ich diese Geschichte noch für mich …”. meinte sie: ”Ach, ich weiß nicht, ob ich das machen kann, er hat ’s mir doch anvertraut.” Ich konnte das irgendwo auch verstehen und dachte mir: Dann geht jetzt dieses Wissen eben mit meiner Mutter hinweg. Dann ist es für immer weg, aber das passiert, solange es Menschen gibt. Deswegen sind manche Geschichten sehr fragmentarisch, die ich hier erzähle, weil ich einfach den Bogen nicht kenne.
Erinnern Sie sich noch, ob Busch schon während der ”Alex-Wedding-Phase” bei Ihnen zu Hause ’ne Rolle gespielt hat?
Es gab für sie zeitweise immer nur diesen einen Menschen. Sie war eine ganze Weile sehr fokussiert auf Alex Wedding und deren Leben. Für meine Mutter war der Kontakt mit dieser hochgebildeten Frau wie ’ne Schulung, fast so ’ne Art Privatstudium, das alle Künste miteinbezog. Die beiden gingen zusammen ins Theater, besuchten Ausstellungen. (…) Erst nach dem Tod von Alex Wedding im Jahr 1966 begann für meine Mutter die Ära Ernst Busch. Wie ihr Weg zu Busch geführt hat, kann ich nicht sagen. Sie hat ihn natürlich schon lange gekannt, aber ich denke, das war keine persönliche Bekanntschaft. Sie hat ihn wahrscheinlich erst aus der Ferne bewundert. Und dann gab es auf einmal diese Nähe. In meiner Erinnerung war er eines Tages einfach da und löste Alex Wedding als Objekt des Interesses ab. Ihm hat sie sich dann auch auf eine Art verschrieben, die bis hinging zum Ausschluss aller negativen Seiten. Meine Mutter war ”ihren” Künstlern so zugetan, dass sie Schwächen oder Verfehlungen gern entschuldigte, so nach dem Motto: ”Ja, diese Eigenheit hat er natürlich, aber das ist ja alles nicht so schlimm, weil …” Also, der andere war dann immer der Große, der Vollkommene, wobei sie bei Ernst Busch später auch Abstriche gemacht hat.
”Ich sagte zu meiner Mutter: ’Warum lässt Du Ernst Busch nicht in seiner Zeit groß sein?’”
Wie haben Sie diese ”Busch-Ära” bei Ihrer Mutter erlebt? Liefen dann ständig Busch-Platten zu Hause?
Sie war sehr, sehr häufig bei ihm. Und für meine Ohren war es tatsächlich ein bisschen viel, was meine Mutter zu Hause an Busch-Platten auflegte. Ich war ja dann schon in dem empfindlichen Alter, in dem man sagte: ”Uuh, schon wieder diese Lieder!”
Ging Ihnen die Musik auf die Nerven?
Ja, in der Wiederholung dann schon. Vor allem hatte er diese metallene Stimme, die sehr durchdringend war. Und mir ging die plakative Art, die Texte zu interpretieren, auf den Nerv. Die Lieder strahlten eine Militanz aus, die ich nicht mochte. Dieses Aggressive und Agitprop-mäßige, das war für mich etwas Vergangenes. Meine Mutter hab ich irgendwann mal gekränkt, indem ich gesagt habe: ”Warum lässt Du ihn nicht einfach in seiner Zeit, in der er groß war, groß sein? Warum willst Du ihn dauernd in die Jetzt-Zeit als den Großen zerren?” Ich weiß nicht mehr genau, welche Worte ich damals gebraucht habe. Aber mein Vorwurf war: ”Du führst ihn dauernd als etwas vor, was er gar nicht mehr ist, und was er von seinem ganzen Auftreten her vielleicht gar nicht mehr sein kann und will!” Das war bestimmt schon Ende der 60er Jahre, als ich das formuliert habe. Mir ging zum einen diese extreme Hinwendung zu einer einzigen Person grundsätzlich gegen den Strich. Und dann empfand ich seine Kunst, soweit ich sie erfasst habe, als etwas, das in der Vorzeit stattgefunden hatte. Das war schon beeindruckend: was er alles gespielt und gesungen hat, was er im Spanienkrieg gemacht hat und selbst die Zeit, als er noch bei Brecht auf der Bühne gestanden hat – wenn ich mir all das vorgestellt habe, dann schien er mir authentisch zu sein, aber …
… aber Sie haben ihn eigentlich als ’ne Art Museumsstück empfunden?
Ja.
Und Sie haben gespürt, dass sich Ihre Mutter über Gebühr mit ihm auseinandersetzt …
Fast hatte ich den Eindruck, dass sie, aber das ist jetzt meine heutige Interpretation, etwas Unmögliches versucht. Denn in dem Augenblick, wo man jemanden aus seiner Zeit herausreißt und ihn noch mal vorführt, und er natürlich den Glanz von damals nicht mehr hat, wirkt er auf einmal nicht mehr – oder er wirkt wie ein älterer, schrulliger, grantiger Mann, und das fand ich eigentlich furchtbar. Denn das ließ sich ja nicht zur Deckung bringen: das Bild von früher und der Mensch in der Gegenwart – wie sollte das gehen? Mein Gefühl war, dass er seine Zeit gehabt hatte und nun zu denen gehörte, die man eigentlich in Ruhe lassen sollte. Für mich war er jemand, der so ’ne fossile Haltung hatte. Er hatte sich auch schon zurückgezogen. Für mich stand er nicht im Vordergrund der DDR-Gesellschaft, er war irgendwo versunken. Und nur ab und an haben ihn die Obersten mal kurz rausgeholt und ”Rotfront” sagen lassen. Und für mich war erstaunlich, dass er trotz seines energischen Charakters letztendlich genau das machte, was die Partei von ihm wollte. Ich erinnere mich noch an diese Biermann-Geschichte, wo er auf einmal ganz vorne in der Zeitung erschien und die Ausbürgerung guthieß. Ich dachte nur: ”Herrgott, noch mal! Das hat er doch gar nicht nötig!” So wie es in meinen Augen übrigens auch die Anna Seghers nie nötig hatte, sich derart ans System zu schmiegen …
Sie hatten beide schon diesen sozialistischen Glorienschein …
Genau, deswegen hab ich mich gefragt: Warum machen die das?
”Er war so seltsam vierschrötig und ein bisschen grob.”
Haben Sie mit Ihrer Mutter mal drüber gesprochen?
Ja, sie war sich in der letzten Zeit ihres Lebens dieser Probleme sehr wohl bewusst. Wir konnten gut miteinander über solche Sachen reden.
Hat sie Ihnen jemals erklärt, was für sie die Faszination von Busch ausgemacht hat?
Ich glaube, das war sein konsequentes kämpferisches Leben. Das war sein konsequentes Leben vielleicht bis zu einem bestimmten Punkt, den ich jetzt nicht genau bestimmen kann, an dem er sich zurückgezogen hat und eher im Privaten den Mund aufgemacht hat. Aber ansonsten war sein Leben gekennzeichnet durch großen Einsatz für seine Sache, wofür er sich auch in Lebensgefahr begeben hatte. Und meine Mutter sah in ihm einen sehr guten Künstler, fand ihn auch eine faszinierende Persönlichkeit. Das hat sich mir als Kind bei den wenigen Malen, die ich mit meiner Mutter zusammen bei Busch war, nicht unbedingt erschlossen. Sie wollte mich öfter zu ihm nach Hause mitnehmen, aber mich hat das nicht besonders interessiert. Er war so seltsam vierschrötig und ein bisschen grob. Er begrüßte einen schon mit so ’nem Kommandoton, wenn man bei ihm in der Tür stand. Das fand ich nicht so angenehm. Also, er hat mich immer aufgerufen wie eine Schülerin, die ich ja auch war, aber ich wollte eben nicht abgefragt werden: ”Na, was macht die Weltanschauung? Wie geht ’s in der FDJ?” Ich bin gar nicht mal sicher, ob ’s ihn wirklich interessiert hat. Er hat einfach was gefragt, damit so was wie ein Gespräch entsteht. Ich fand die wenigen Male, wo wir mit jungen Leuten dort waren, recht kompliziert. Diese Plaudereien waren ziemlich verkrampft. Manchmal machte er makabre Späße über den Friedhof hinter seinem Haus. Dazu lächelte er merkwürdig einseitig wegen seiner gelähmten Backe, was ein wenig an den Holländer-Michel aus dem ”Kalten Herz” erinnerte. Haben Sie ihn eigentlich mal kennengelernt?
Nee, ich hab ihn nicht kennengelernt. Aber ich kenne die Fotos, auf denen Ihre Mutter zusammen mit Kindern im Hause Busch zu sehen ist. In einer Art Selbst-Interview aus dem Jahr 1994 äußert sie, dass sie Busch einmal im Jahr, zu seinem Geburtstag, mit zehn Kindern besucht hat. Waren Sie da auch mal dabei?
Ja, da war ich auch mal mit. Es war grauenhaft: Kinder wurden jemandem vorgeführt, der nicht wirklich einen Draht zu Kindern hatte. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass er nicht mal zu seinem eigenen Sohn einen Draht hatte. Da war eben so eine grobe Freundlichkeit, mit der er auch mal einen kleinen Buben wie den Uli in die Luft schmiss, dann machte es ”Hoppla!”, und danach war der Junge wieder abgemeldet für den Tag. Ich glaube, dass die Irene sehr gesorgt hat für das Kind.
”Das Ganze musste politisch korrekt sein und das erfüllen, was man in der Öffentlichkeit als Vortrag loslassen durfte.”
Können Sie das näher beschreiben, dieses Gefühl, wenn man dort als Kind ’nen Nachmittag verbracht hat?
Naja, wenn ich mit meiner Mutter allein zu Besuch kam, wollten die beiden meist miteinander reden. Ich war sozusagen das angehängte Kind, das nebenbei beschäftigt werden musste. Ich hatte entweder selbst ein Buch mit, oder er gab mir eins oder was zu Malen. Ich saß dann an der Seite dabei und hab diese merkwürdige Stimmung aufgefangen. Es war eine sehr interessante Energie zwischen den beiden, weil meine Mutter alles mögliche von ihm erfahren, wissen und aufschreiben wollte. Und ihn immer auch nach persönlichen Dingen gefragt hat, um gleich hinzuzufügen, dass sie das auf keinen Fall benutzen würde. Aber sie wollte eben eine Haltung spüren, wollte wissen, was es ihm wert war, mit ihr über sein Leben zu sprechen. Das war ihr wichtig, um jemanden zu erfassen.
Haben diese Gespräche alle zur Vorbereitung ihres Dia-Ton-Vortrags gedient?
Ja, jedenfalls am Anfang.
Auffällig ist, dass im Erläuterungsheft, das Ihre Mutter ausgearbeitet hat, wörtliche Zitate von Busch ziemlich sparsam eingesetzt sind. Sie hat viel Material aus der Literatur verwendet. Ich will sagen: Wenn man ein Jahr fast jeden Tag zu Busch geht und mit ihm spricht, dann hat man ja wahrscheinlich einen Riesenberg Zitate und Geschichten, aber damit ist sie kaum rausgerückt …
Das war einerseits ihre Art, andrerseits hat sie bei ihren vielen Vorträgen, die sie gemacht hat, immer darauf geachtet, etwas abzuliefern, das von den offiziellen Stellen abgesegnet werden konnte. Sie hat das vorgezeigt und konnte sagen: ”Das ist das Thema, und da steht hier Schwarz auf Weiß.” Das Ganze musste sozusagen politisch korrekt sein und das erfüllen, was man in der Öffentlichkeit als Vortrag loslassen durfte. Es konnte ja nicht jeder in der DDR einfach ’nen Vortrag halten, schon gar nicht vor jugendlichem Publikum. Die Schriftform war also wichtig, damit die Sache überhaupt über die Bühne gehen konnte. Etwas anderes war dann aber das Gespräch mit den Leuten, das bei den Veranstaltungen meiner Mutter eine große Rolle spielte. Da ging es darum, mit all dem Wissen, das sie nebenher noch über den Künstler hatte, mündlich umzugehen. Denn das Publikum kam zunehmend in ihre Vortragsabende, um hinterher das Gespräch zu suchen. Sie hat in diese Geschichten immer etwas hineinverpackt, das den Leuten im besten Fall etwas über sie selbst erschlossen hat. Sie sagte zum Beispiel: ”Sie sehen ja an Ernst Busch, dass man nicht immer alles mitmachen muss, man kann es auch auf andere Art versuchen und sich auch mal verweigern …” Diese Bemerkungen haben die Leute sehr gemocht. Aber Sie haben völlig recht: Wenn man die kleinen Texthefte sieht, dann wundert man sich, wo die ganzen Geschichten geblieben sind, die sie gesammelt hat.
Hat Ihre Mutter O-Töne im Dia-Ton-Vortrag benutzt, die Sie selbst bei Busch aufgenommen hatte, oder waren das Aufnahmen, die Busch ihr gegeben hatte?
Beides.
Was, glauben Sie, hat Ihre Mutter für ’ne Funktion für Busch gehabt?
Da war endlich mal jemand, der ihn erfasst hat, der ihn verstanden hat. Das hatte vielleicht auch mit ihrer proletarischen Herkunft zu tun. Da war ein Einfühlungsvermögen, wie es Busch zum Beispiel von seiner Frau Irene nicht kannte, was er manchmal auch deutlich äußerte. Irene kam ja aus einem ganz anderen Kreis und winkte dann schon mal ab, wenn Busch wieder mit einer seiner Geschichten ankam: ”Das hast Du mir schon mal erzählt!” Meine Mutter hörte einfach zu und war sehr interessiert. Sie hatte auch Ahnung und konnte hier und da ergänzen, wenn er erzählte. Und es gab noch eine Gemeinsamkeit der beiden: diese Fähigkeit, sich, wie es früher immer hieß, einer Sache bedingungslos verschreiben zu können. Das war im Grunde der Antrieb: die unintellektuelle Leidenschaft, mit der man vor langer Zeit in diesen Kommunismus hineingesprungen war.
In welchem Sinne kam Irene aus einem anderen Kreis? Meinen Sie, dass sie bürgerlicher Herkunft war?
Das weiß ich nicht. Sie erschien mir jedenfalls wie eine leichte, fröhliche Blume, wenn ich da war – eine schöne Frau, die aber immer wieder ausbüchste, wenn das Gespräch anfing und er sagte: ”Komm, Irene, setz Dich!” Sie hat dann gesagt: ”Nein, nein, ich hab noch in der Küche zu tun.” Mir ist auch aufgefallen, dass Irene manchmal zu meiner Mutter gesagt hat: ”Ach, das ist schön, Frau Wasser, kommen Sie doch!” Es war vielleicht auch Freude darüber, jemanden zu haben, der da etwas ausgleichen konnte, was bei ihnen zu Hause fehlte, was sie, vielleicht auch zeitlich, nicht leisten konnte. (…)
”Beim Vortrag hat sie immer wieder ”Stop” gedrückt und ein paar Geschichten erzählt.”
Ab 1966 taucht der Name ”Charlotte Wasser“ hin und wieder in der DDR-Presse auf. Man kann nachlesen, dass sie ihre Dia-Ton-Vorträge über Ernst Busch vor verschiedenen Auditorien in Ost-Berlin gehalten hat, zum Beispiel bei Jugendstunden für die Teilnehmer der Jugendweihe. Wie hat Ihre Mutter eigentlich die technische Seite bewerkstelligt? Wie kam sie mit ihren Apparaturen zu den Interessenten?
Meine Mutter war ja mobil mit ihren Dia-Ton-Vorträgen, wobei sie, verglichen mit dem heutigen Equipment, ziemlich unhandliche Geräte mit sich herumschleppte: ein Smaragd-Tonbandgerät mit riesigen Spulen drauf und eine große eingerollte Leinwand, an deren Stange der Diaprojektor unten dranhing. Damit rannte sie durch die Gegend. Ihr Unterwegssein wurde ihr später etwas erleichtert, man hat sie dann mit einem Auto abgeholt und zu den jeweiligen Örtlichkeiten gefahren, nachdem sie sich jahrelang krumm geschleppt hatte.
Wie lief so ein Dia-Ton-Vortrag ab?
Man kann das heute noch ganz gut nachempfinden, wenn man möchte: Ich habe ihre ganzen Utensilien zum Archiv der Akademie der Künste gebracht, wo die Sachen aufgehoben werden. Der Dia-Ton-Vortrag selbst war, wie das Wort schon andeutet, aus verschiedenen technischen Einheiten zusammengesetzt, lief aber in einem ab. Das heißt, sie hatte das Ganze exakt ausgearbeitet, es gab ein kleines Materialienheft dazu, in dem man den Tonband-Text mitlesen konnte, der zu den Bildern ablief. Die Bilder waren von eins bis 150 durchnumeriert, es war also eigentlich eine fertige Arbeit, und es hätte auch ein anderer auf den Knopf drücken und den Dia-Vortrag inklusive Ton starten können. Es kam aber bei ihr dazu, dass sie sehr oft auf ”Stop” drückte und ein paar Geschichten dazu erzählte. Ich glaube, das machte erst den Reiz dieser Vorträge aus. Vielleicht war das auch der Grund dafür, dass sie mit dieser Arbeit über so lange Zeit gefragt war. Sie hat ja auch nach ’89 immer wieder über Kultur gesprochen, hat von persönlichen Bekanntschaften berichtet. Sie war dabei relativ offen, das hat vielen Leuten gefallen.
In dem Artikel von 1994, den ich vorhin schon erwähnt habe, schreibt Ihre Mutter, sie sei über ein Jahrzehnt lang fast täglich bei Busch zu Hause gewesen, was ich unglaublich finde. Sie muss also, auch als der Vortrag längst fertiggestellt war, ständig dorthin gepilgert sein. Sie hat in der Zeit wohl den Vortrag mehrmals überarbeitet, war aber auch darüber hinaus an Busch und seiner Familie interessiert. Sie haben schon angedeutet, dass Sie als Jugendliche wenig Verständnis dafür hatten, dass sich Ihre Mutter so reinkniet in diese Busch-Leidenschaft. Wie hat sich das geäußert? Haben Sie versucht, zu Hause mit Ihren eigenen musikalischen Vorlieben dagegenzuhalten?
Meine Mutter und ich waren Wand an Wand bei uns zu Hause. Wenn der Busch dann in voller Lautstärke losschmetterte, es war ja noch nicht die Zeit der Kopfhörer, ging mir das durch Mark und Bein. Wenn ich mich darüber beschwert habe, hat sie mir erklärt, dass sie sich über die Musik in eine Atmosphäre hineinversetzen kann, in der sie gut arbeiten kann. Sie hat zeitgleich dagesessen und sich Notizen gemacht, machmal auch mit der Maschine geschrieben, um ihre Vorträge weiter auszubauen.
Konnte das lange andauern?
Oh ja, das konnte lange andauern! Es gab glücklicherweise noch keine Wiederholtaste, sodass sie immer wieder aufstehen musste, um die Platte neu zu starten oder das Tonband zurückzuspulen. Sie hat in der Zeit immer unglaublich viel zu Papier gebracht, wobei letztendlich, wie Sie richtig sagen, eine dünne Broschüre rausgekommen ist. Aber das, was sie geschrieben hat für ein einziges Thema, war erst mal ein Riesenkonvolut von Texten. Sie hat wie wahnsinnig gesammelt, um, so stelle ich mir das heute vor, beim Vortrag viel erzählen zu können. (…)
Beim Vortrag: ”Ich weiß, ich weiß! Der Busch hat doch auch ’Max und Moritz’ geschrieben!”
Die Vorträge waren von da an die Hauptbeschäftigung Ihrer Mutter. Sie hat sich damit sozusagen selbstständig gemacht und ist keine weiteren Arbeitsverhältnisse eingegangen …
Ja, sie hat diese Beschäftigung allmählich ausgebaut. Unser Leben war ja finanziell gesehen kein reiches, sondern wir haben immer so ein bisschen von einem Tag zum nächsten Tag gelebt. Und ich kann nur sagen: Zum Glück war die Faszination, die meine Mutter mit ihren Vorträgen und Gesprächen beim Publikum erreichte, so groß, dass sie immer weiterempfohlen wurde. Irgendeiner saß meistens im Zuschauerraum, der hinterher sagte: ”Dürfte ich Sie denn bitten, so einen Vortrag auch bei uns zu machen?”
Also, damit konnte man Geld verdienen …
So würde ich es nicht sagen. Man konnte leben. Ich hab später die Kontoauszüge gesehen und mir gedacht: ”Oh Gott, ist das rührend!” Also, sie hat für einen Vortrag 20 Mark bekommen. (…)
Irgendwo hab ich einen Brief von Irene Busch gefunden, in dem es heißt, dass Charlotte Wasser sich quasi ’ne goldene Nase mit diesen Vorträgen verdienen würde …
(lacht)
… das scheint also nicht der Fall gewesen zu sein …
… nicht wirklich, nein.
Aber die Busch-Vorträge waren schon ein Standbein.
Ja, sie haben meiner Mutter ermöglicht, freiberuflich zu arbeiten. Und für jemanden, der in der DDR lebte, war das ein Traum! Die Busch-Vorträge liefen tatsächlich am besten, aber meine Mutter hat danach eine ganze Reihe anderer Dia-Ton-Vorträge konzipiert: über Bildende Kunst allgemein, über Picasso, über Chagall und auch einen über Kunst im Dritten Reich, der ebenfalls sehr gut lief. Zuletzt saß sie an einem Vortrag über Modigliani, der, glaube ich, nicht mehr ganz fertig geworden ist. (…)
Gab es dann immer Probevorführungen zu Hause? Waren Sie und Ihr Vater das Testpublikum, bevor Ihre Mutter mit ihrem neuen Thema nach draußen ging?
Genau so war es (lacht). Dann hieß es: ”So, Kinder, könnt Ihr mal kurz gucken kommen? Das neue Kapitel ist fertig!” Dann mussten wir wieder ran. Mein Vater hat auch manchmal mitgeholfen bei der Vorbereitung und hat historische Hintergründe recherchiert.
Wie hat Ihre Mutter eigentlich reagiert, als Sie damals Kritik geübt haben an ihrer Busch-Leidenschaft?
Grundsätzlich hatte ich Verständnis für das, was sie machte. Das fand ich sogar toll. Aber einmal habe ich ihr, wie gesagt, relativ deutlich erklärt, was mich an dieser Beschäftigung mit Ernst Busch stört. Und da hat sie gesagt: ”Er ist jetzt noch da, er lebt noch. Deswegen muss man ihn jetzt befragen und ihm jetzt zuhören!” Das habe ich dann auch wieder verstanden. Wenn er eines Tages nicht mehr lebt, ist man froh über diese Dokumente. Meine Mutter durfte ja auch seine Lieder mitschneiden und hat diese Aufnahmen ohne Lizenzgebühren bekommen. Das war sehr wichtig für sie, denn die hätte sie nicht bezahlen können.
Hat sie auch Interviews mit Busch geführt, die sie auf Band aufgenommen hat?
Das hat sie auch gemacht, aber leider weiß ich nicht, wo diese riesigen Spulen hingekommen sind. Das Schlimme ist, dass meine Mutter die Dinge nie archivarisch verwahrt hat. Ihre Materialien lagen am Ende kreuz und quer in Umzugskisten. Die Bänder sind mittlerweile im Akademiearchiv, aber ich vermute, dass derjenige, der sie sich anhört, die Krise kriegt, denn da ist nichts geordnet oder beschriftet. (…)
Waren Sie mal bei einem der Busch-Vorträge Ihrer Mutter dabei? Zum Beispiel bei einer ihrer Jugendstunden zur Vorbereitung auf die Jugendweihe?
Ja, sie hat mich ein paar Mal mitgenommen.
Was war das für eine Atmosphäre? Hatten Sie das Gefühl, dass die Jugendlichen Interesse hatten an Busch?
Nicht wirklich. Die haben das über sich ergehen lassen. Meine Mutter hatte manchmal putzige Erlebnisse, wenn sie mit Busch unterwegs war. Da meldete sich dann jemand und rief: ”Ich weiß, ich weiß! Der hat doch auch ’Max und Moritz’ geschrieben!” Das kam häufiger vor. Als meine Mutter mir das erzählte, dachte ich: Meine Mutter macht einen Spaß. Bis ich es selber ’n paarmal erlebt habe. Sie hat dann sehr freundlich regiert und hat gesagt: ’Nee, das war jemand anderes, das war der Wilhelm Busch …”
Das hat sie wahrscheinlich in ihrem Bemühen bestätigt, ihn der Vergessenheit entreißen zu müssen …
Genau das! Es gibt noch eine andere Anekdote, die meine Mutter mit Busch selbst erlebt hat, die ich ganz typisch für ihn finde: Meine Mutter war ein zu spät kommender Mensch. Sie steckte immer in irgendeinem unglaublichen Gewusel und kam einfach ständig zu spät. Einmal war sie mit Busch verabredet und klingelte wieder ’ne Viertelstunde oder 20 Minuten später als vereinbart. Busch riss die Tür auf und sagte: ”Liebe Frau Wasser, wenn ich mit Ihnen im Untergrundkampf gewesen wäre, wäre ich jetzt schon tot!” Das hat er nicht im Scherz gesagt. Er war wütend über diese Unachtsamkeit oder Unaufmerksamkeit: dass man nicht spürte, was das eigentlich bedeutet, dass da einer wartet. Und meine Mutter hat eine Weile gebraucht, um ihn wieder einigermaßen milde zu stimmen, er war zunächst sehr reserviert. Meine Mutter kam an diesem Tag wirklich erschrocken zurück nach Hause. (…) Es gab auch mal eine echte Verstimmung zwischen den beiden, die eine Weile anhielt, aber ich weiß die Hintergründe nicht mehr. Busch hatte meiner Mutter irgendetwas übelgenommen, beruhigte sich aber schließlich wieder. In seinen letzten Lebensjahren kehrte sich dann das Verhältnis ein bisschen um. Dann war er es, der ständig bei meiner Mutter anrief. Da wurde es dünner um ihn, und das spürte er. Auch meine Mutter hatte begonnen, sich vorsichtig zu distanzieren, vielleicht konnte sie über seine schroffe Art doch nicht immer hinwegsehen. Sie hat mir erzählt, dass sie mit Busch einmal einen seltsamen Disput über Mitleid hatte, wobei Busch erklärt habe, sowas gebe es bei ihm nicht. Das fand meine Mutter unmöglich. Aber ich glaube, dass sie ihm trotzdem auf ihre Art bis zuletzt die Treue gehalten hat.
Interview: Jochen Voit
Foto: Jochen Voit
(Textfassung autorisiert von Margrit Manz am 20. 10. 2008)

Liesel Markowski
über die Aufbruchstimmung in der jungen DDR und die Gemeinschaft stiftende Rolle der Musik von Hanns Eisler und Ernst Busch
„'Kuhle Wampe' und das 'Solidaritätslied' - die wurden in der DDR erst wieder lebendig gemacht ...“
(Gespräch am 9. Februar 2006 in Berlin)
Liesel Markowski (geborene Carow) ist Jahrgang 1928. Sie wächst in Rostock auf, wo sie das Lyzeum besucht und bis zu ihrem 22. Lebensjahr wohnt. Die Mutter ist gelernte Schneiderin und macht ihre Tochter frühzeitig mit den Grundlagen ihres Handwerks vertraut. Der Vater, der als Flieger am Ersten Weltkrieg teilgenommen hat, ist promovierter Ökonom und mittelständischer Unternehmer: In seinem Betrieb werden Reinigungsmittel und Wachse hergestellt. 1940 wird er zur Wehrmacht eingezogen; er wird bei einem Bombenangriff 1945 in Riga verletzt und stirbt an den Folgen dieser Verletzung in einem Lazarett in Schwerin. Seine Tochter, die in den letzten Kriegsjahren zusammen mit ihrer Mutter im Sommerhaus der Familie bei Warnemünde gelebt hat, macht 1947 ihr Abitur in Rostock und anschließend eine Lehre als Damenschneiderin. Eigentlich will sie Chemie studieren, wird aber wegen ihrer bürgerlichen Herkunft zunächst nicht zum Studium zugelassen. Neben der Ausbildung singt sie im Bach-Chor und nimmt Gesangsunterricht. Nach der Lehre geht sie an die neu gegründete Deutsche Hochschule für Musik (später: „Hanns Eisler“) in Berlin und studiert Gesang, wechselt später zur Musikwissenschaft und macht 1959 ihr Examen an der Humboldt-Universität. Im selben Jahr wird Liesel Markowski Redakteurin bei der Fachzeitschrift Musik und Gesellschaft. Sie bleibt dem Blatt 30 Jahre lang verbunden, von 1973 bis 1990 ist sie Chefredakteurin. Seit 1955 ist sie verheiratet mit Paul Markowski, mit dem sie eine Tochter hat. Durch ihren Mann, der aus einer Arbeiterfamilie mit kommunistischer Tradition stammt, wird Liesel Markowski nachhaltig politisch geprägt. Paul Markowski ist zunächst als Dolmetscher bei Veranstaltungen der FDJ tätig, übernimmt dann in der SED im Bereich Außenpolitik verschiedene Posten und ist ab 1971 Mitglied des ZK der SED. Er kommt 1978 bei einem Hubschrauberabsturz in Libyen (zusammen mit Werner Lamberz) unter bis heute nicht geklärten Umständen ums Leben. In den 80er Jahren lässt sich Liesel Markowski für einige Zeit von der Redaktionsarbeit freistellen, um an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED bei Günter Mayer (Humboldt-Universität) zu promovieren. Das Thema lautet: „Massenmedien und Musik in der kompositorischen Praxis und im theoretischen Denken Hanns Eislers.“ Bis heute arbeitet Liesel Markowski als Musikwissenschaftlerin und –journalistin. Sie schreibt Kritiken für die Tageszeitung Neues Deutschland und engagiert sich in der PDS. Sie lebt in Berlin.
JV: Ihre Schulausbildung fiel zu großen Teilen in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Können Sie bitte zunächst ein wenig von dieser Zeit erzählen?
Dr. Liesel Markowski: Wir hatten ein Häuschen an der Ostsee in Markgrafenheide, da wohnten wir ab 1943 wegen der Fliegerangriffe. Und ich bin jeden Tag von Markgrafenheide nach Rostock zweieinhalb Stunden zur Schule gefahren. Morgens um halb, dreiviertel sechs bin ich aus dem Haus, um dann um acht in der Schule zu sein! Erst zu Fuß, dann stieg ich in die Strandbahn, dann ging es weiter mit der Fähre und dann mit dem Zug. Winter und Sommer. (…)
Wie waren Ihre Eltern politisch eingestellt?
Mein Vater muss kurze Zeit ein Nazi gewesen sein. Und meine Mutter hat gesagt, dass er zur Zeit der Röhm-Affäre, das war 1934, Schluss gemacht hat. Als sie Ernst Röhm umgebracht haben, hat es ihm gereicht. (…) Er hat sich von den Nazis total getrennt, da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn ich mich nur an die wenigen Male erinnere, wo er auf Urlaub zu uns kam. Mein Vater war 1940 eingezogen worden. Er ist dann Major gewesen und hat ein Luftwaffen-Baubataillon in der Nazi-Armee geleitet, und 1945 ist er zu Tode gekommen. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit gehabt, jemals in einem fortgeschrittenen Alter mit dem Vater zu diskutieren. Ich war zwölf Jahre alt, als er in den Krieg musste … Ich erinnere mich zum Beispiel noch an einen seiner Urlaubstage in Markgrafenheide: Da haben wir abends die Fensterläden geschlossen, wir mussten ja verdunkeln, und ich sollte ums Haus gehen, er war sehr vorsichtig, und gucken, ob jemand draußen war und lauschte. Und dann hat er Radio London gehört. Ein anderes Mal hat er meiner Mutter erzählt, ich hab das heimlich mitgehört, dass die SS in Riga Säuglinge hochgeworfen und mit dem Bajonett aufgefangen hat. Ich erinnere mich noch, dass er das gesagt hat. Also, er war sich völlig im Klaren darüber, was die Nazi-Armee und die SS anrichteten. Zeitweilig war er auch im Mecklenburgischen stationiert und hatte sowjetische Gefangene. Und ich weiß noch, dass er gesagt hat: „Bei mir kriegen die was zu essen, ich lass mir da nichts vorschreiben!“ (…)
Ab wann und wodurch haben Sie so etwas wie ein politisches Bewusstsein entwickelt?
Das geschah durch Paul, meinen Mann. Er stammte aus Magdeburg, war ein Jahr jünger als ich und hatte schon vor der Abiturprüfung seinen Dolmetscher in Englisch gemacht. Er sprach fließend Englisch und Französisch – später kam sogar noch Spanisch dazu … Wir hatten uns 1948 bei einem Maskenfest in Rostock kennen gelernt, wo er an der Universität studierte. Sein Vater war Kaschube wie Günter Grass, stammte aus Danzig, war bei den roten Matrosen in Kiel gewesen und hatte an der Revolution 1918 in Berlin teilgenommen. (…)
(Exkurs über Liesel Markowskis Schwiegervater und dessen Beteiligung an der Revolution 1917/18)
„Es gab wildeste Diskussionen!“ – Politisierung als Studentin
Ihr Mann war also durch sein Elternhaus vorgeprägt und links eingestellt …
Ja, sicher, der Vater war ja Kommunist und in der Kommunistischen Partei. Es war aber trotzdem nicht so einfach, mein Mann ist erst relativ spät in die SED eingetreten und nicht direkt in die KP. Er hat sich zuerst auf die Sprache gestürzt, er konnte dann fließend Russisch und unterrichtete auch bald. Ich hatte in der Schule auch Russisch, wobei sie uns leider nach zwei Jahren Französisch gestrichen haben. (…) In Russisch waren wir praktisch ABC-Schützen, und wir haben versucht, das zu lernen so gut es ging. Ich kam sogar in die mündliche Prüfung im Abitur, das war 1947, und keiner konnte Russisch außer der Prüferin und mir … Das war sehr lustig. Ich musste dann entsprechend dem Stadium, in dem wir uns in der Sprache befanden, Wörter aufsagen. Ich weiß noch, dass es um Fleischsorten ging. Ich zählte auf: „swinina“, das heißt Schweinefleisch, „teljatina“, Kalbfleisch, und dann sagte ich „skarlatina“, und sie fing an zu lachen, das heißt nämlich Scharlach. Also, ich war noch im Anfangsstadium, mein Mann war da viel weiter. Aber weil Sie nach der politischen Einstellung fragen: Natürlich bin ich durch ihn, aber auch durch Gespräche an der Hochschule und der Universität mit anderen Studenten politisiert worden. Aber es war keineswegs alles klar, es gab wildeste Diskussionen. Wildeste Diskussionen. Und was mich am meisten überzeugt hat, waren der historische Materialismus und das „Kommunistische Manifest“. Und natürlich „Was tun“ von Tschernitschewski, es war das erste Buch, was mich politisch beeindruckt hat. Tschernitschewski war einer der revolutionären Demokraten Russlands aus dem 19. Jahrhundert. (…) Es ging also nicht so vor sich, dass ich gesagt habe: „So, jetzt machen wir das.“ Im Gegenteil, ich habe gesagt: „In die FDJ trete ich nicht ein! Wenn ich sehe, dass ihr mit den gleichen Fanfaren ankommt wie die Nazis, dann will ich das nicht.“ (…)
„Ich hab immer alles mitgesungen“ – Musikalische Prägungen
Was für musikalische Vorlieben hatten Sie damals, also in der Zeit, als Sie Abiturientin waren?
Ich wollte eigentlich Klavierunterricht nehmen, das Klavier war sogar schon gekauft. Aber das ist nichts geworden, weil noch Krieg war, und das Klavier zerbombt worden ist … Ich hab zeitweise Akkordeon gespielt, war aber nicht besonders talentiert. Natürlich haben wir viel gesungen, alle möglichen Volkslieder und auch Schlager.
Welche Interpreten mochten Sie gerne? Hans Albers?
Hans Albers war ein großartiger Filmschauspieler, und „Große Freiheit Nr.7“ ein toller Film. Und, klar, „La Paloma“ mochte ich auch. Für Ilse Werner hab ich auch geschwärmt … Ich kannte auch alle möglichen Operetten-Schlager aus dem Radio. „Schlösser, die im Monde liegen“ und so ein Lehár-Zeug, „Machen wir ’s den Schwalben nach“ und ich weiß nicht was. Ich hab immer alles mitgesungen. Nach 1945 war ich dann im Rostocker Bach-Chor. Ein wirkliches Schlüsselerlebnis dort waren die Aufführungen der „Matthäus-Passion“ und der „Hohe Messe“ in der Marienkirche – das war schon ein Qualitätssprung. Aber es hat meine Stimme sehr angestrengt. Ich habe dann Gesangstunden genommen. Außerdem wurde auch bei uns in der Schule immer gesungen, wir haben zu dieser Zeit sehr schöne Volkslieder und auch Choräle kennen gelernt.
„So, jetzt reicht ’s mir!“ – Ausbildung zur Damenschneiderin
Waren Sie sich direkt nach dem Abitur schon im Klaren, dass es beruflich in Richtung Musik gehen sollte?
Nein, zunächst habe ich mich für andere Fächer an der Rostocker Universität beworben: Chemie oder Jura, ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls bin ich dreimal nicht zugelassen worden, was nicht an der Qualität meines Abiturs lag, sondern daran, dass mein Vater Unternehmer gewesen war. Und meine Mutter war ja gelernte Schneiderin, sie hat immer für uns genäht und hat mir auch einiges beigebracht. Also habe ich in der Zeit, wo ich auf die nächste Zulassung wartete, die ich wieder nicht kriegte, in der Schneiderei gearbeitet. Ich wechselte die Werkstatt. Nach der dritten Ablehnung habe ich gesagt: „So, jetzt reicht ’s mir! Ich erwarte, dass Sie mir diese Zeit anerkennen, ich will jetzt die Gesellenprüfung als Damenschneiderin machen.“ Schließlich durfte ich als Umschülerin in anderthalb Jahren die Prüfung machen; zusammen mit einer Klassenkameradin war ich bei einer Meisterin, die gleich ihre Gesellin entließ, weil wir ja für ein Taschengeld gearbeitet haben. Wir konnten ja schon viel, wir waren gute Kräfte. Dann habe ich die Gesellenprüfung gemacht und war Damenschneiderin, ich kann Ihnen meinen Gesellenbrief zeigen. In der DDR hieß das übrigens dann Facharbeiterbrief.
„Der Kleinste, der Ärmste und der Beste“ – Paul Markowski
Haben Sie dann einen neuen Anlauf genommen, um zum Studium zugelassen zu werden?
Nein, nicht sofort. Mittlerweile kannte ich ja meinen Mann schon. Der wurde, weil er so gut in Fremdsprachen war, von der Universität weggeholt und beim Deutschlandtreffen 1950 in Berlin als Französisch-Dolmetscher eingesetzt. Freunde, die meinen Mann vom Studium der Anglistik und Romanistik her kannten, haben gesagt: „Er war der Kleinste, der Ärmste und der Beste.“ Jedenfalls kam er so zur politischen Arbeit, war dann auch in der FDJ aktiv. Später ist er dann auch in die SED eingetreten. Also, er war in Berlin und ich in Rostock. Da hat er gesagt: „Komm nach Berlin, hier ist was los und hier kannst Du studieren.“ Er wusste ja, dass ich mich mit Gesang beschäftigte und er hatte gerade einen Vortrag von Professor Georg Knepler, dem Rektor der neu entstehenden Musikhochschule, gehört. Ich bemühte mich dann um Aufnahme für Gesang, und es hat geklappt. Ich weiß noch, ich kam mit der G-Moll-Arie der Pamina aus der „Zauberflöte“ zur Prüfung. Und einige Rostocker Studenten, die sich da auch bewarben, sangen die Songs aus der „Dreigroschenoper“ von Brecht / Weill. Ich war ganz eingeschüchtert, als die sagten: „Das ist jetzt das Neue!“, und dachte: „Mensch, da kann ich ja überhaupt nicht mithalten“.
Warum waren Sie eingeschüchtert?
Mein Mozart war doch bei denen gar nicht gefragt. Und die sangen den „Kanonensong“ von der Seeräuber-Jenny, so was hatte ich noch nie gehört.
„Ich bin eher ein theoretischer Typ“ – Vom Gesang zur Musikwissenschaft
Konnten Sie mit dieser Musik etwas anfangen?
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, sie gefiel mir nicht besonders. Aber wie sollte das auch anders sein? So aus dem blauen Dunst heraus kann man ja keinen Zugang finden. Aber eigentlich ist es dann für mich ganz gut gelaufen: Ich hab 1950 angefangen mit dem Gesangsstudium, das mir großen Spaß machte. Dann haben sie leider erst nach Jahren festgestellt, dass meine Stimme nicht ausreicht. Ich bin dann zur Theorie gewechselt, zur Musikwissenschaft, und habe das Examen an der Humboldt-Universität mit Eins gemacht. (…) Sängerin wär wahrscheinlich auch nichts für mich gewesen. Ich bin eher ein theoretischer Typ.
Was war für Sie das Spannende an der Musikwissenschaft?
Ich hatte damals schon Interesse an musikhistorischen Zusammenhängen, das war durch Georg Knepler, seine Vorlesungen geweckt worden. Wir haben über das Besondere bei Mozart gesprochen, wir haben Beethoven analysiert. Das war unglaublich spannend. Beethoven beispielsweise ist 1770 geboren, und er hatte mit 19 Jahren sein prägendes Erlebnis, das war die Französische Revolution. Schubert dagegen ist 1797 geboren, dessen Grunderlebnis war die Restauration. Und all das findet sich natürlich auch in der Musik, wir haben Rückschlüsse gezogen, haben diskutiert und viel gelernt. (…) Überhaupt war das Studieren an der Hochschule sehr interessant. Übrigens ging da auch Hanns Eisler ein und aus, er gab ja Kompositionsunterricht …
„Entdeckungsjahre“: Neue deutsche Volkslieder von Eisler / Becher
Kannten Sie damals schon Eislers Musik, kannten Sie die von Ernst Busch gesungenen Lieder?
Ich glaube, dass eines der ersten Eisler-Lieder, die ich damals kennen lernte, dieses war „Heimat, meine Trauer“. Das heißt „Deutschland“ und gehört zu den „Neuen deutschen Volksliedern“. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob das an der Hochschule war oder wo ich das kennen lernte. Es muss jedenfalls zu Beginn der 50er Jahre gewesen sein. (…)
Spielten diese Lieder auch privat eine Rolle für Sie und Ihren Mann? Fanden Sie die gut und politisch relevant?
Diese Lieder waren natürlich sehr wichtig damals. Aber was wir im Einzelnen gesungen und gehört haben, das weiß ich nicht mehr so genau, ist einfach zu lange her. Und mein Mann hat dann eigentlich die Musik gehört, die ich angebracht habe. Musikalisch war ich bei uns dominierend … Wissen Sie, die Jahre nach dem Krieg waren richtige Entdeckungsjahre, weil sich einfach alles im Umbruch befand. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Es ist nun aber nicht so gewesen, dass wir ständig „Bau auf, bau auf!“ und so was gesungen haben, wie das heute in einigen Veröffentlichungen behauptet wird. Ich hab in meinen Liederbüchern aus der Zeit nachgeguckt, da ist „Bau auf“ gar nicht enthalten. Das hat vielleicht der Parteiapparat gesungen, aber nicht die Massen. (…) Was man ernst nehmen muss, sind diese „Neuen deutschen Volkslieder“ von Eisler und Becher. Und die hat Ernst Busch einzigartig gesungen. Sie sind, und daran erinnere ich mich ganz gut, bei den Leuten angekommen, auch wenn sie nicht gerade sentimental, wohl aber gefühlvoll sind.
„Ernst Busch wurde unter der Decke gehalten“ – Busch in den 50ern
Welche Rolle spielte Ernst Busch damals für Sie?
Wissen Sie, Ernst Busch wurde meiner Erinnerung nach ziemlich unter der Decke gehalten wegen dieser Sache mit der Schallplatte. Er wollte seinen Verlag Lied der Zeit, so weit ich weiß, nicht abgeben und ist sozusagen enteignet worden. Damals war ich noch sehr jung, aber man hatte das dann irgendwie mitbekommen. Und es ist natürlich auch so, dass diese Kampfmusik, die in den 20er Jahren eine wahnsinnige Wirkung hatte, in den 50er Jahren nicht mehr so ankommen konnte. Darum sind die neuen Eisler-Lieder, die ja in enger Zusammenarbeit mit Busch entstanden sind, so wichtig. Busch hat „Heimat, meine Trauer“ gesungen, und das konnten die Leute nachfühlen. Sie müssen sich mal überlegen, wie Berlin damals aussah: Die Innenstadt war total kaputt. Unter den Linden war nur das FDJ-Zentralratsgebäude in Ordnung, die Staatsoper war zerstört, die Humboldt-Universität ebenfalls, der Ostflügel bestand bis in die 60er aus hohlen Mauern. Wir konnten oft nicht in die Universität, weil der Haupteingang wegen Einsturzgefahr gesperrt war. Unter den Linden fuhr eine Trümmerbahn aus aneinander gehängten Loren, die den Schutt abgefahren haben. Wir Studenten haben uns in der Frankfurter Allee, damals Stalin-Allee, auch an den Enttrümmerungsarbeiten beteiligt. Die Steine wurden alle sorgfältig geprüft und geordnet, sie wurden ja alle wieder verbaut. Und die Luft in der Innenstadt war im Sommer voll mit Mörtel und Staub, so war das. Also, das Lied passte in diese Zeit …
Waren Sie als Studentin politisch organisiert?
Natürlich, ich war in der FDJ. In die Partei bin ich erst 1956 eingetreten. Und das hatte nichts mit Stalins Tod zu tun. Ich sag das nur, weil eine ganze Reihe von Leuten ’53 aus Anlass von Stalins Tod in die SED gegangen sind – also ihm zu Ehren, aus Solidarität gewissermaßen. Wir wussten ja vor dem 20. Parteitag der KPdSU nicht, was da los gewesen war! Es änderte sich erst 1956 nach der sogenannten Geheimrede von Nikita Chruschtschow. (…)
(Ende der ersten Kassettenseite)
Sich für den neuen Staat einzusetzen war Ihnen wichtig …
Wissen Sie, man war eben jung. Und das, was die Nazis gemacht hatten, wurde einem erst allmählich bewusst. Man war nicht so aufgeklärt wie heute, heute reflektiere ich das natürlich ganz anders. All dies zu verarbeiten dauerte sehr lange … Ich hatte 1945 bei Warnemünde auch persönliche Begegnungen mit Leuten, die in blau-weiß gestreiften Kitteln gerade aus dem KZ kamen. Das war sehr dramatisch, ich will das eigentlich nicht erzählen … (…)
War Antifaschismus aus Ihrer Sicht die wichtigste Basis für den politischen Neuanfang in der DDR?
Ja, sicher! Und es ist eine Unverschämtheit, wie heute darüber geurteilt wird, wie das runtergemacht wird. Wir haben uns damit wirklich auseinandergesetzt, es gab bei uns wichtige Filme zu diesem Thema und Bücher wie „Professor Mamlock“ von Friedrich Wolf oder „Nackt unter Wölfen“ von Bruno Apitz. Das hat es in der BRD so nicht gegeben! Man müsste das mal alles zusammenstellen und öffentlich machen. (…)
„Eine Lücke in der Wahrnehmung“ – Abriss linker Traditionen
Kommen wir noch mal zu Ernst Busch. Erinnern Sie sich noch an „Ami, go home“?
Klar, den Song haben wir gesungen.
Also gab es durchaus Busch-Lieder, die Sie zu Beginn der 50er gesungen haben …
Ja. Aber es fällt mir jetzt schwer, diese Lieder in direkten Bezug zu meinem Leben zu setzen. Bei bestimmten großen Anlässen hat Ernst Busch natürlich „Ami, go home“ gesungen, das gab es auch auf Schallplatte. Er muss es irgendwie in Zusammenhang mit den Pariser Verträgen gemacht haben, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls hat er das auch öffentlich gesungen, und das wurde natürlich wahrgenommen. Trotzdem waren die Voraussetzungen für seine Wirkung völlig anders als in den 20er Jahren. Weil Eisler und Busch damals in die politischen Kämpfe integriert waren und die Lieder zum Teil aus den Situationen heraus geschaffen haben. „Roter Wedding“ war ein Lied, das direkt aus der Zeit entstanden ist. Und bei den Versammlungen, wo sie auftraten – Sie kennen die Beschreibungen – brüllten die Leute schon „Stempellied!“ und was weiß ich, sie kannten doch diese Lieder. So etwas gab es bei uns dann nicht mehr, da klaffte inzwischen eine Lücke in der Wahrnehmung. Busch war ja zunächst bei der Jugend und bei der Masse nicht bekannt. Es wurde dann allmählich bekannt, dass er im KZ war, dass er von Frankreich ausgeliefert wurde und in Brandenburg im Zuchthaus war. Also, so integriert wie in den 20er und frühen 30er Jahren konnte Busch nicht mehr sein. Die Nazis hatten ja alles weggedrückt: „Kuhle Wampe“ und das „Solidaritätslied“ – all das wurde ja erst langsam wieder lebendig gemacht in der DDR …
„Das Lied gehört abgeschafft!“ – Die deutsche Nationalhymne
Bei welchen Anlässen haben Sie „Ami, go home“ gesungen?
Ich weiß es nicht mehr. Am 1. Mai wahrscheinlich. Wir haben auch andere Lieder gesungen wie zum Beispiel „Freundschaft, Einheit, Frieden“. Die DDR hat ja bis Anfang der 60er Jahre festgehalten an der Idee von der Vereinigung Deutschlands, das wird ja heute auch alles bestritten und unter den Teppich gekehrt. In diesem Lied ging es um ein einiges Deutschland, und das haben wir begeistert auf der Straße gesungen.
In der „Kinderhymne“ von Brecht kommt auch der Hinweis auf ein vereintes Deutschland vor …
Ich bin ja sowieso der Meinung, dass „Anmut sparet nicht noch Mühe“ in Eislers Vertonung die Nationalhymne Deutschlands sein sollte. Können Sie verstehen, dass ich das „Deutschlandlied“ nicht singen kann und dass ich das nicht hören will? Wir haben es in der Nazizeit ständig mit erhobener Hand hören müssen, und anschließend kam das „Horst-Wessel-Lied“.
Beim BDM?
In der Schule! Wir mussten auf dem Flur sitzen und die Hitler-Reden anhören – als ziemlich kleine Kinder. Und bei jeder Gelegenheit wurde das Lied gespielt. Ich bin mir darüber klar, dass der Text von Hoffmann von Fallersleben kein nationalistischer Text ist. Das war ein Bekenntnis der 1848er zu der Einheit ihres Heimatlandes, ganz ehrlich und ganz echt. Aber die Nazis haben es derartig missbraucht, dass ich der Meinung bin: Dieses Lied gehört abgeschafft als Hymne! Da können Sie andere meiner Generation fragen, alle werden Ihnen bestätigen, dass sie es als Zumutung empfinden. Aber das ist eben eine Machtfrage …
Die dritte Strophe ist ja eigentlich ganz in Ordnung …
Ja gut, was soll denn das? Sind wir so arm, dass wir nicht mal eine neue Hymne fertig bekommen? Das Lied hat eine wunderschöne Melodie, das Haydn-Quartett ist großartig – in der DDR wurde es natürlich nicht gespielt. Es geht ja auch nicht darum, dass das Lied schlecht wäre, sondern darum, was damit gemacht worden ist! (…)
(Exkurs über Fürnbergs „Lied von der Partei“, das Liesel Markowski heute kritisch sieht)
„Wir machten 180 Blatt im Monat“ – Bei Musik und Gesellschaft
Kommen wir wieder zurück zu Ihrer professionellen Beschäftigung mit Musik. Nach dem Studium wurden Sie 1959 Redakteurin bei Musik und Gesellschaft. Können Sie ein wenig von Ihrer Tätigkeit dort erzählen?
Es war in der DDR oft so, vielleicht ist das auch in diesem Fach oft so, dass man eine Stelle bekam und dann wurde sie zur Lebensstellung. Ich war ja eigentlich eher wissenschaftlich orientiert, aber man wurde auch ein bisschen geschoben, jedenfalls wurde mir diese Tätigkeit bei der Fachzeitschrift angeboten. Ich habe dort dann 30 Jahre gearbeitet. (…) Herausgegeben wurde die Zeitschrift vom Komponistenverband der DDR, die Auflage betrug ungefähr 8000 Stück. Wir waren anfangs eine kleine Redaktion: der Chef und ich und zwei Sekretärinnen. (…) Wir haben mit sehr wenigen Mitarbeitern 180 Blatt im Monat produzieren müssen. Das ging damals ja alles ohne Computer. Ich hab Schallplatten-, Konzert- und Opernrezensionen geschrieben – das mache ich heute auch noch. Aber damals kam ich gar nicht so viel zum Schreiben, weil ich fortwährend die Redaktionsarbeit hatte. Manche Artikel musste man praktisch neu schreiben, vor allem Übersetzungen aus dem Russischen oder offizielle Texte, die zum Teil in einem scheußlichen Deutsch verfasst waren. Es gab aber immer auch Verbandssachen und Berichte von Kongressen, die man einfach übernehmen musste. Und natürlich haben wir auch Ernst Busch besprochen, also vor allem seine Aurora-Serie. (…)
Also wurde Busch doch nicht komplett „unter der Decke gehalten“, wie sie es vorhin genannt haben …
Ich kann das nicht richtig beurteilen. Ich hatte Ende der 50er im Rahmen meines Studiums ein kurzes Praktikum in der Schallplatte (VEB Deutsche Schallplatten; JV) gemacht und weiß nur noch, dass ich da Bänder von Busch durchhören und die Qualität der Aufnahmen beurteilen sollte. Und ich hatte wenig Ahnung davon, und man hat mir auch wenig Hilfestellung gegeben. Ich war ja Studentin, keine Wissende, keine Informierte. Und mein Eindruck war, dass man dem Busch fremd gegenüber stand – aber das ist nur eine vage Erinnerung.
Haben Sie sich privat Platten von Busch gekauft?
Kann sein, aber wir hatten sie dann ja in der Redaktion, weil wir sie besprochen haben. Wir haben uns natürlich auch privat mit diesen Liedern auseinandergesetzt. Auch bei den Weltfestspielen der Jugend und Studenten 1951 in Berlin hat Ernst Busch eine Rolle gespielt. Aber ich kann Ihnen nicht genau sagen, wann und wie das vor sich ging, dass Busch etwas aus dem Blickfeld geriet.
(Exkurs über die Singebewegung und den Oktoberklub sowie die Unterscheidung zwischen E- und U-Musik in der Zeitschrift)
„Ich fand Eisler toll!“ – Dissertation über Eislers Medienkonzept
In den 80ern promovierten Sie über Hanns Eislers Medienkonzept. Wie kamen Sie zu diesem Thema, wie kamen Sie zu Eisler?
Ich wollte immer schon über Eisler arbeiten. Wir waren doch erfüllt von den Aufführungen des Berliner Ensembles, zu denen Eislers Musik erklang. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Aufführung der „Mutter“, wo auch Busch auftrat. Das hat mich natürlich schon beschäftigt. In meinem Gesangsstudium war Eislers Musik ja nicht besonders präsent, weil ich klassischen Gesang studiert und mich nicht mit Songs beschäftigt habe. Aber später im Beruf begegnete er mir immer wieder, wir haben dann in Musik und Gesellschaft auch über den „Faustus“ geschrieben … Außerdem wollte ich nicht immer bloß journalistisch arbeiten und die Redaktionsmühle machen. Ich hab dann eine Auszeit genommen und war von 1983 bis 1986 Aspirantin. Promoviert habe ich an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, da herrschten günstige Studienbedingungen – meine Gutachter kamen aber von der Humboldt-Universität, mein Betreuer war der Eisler-Forscher Günter Mayer.
Sie haben Ihren Doktor in Philosophie gemacht. Gehörte die Musikwissenschaft …
Ja, die Musikwissenschaft war und ist Teil der Philosophischen Fakultät der Humboldt-Universität. Und an der Gewi-Akademie gehörte ohnehin alles zur Philosophie. Ich muss sagen, dass es ein angenehmes Arbeiten war: Ich bekam ein Stipendium, mein Gehalt wurde solange storniert. (…) Also, mir hat diese wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Eisler viel Freude gemacht. Leider ist die Arbeit dann nicht veröffentlicht worden, obwohl es gar nicht so viele Eisler-Dissertationen gab. (…)
„Das zündete einfach“ – Eisler und Brecht als Songschreiber
Was ist das Besondere an den Eislerschen Kampfliedern?
Die Einfachheit und der Rhythmus. Und natürlich die Verbindung mit den Texten von Brecht. Die Lieder sind textlich und musikalisch auf den Punkt gebracht: „Die So-li-da-ri-tät“ – das ist so einprägsam. Man müsste es heute wieder singen. Eisler wollte Niveau in die Massenkultur bringen, er wollte vom Kitsch weg. Das habe ich auch versucht, in meiner Arbeit zu erklären. Denken Sie an den Film „Regen“ und seine Musik „14 Arten den Regen zu beschreiben“, Eislers Projekt während der Emigration in den USA. Wir sind heute meilenweit entfernt von solchem Niveau in der Filmmusik! Es gibt ja fast nur noch Kitsch und Niveauloses auf diesem Gebiet, ich kann es manchmal gar nicht mehr ertragen. Sie müssen überlegen: Eisler kam von Schönberg, bei dem jeder einzelne Ton eine kolossale Rolle spielte. Erst nach dieser Erfahrung hat er zu der Musik gefunden, die dann zusammen mit den Brecht-Texten so populär wurde. Und jene Verbindung ist das Entscheidende bei den Songs und den Massenliedern. Das zündete einfach.
Es gibt ja verschiedene Erklärungsversuche in der Fachliteratur, wie Eislers Hinwendung von der avancierten Kunstmusik hin zum Agitprop, zum Arbeiterlied, zum Populären vor sich gegangen ist …
Das ist einerseits eine Frage der intellektuellen Entwicklung. Das können Sie in Eislers Schriften und in den Bunge-Gesprächen nachlesen. Brecht spielt hier auch eine große Rolle. Und das ist andrerseits natürlich auch eine Sache, die nicht nur rational-politisch war. Da müssen Sie sich nur mal die Lieder anhören.
Haben Eislers Lieder zur Zeit Ihrer Dissertation überhaupt noch eine Rolle im Kulturleben der DDR gespielt?
Naja, das kann ich jetzt nicht so einfach sagen, das müsste man recherchieren. Sicher wurde mehr Eisler gespielt als jetzt. Die Kampflieder waren eine historische Größe, ihre Wirkung war aber sicherlich zeitgebunden. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, sich das Festival des politisches Liedes anzugucken, das in der DDR auch eine feste Größe war – aber stärker in der Gegenwart verwurzelt. Was dort geboten wurde, hatte nicht Eislersches Niveau, dazu war der Eisler zu genial, aber es war wichtig. Ich fand manches davon gut. Und ich glaube, dass die Singebewegung in der DDR und das Festival eine vergleichbare Wirkung in ihrer Zeit hatten. (…)
„Leute massenhaft erreichen“ – Das Populäre bei Eisler / Busch
Gab es jemanden in der DDR, der Ihrer Ansicht nach in die Fußstapfen von Busch hätte treten können?
Da gab es den Hermann Hähnel, der das versucht hat. Er hat diese Eisler-Lieder zum Teil, am Klavier begleitet von Inge Kochan, gesungen. Da gibt es auch Aufnahmen, sie sind nicht schlecht – aber das ist natürlich kein Busch. (…) Es ist schwierig mit solchen Vergleichen, aber wenn wir von Eislers Musik reden, müssen wir auch über Heiner Goebbels reden, der Rockmusik gemacht hat, der Sachen von Heiner Müller vertont hat und der sehr viel hält von Eisler und auf ihm fußt. Das bewegt mich sehr, was Heiner Goebbels macht. Das ist natürlich ein ganz anderer Anspruch, damit können Sie nicht auf die Straße gehen. Aber wenn ich heute sehe, dass da bei Demonstrationen nur noch auf Trillerpfeifen getönt wird, finde ich das ästhetisch schrecklich heruntergekommen. Aber man kann den Leuten das doch nicht übel nehmen …
Waren diese frühen Eisler/Busch-Lieder eine intelligente Art der Popmusik?
Ja, könnte man sagen, meinetwegen in Anführungszeichen. Eisler wollte natürlich die Leute massenhaft erreichen, aber er wollte eben auch Qualität haben. (…)
Haben Sie ein Lieblingslied von Eisler?
Die Brecht-Vertonung „Anmut sparet nicht noch Mühe“, wenn ich das so schnell sagen soll. Also, das ist jedenfalls eines der Lieblingslieder. Ich finde es wunderbar. (…)
Haben Sie auch ein Lieblingslied von Busch?
„Heimat, meine Trauer“ von Eisler und Becher hat er sehr bewegend gesungen. Natürlich haben auch die von Eisler vertonten Tucholsky-Sachen viel Reiz und Atmosphäre: „Anna-Luise“ zum Beispiel.
Würden Sie diese Lieder den Spanien-Liedern vorziehen?
Das ist keine besonders kluge Frage. Das sind einfach verschiedene Welten. Aber natürlich gefällt mir das „Lied von der Jarama-Front“ …
Welche Assoziationen haben Sie, wenn Sie „Spaniens Himmel“ hören?
Solidarität! Sofort: Dass mein Mann gekämpft hat für internationale Solidarität. Daran danke ich. Dahinter steckt die Idee von Marx, dass die Proletarier, oder heute: die Linken aller Länder zusammenstehen sollen. (…)
„Das Bewusstsein, dass man was Neues will“ – Die Aufbaugeneration
Gehen wir noch mal zurück in die Zeit der 50er Jahre. War es Ihnen damals eigentlich bewusst, wie sehr Ihnen, also in beruflicher Hinsicht, die Türen offen standen? Ich meine, das gibt es ja heute nicht mehr …
Das weiß ich. Es gab bei uns damals Arbeitskräftemangel. Das war mir schon bewusst. Später in der Redaktion ging es zum Teil so weit, dass Kolleginnen ihre Babys mit ins Büro brachten. Ich habe Arbeit mit nach Hause genommen, so lief das damals. Die Zeitschrift war ja immer da, die musste jeden Monat erscheinen. Das gab eine gewisse Sicherheit, die es heute in der Form nicht mehr gibt, das ist richtig … Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass meine Generation frühzeitig die Erfahrung eines Zusammenbruchs hatte, und dann erst kam der Neuanfang. Die Generation meiner Tochter, die vollständig in der DDR aufgewachsen ist, hat diese Existenznot überhaupt nie kennen gelernt. Für mich und meine Altersgenossen war eine Grunderfahrung nach dem Krieg dieses Neue: Wir hatten das Glück, in eine Aufschwungphase zu kommen, in der man den Anspruch hatte, etwas zu bewegen und zu erreichen. Für die Generation der in den 50er Jahren Geborenen ging das weitaus ruhiger zu.
Sie haben vorhin beschrieben, wie Sie als Studentin in Berlin diese Zeit um 1950 erlebt haben. Haben Sie sich damals als Teil der berühmten „Aufbaugeneration“ empfunden, war diese Zugehörigkeit spürbar?
Ja, das hat man gelernt. Auch in der Hochschule. Dieses Bewusstsein, dass man etwas Neues will. Wissen Sie, das kann man euch West-Leuten und überhaupt den jungen Leuten so schwer erklären: Wir waren näher zusammen und integriert. Und es war ja, und ich spreche jetzt nicht von Stalin, eine große Idee, die uns beflügelte. Für diese Idee waren Leute selbstlos gestorben. Und jetzt war dieser Krieg zu Ende, und es fand nun eine Auseinandersetzung mit dem Grauen des Nazismus statt. Daraus wuchs auch so was wie eine Verpflichtung und ein Wollen, es anders und besser zu machen und so weiter. In den ersten Jahren war das natürlich schwer. Es gab ja keinen Reichtum in dem Sinne: Was die jungen Leute heute haben, hatten wir alles nicht. Wir haben uns aus Flicken Kleider gemacht. (…)
Hat Musik beigetragen zu diesem „Neuen“? Haben Sie Musik auch als Gemeinschaft stiftendes Element erlebt?
Klar. Denken Sie an den Auftritt des Alexandrow-Ensembles auf dem kaputten Gendarmenmarkt 1948. Da war ich zwar noch nicht in Berlin, aber darüber hat man gesprochen. Die Russen haben eine ganz eigene Art, Musik zu machen. Ich denke an die Ensembles, die ich später erlebt habe. Da springt etwas über, wenn sie ihre Schastuschkas im Chor singen, und wenn sie tanzen. Oder nehmen Sie die Weltfestspiele 1951 und 1973. Über das Fest 1973 habe ich dann auch berichtet. Vieles war fantastisch, was da musikalisch geboten wurde, war nicht nur plakativ. Da gab es zum Beispiel diese bewegenden Partisanenlieder: Wenn man sie hörte und mit vielen Menschen zusammen sang, da fühlte man sich wirklich integriert. Dagegen können Sie die Love-Parade heute in die Tonne kloppen! Und in den 70er Jahren gab es dann auch das Festival des politischen Liedes: Wenn Sie da drin gesessen haben, dann waren Sie einfach Teil des Ganzen.
Hatten Eisler-Lieder für Ihre Generation auch noch diese Gemeinschaft stiftende Qualität?
Da fällt mir natürlich sofort das „Solidaritätslied“ ein, das auch in der jungen DDR immer noch total zündend war, keine Frage. Auch was Ernst Busch in der „Mutter“ sang, „Das ist der Pfennig, aber wo ist die ganze Mark?“, ist zwar ein anderes Genre, aber in den 50er Jahren noch zündend und wichtig. Und es könnte heute ähnlich wirken. (…)
Bemerkenswert an Musik und Gesellschaft finde ich, dass da sehr viel unter einen Hut gebracht wurde: von Bach über Beethoven bis zum Festival des politischen Liedes …
Ja, dies war letztlich auch das Kulturkonzept der DDR: Der Anspruch, die gesamte Breite des Kulturschaffens zu zeigen und zu versuchen, dieses Schaffen im Niveau zu heben. Dazu gehörte auch Laienmusik. Natürlich waren zum Beispiel die Arbeiterfestspiele nicht allzu beliebt bei uns in der Redaktion. Wir hatten meistens nicht so große Lust, da hinzufahren. Da gab es eben Wettbewerbe zwischen den Chören und Auftragswerke, die da uraufgeführt wurden, aber es wäre nun unfair gewesen, dies mit den Streichquintetten von Mozart oder dem „Roten Wedding“ oder einem Chanson von Eisler zu vergleichen. Da liegen Welten dazwischen, aber es sind verschiedene Genres, die verschiedenen Anforderungen und Notwendigkeiten gerecht werden müssen. Leider wird ja die Musik Eislers heute viel zu wenig aufgeführt. Ich bedaure das sehr. Denn es ist eine Musik, die an Vielseitigkeit kaum zu übertreffen ist. (…)
„Wenn er auftrat, war er der King!“ – Ernst Busch auf der Bühne
Zum Schluss möchte ich Sie noch mal nach dem Bild Ernst Buschs in der Öffentlichkeit in der DDR fragen. Wie haben Sie die Figur Busch wahrgenommen, als Sie Redakteurin waren bei Musik und Gesellschaft?
Ich kann das nicht sicher beantworten, aber zunächst einmal war er ja Schauspieler. Ich glaube, dass ihn in den 50er Jahren seine Rollen am Berliner Ensemble wesentlich mehr bekannt gemacht haben als sein Gesang. Und wenn er gesungen hat, dann dort. „Die Mutter“ oder der „Galilei“, das sind Stücke, die sich mir eingeprägt haben, das waren großartige Erlebnisse. Ernst Busch hat diese Rollen einzigartig gespielt. Er war einer der wichtigsten Schauspieler der DDR. Später hat er dann die Schallplatten-Produktion gemacht, die Aurora-Platten, die ihn lange beschäftigt haben. Und zuletzt war er dann ein wenig in den Hintergrund geraten. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung im Plenarsaal der Akademie der Künste der DDR am Beriner Robert-Koch-Platz in den 70er Jahren, da hat er gesungen. Ich weiß nicht mehr, was er gesungen hat, ich weiß nur noch dass es faszinierend war. Er hatte eine unheimliche Ausstrahlung! Wenn er auftrat, war er sozusagen der King! Er war der Mittelpunkt und hatte den Saal ganz schnell im Griff. Er kam da ganz burschikos die Treppe runter und sagte so etwas wie „Guten Tach, Gemeinde!“ oder „Guten Tach, Familie!“. (…)
Haben Sie ihn auch mal persönlich kennen gelernt?
Ja , ich war in den 70er Jahren einmal bei ihm zu Hause in Pankow. Aber ich weiß nicht mehr genau, wann das war und warum ich eigentlich da war. Ich glaube, ich sollte irgendwas abholen für Musik und Gesellschaft. Kann sein, dass es um die Weihnachtszeit war, ich erinnere mich noch an das gute Meißen-Geschirr und Stollen. Jedenfalls wollte er Schallplatten holen und auflegen, schmiss aber eine runter und die zerbrach, so eine alte Schellackplatte. Und da hat er dann unheimlich rumgetobt. Aber das ist ja bekannt, dass Busch cholerisch war. Ich saß da wie so ’n Hämeken unschuldig rum und wusste nicht, was ich machen sollte. Seine Frau war dabei und hat versucht zu beschwichtigen. Später, in der Wendezeit, war ich dann öfter im Busch-Haus in der Leonhard-Frank-Straße, wenn da Begegnungen stattfanden und Veranstaltungen. Darüber hab ich öfter im ND geschrieben, denn es ging ja darum, das Busch-Haus zu halten als Kulturstätte. Das hat ja leider alles nichts genützt …
Interview: Jochen Voit
Foto: Jochen Voit
(Textfassung autorisiert von Dr. Liesel Markowski am 11. August 2006)

Ingo Materna
über die Geschichtswissenschaft in der DDR, das Museum für Deutsche Geschichte und einen Besuch bei Ernst Busch im Jahr 1963
„Ernst Busch war ein anarchistischer Sozialist!“
(Gespräch am 6. August 2004 in Berlin-Johannistal)
Ingo Materna ist Jahrgang 1932. Er stammt aus Mecklenburg und wächst in Güstrow gemeinsam mit fünf Geschwistern auf. Da sein Vater, der als Lehrer arbeitet, ein „exponierter NSDAP-Mann“ ist, wie Materna sagt, wird der Junge nicht nur zur HJ geschickt, sondern für kurze Zeit auch an eine Adolf-Hitler-Schule in Sonthofen im Oberallgäu. Das Jahr 1945 erlebt Ingo Materna „als eine totale Pleite, in persönlicher und politischer Hinsicht“: Der Vater verlässt die Familie, die Mutter muss die Kinder als Reinmachefrau durchbringen. Materna: „Was meinen sozialen Hintergrund betrifft, war es zeitweise ein Milieu, das noch unter dem proletarischen lag.“ Nach Kriegsende besucht er ein Internat in Ludwigslust, wo Erziehung unter sozialistischen Vorzeichen stattfindet, und wird Mitglied der FDJ. Hier kommt er auch erstmals in Kontakt mit Liedern von Ernst Busch. Im Jahr 1951 macht er Abitur und geht nach Berlin, um an der Humboldt-Universität Geschichte und Germanistik zu studieren. 1952 wird er Mitglied der SED. Nach Abschluss des Studiums 1955 arbeitet Materna kurze Zeit als Geschichtslehrer im Brandenburgischen, um dann als Assistent ans Museum für Deutsche Geschichte in Berlin zu wechseln. Seine Spezialgebiete werden die Novemberrevolution 1918 und die Berliner Arbeiterbewegung. Im Jahr 1963 wird im Museum ein neuer Ausstellungsabschnitt zur deutschen Geschichte von 1933 bis 1945 eröffnet, den Materna maßgeblich mitgestaltet. Bei der Vorbereitung für diesen Ausstellungsabschnitt besucht er zusammen mit Kollegen zahlreiche prominente Antifaschisten in der DDR, darunter auch Ernst Busch. Nach seiner Promotion über den „Vollzugsrat der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte 1918/19“ (erschienen 1978 bei Dietz) wird Materna stellvertretender Direktor des Museums für Deutsche Geschichte. 1981 geht er als Professor an die Humboldt-Universität, wo er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1997 Lehrstuhlinhaber für Territorialgeschichte Berlin-Brandenburg ist. Neben zahlreichen anderen Veröffentlichungen ist eines seiner wichtigsten Projekte in dieser Zeit die Betreuung der repräsentativen Buchpublikation zur 750-Jahr-Feier der Stadt Berlin. Ingo Materna lebt und arbeitet in Berlin.
___________________________________________________________________________
Veröffentlichungen meines Gesprächspartners (Auswahl):
FALK, BEATRICE / MATERNA, INGO: „Die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“. Die Berichte der Regierungspräsidenten über die sozialdemokratische Bewegung in den Regierungsbezirken Frankfurt/Oder und Potsdam während des Sozialistengesetzes 1870-1890. Berlin (BWV) 2005.
MATERNA, INGO / RIBBE, WOLFGANG (Hrsg.): Brandenburgische Geschichte. Berlin (Akademie) 1995.
MATERNA, INGO / RIBBE, WOLFGANG: Geschichte in Daten – Brandenburg. Berlin (Koehler & Amelang) 1995.
MATERNA, INGO / RIBBE, WOLFGANG: Geschichte in Daten – Berlin. 2. Aufl., Wiesbaden (Fourier) 2003.
___________________________________________________________________________
JV: Wie sah man Ernst Busch Ihrer Meinung nach mehrheitlich in der DDR?
Prof. Dr. Ingo Materna: Wissen Sie, hier war er ja im Grunde so ’ne Art Idol. Man kannte natürlich seine Lieder, wobei man ihn zeitweise mehr als Schauspieler denn als Liedsänger wahrnahm. Er hat sich nach 1945 zunächst schwer getan, denn er war ja verschüttet gewesen in Moabit – das wissen Sie ja alles, brauch ich Ihnen nicht zu erzählen – jedenfalls hat er unter der Gesichtslähmung, die, ich glaube: linksseitig war, zuerst sehr gelitten und wollte gar nicht auf die Bühne. Auch mit der Singerei war es nicht so einfach: Er hat dann diesen Verlag Lied der Zeit gehabt, und dort lief es ja auch etwas aus dem Ruder … Naja, ich kann Ihnen ja mal von der leider einzigen Begegnung erzählen, die ich mit ihm persönlich hatte, das wird Sie vielleicht interessieren …
Ja, sehr. Aber können wir vorher noch über Sie und Ihren beruflichen Werdegang sprechen? Sie sagten mir am Telefon, dass Sie Busch sozusagen in Ihrer Eigenschaft als Geschichtswissenschaftler und Ausstellungsmacher besucht haben. Wie sind Sie eigentlich Historiker geworden?
Ich bin 1951 nach dem Abitur nach Berlin gekommen, um an der Humboldt-Universität Germanistik und Geschichte zu studieren. Das war nun aber ausgerechnet das Jahr, in dem das Einfachstudium in der DDR eingeführt wurde. Das bedeutete, dass wir uns zwar für Germanistik und Geschichte gemeldet hatten, nun aber plötzlich feststellen mussten, dass es nur noch ein Fach gab. Dafür war das Fach Geschichte ausgedehnt worden: von der Ur- und Frühgeschichte bis in die Gegenwart, also die Geschichte wurde in diesem großen Rahmen gelehrt. Und man hatte die Möglichkeit Diplomhistoriker zu werden oder Geschichtslehrer. Ich hatte mich zuerst für ’s Diplom gemeldet, habe mich dann aber umschreiben lassen. Denn ich hatte zusätzlich noch mehrere Semester Psychologie und Pädagogik und alles, was dazu gehört, belegt, hätte aber in diesen Bereichen keine Prüfung machen dürfen, weil ich dafür nicht eingeschrieben war. Also habe ich mich umgemeldet und dann sowohl das Diplomexamen als auch das Lehrerexamen für die Oberstufe gemacht.
Wie haben Sie die hochschulpolitischen Neuerungen dieser Zeit erlebt?
Man muss sagen, dass dieser Zuschnitt auf ein Fach nicht so einschränkend war wie es vielleicht klingt. Dieser Zuschnitt ist Teil der damaligen Versuche gewesen, die Hochschulen anders zu gestalten als es in Westdeutschland und im althergebrachten Bildungssystem üblich war. So sehe ich das heute jedenfalls. Also, ich habe beispielsweise auch bei Klemperer gehört und konnte Übungen in Germanistik mitmachen. Es wurde damals auch das 10-Monate-Studienjahr eingeführt, und es wurde Sport getrieben – zu diesem Zweck kriegte jeder Student ’nen Bademantel für 15 Mark, was ja in der Nachkriegszeit eine Rarität war. Den Bademantel habe ich neulich erst wieder gefunden und vernichtet (lacht). Gleichzeitig war das sogenannte Grundlagenstudium des Marxismus-Leninismus eingeführt worden, was sich in den Lebensläufen der heute noch tätigen Leute meistens so liest: „Er studierte außerdem Politologie, Philosophie und Ökonomie.“ Das heißt, dass er das marxistisch-leninistische Grundlagenstudium absolviert hat, das in diese drei Teile zerfiel. In Wirklichkeit gab es in der DDR nämlich niemals ein Politologie-Studium, was wir immer bedauert haben, weil große Teile dieses notwendigen Studiums auf die Geschichtswissenschaft verlagert wurden …
Sie halten diese Angaben in heutigen Lebensläufen für einen Bluff …
Nun, ich bemerke einfach, dass heute noch tätige Politleute, die in der DDR studiert haben, meistens diese Disziplinen in ihrer Biografie auffächern – so wie das in der Bundesrepublik üblich ist. Wer im Rahmen eines Pädagogikstudiums vier Semester Psychologie gehört hat, listet Psychologie als eigenes Studium mit auf und zusätzlich noch Soziologie und dieses und jenes … Nach dieser Methode könnte ich heute sieben Fächer aufzählen: Russische Geschichte ist heute ein Extra-Fach, Slawistik ist aufgeschlüsselt in Literatur und Sprache und so weiter und so fort. Ich will sagen: Dieses Studium der Geschichte war sehr komplex, hatte aber den Nachteil, dass man nachher festgelegt war auf dieses Fach. Wenn man also Lehrer wurde, ich habe zum Beispiel ein Jahr an einer Schule im Brandenburgischen unterrichtet, musste man ein neues Fach dazunehmen, das man gar nicht studiert hatte. Das war zwangsläufig so. Die Schulen waren damals noch kleine Einheiten mit 220 oder 240 Schülern – da konnte ein Geschichtslehrer nicht nur mit Geschichte beschäftigt werden.
„Von der Urgeschichte bis 1917“ – Museum für Deutsche Geschichte
Sind Sie nach Ihrem Schuleinsatz direkt ans Museum gegangen?
Ja, ich bin dann nach Berlin versetzt worden, weil ich mich verheiratet habe mit der Frau, die Sie vorhin gesehen haben. Sie hat 1956 Examen gemacht, und ich bin dann ans Museum für Deutsche Geschichte gekommen. Das Museum wurde von Professor Alfred Meusel geleitet, der als Emigrant aus England gekommen war, er war eigentlich vom Fach her Soziologe und vor ’33 an der TH in Aachen tätig gewesen. Er wurde dann, ja, man könnte sagen: zu einer der Säulen der Geschichtswissenschaft in der DDR. Meusel war, nebenbei bemerkt, mit Ernst Busch befreundet, er stammte auch genau wie Busch aus Kiel.
Hat Alfred Meusel das Museum für Deutsche Geschichte gegründet?
Ja, er hat das Museum für Deutsche Geschichte mit aus der Taufe gehoben, er war der Gründungsdirektor. Es gab einen Vorläufer, nämlich das Zeughaus, also vor allem die Bestände des Zeughauses, soweit sie damals noch hier waren – ein großer Teil der Exponate war ja in der SU und kam erst ’56, ’57 zurück. Das waren Uniformen, Waffen und so weiter. Manches kam auch nur teilweise wieder zurück: Ich erinnere mich, dass beispielsweise der Herzog von Liegnitz nicht vollständig war, wie kriegten zwar die Ritterrüstung des Herzogs wieder, aber die Rüstung für sein Pferd fehlte. Solche Dinge passierten schon hin und wieder. Nun war dieses Museum, das 1952 gegründet wurde, gleichzeitig gedacht als das Zentrale Institut für Geschichtswissenschaft in der DDR. Diese doppelte Zielstellung, sowohl Museum zu sein als auch zentrale Forschungsstätte, funktionierte aber nicht. Man gründete dann ’56 das Akademie-Institut für Geschichte, das vom Museum abgetrennt wurde. Ein größerer Teil der Museums-Mitarbeiter ging dann an die Akademie, und so wurde das, wenn man so will: Groß-Kombinat aufgelöst und in zwei Teile zerlegt. Zu dieser Zeit bin ich ans Museum gekommen, war zunächst Assistent, dann Abteilungsleiter und schließlich bis 1981 Stellvertretender Direktor. Ich war also 25 Jahre dort.
Für welche Gebiete waren Sie zuständig?
Für die historischen Abteilungen von der Urgeschichte bis …, nun, ich glaube, wir machten damals den Einschnitt 1917 …
… wegen der Oktoberrevolution?
Wegen der Oktoberrevolution.
War das auch ein sammlungstechnischer Einschnitt?
Nein, sammlungstechnisch nicht. Es war so organisiert, dass es historische Fachabteilungen gab, in denen Historiker saßen, die zu den jeweiligen Zeitabschnitten arbeiteten. Gleichzeitig gab es parallel dazu die Sammlungsabteilung mit den einzelnen Unterabteilungen wie Gemälde, Graphiken, Plakate, Uniformen, Alltagskleidung, Gebrauchsgegenstände und so weiter. Viele der Dinge, die heute im Deutschen Historischen Museum gezeigt werden, stammen aus dieser alten Sammlung, die ständig erweitert wurde.
Hatten Sie einen thematischen Schwerpunkt?
Ja, der thematische Schwerpunkt hing mit dem Spezialgebiet des zeitweiligen Direktors Walter Nimtz zusammen, der sich, wie übrigens auch sein Vorgänger Meusel, vor allem mit der Revolution 1918/19 beschäftigte. (…) Es war so, dass wir an die wissenschaftlichen Mitarbeiter die Forderung stellten, weiter auf ihrem Fachgebiet tätig zu sein. Das heißt, die Kunsthistoriker sollten Kunsthistoriker bleiben und gleichzeitig Museumsleute sein. Wir haben praktisch die Museologie aufgefasst wie eine Ergänzungswissenschaft, die etwa dem Bibliotheks- oder Archivwesen gleichgestellt war – aber die Grundbeschäftigung war die Geschichtswissenschaft, die Kunstgeschichte oder was man eben sonst studiert hatte. Insofern verlangten wir, dass die wissenschaftlichen Mitarbeiter weiterhin auf einem, wenn auch eingegrenzten, Forschungsgebiet in der Geschichte arbeiteten. Und ich hatte dadurch, dass der Direktor sich und mich mit der Novemberrevolution befasste, meine Dissertation über den Berliner Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte verfasst. Das hatte ich auf sein Anraten hin gemacht, weil der gesamte Bestand dieser Arbeiter- und Soldatenräte erhalten geblieben ist und die Akten alle hier in Berlin waren, sodass ich die Möglichkeit hatte, neben der Arbeit die Dissertation zu machen. Das ist dann zu meinem Spezialgebiet geworden, ich habe auch an den großen Bildbänden über die Novemberrevolution in Deutschland mitgearbeitet, die zwischen 1968 und 1978 vom Institut für Marxismus-Leninismus herausgegeben worden sind: „Illustrierte Geschichte der Novemberrevolution in Deutschland“.
1987: Wissenschaftliche Vorbereitung der 750-Jahrfeier Berlins
Im Jahr 1981 haben Sie dann Ihre Tätigkeit im Museum für Deutsche Geschichte beendet …
Ja, ich bin dann als Professor an die Humboldt-Universität gekommen. Damals wurden an, ich glaube, fünf Universitäten Lehrstühle geschaffen für die Landesgeschichte. Hier in Berlin nannte sich das Lehrstuhl für Territorialgeschichte Berlin-Brandenburg. Und der Zielpunkt war natürlich die 750-Jahrfeier der Stadt Berlin im Jahr 1987. Die „Oberen“, das heißt also: das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, der Rat für Geschichtswissenschaft und das Zentralkomitee der SED und Weiß-der-Deubel-wer merkten nun alle, dass sie ein historisches Ereignis vor sich hatten, für das wissenschaftlich gesehen keine Vorbereitung getroffen worden war.
Auch bei Ihnen im Haus war zu diesem Thema nichts gemacht worden?
Nein. Das Museum für Deutsche Geschichte hatte ja gar keinen Auftrag, sich speziell mit Berlingeschichte zu befassen. Dafür gab es das Märkische Museum und das Stadtarchiv, wobei die aber eher parallel zueinander und nur wenig miteinander arbeiteten und schon gar nicht mit dem Anspruch, hier etwa eine Berlingeschichte aus marxistischer Sicht zu schaffen.
Wie sind Sie mit der Schwierigkeit umgegangen, dass es bei diesen Vorbereitungen für die 750-Jahrfeier zwangsläufig um Gesamtberlin gehen musste und nicht nur um den Ostteil der Stadt?
(lacht) Ja, das war natürlich ein Problem für sich! Da gibt es inzwischen eine Dissertation eines holländischen Kollegen, Krijn Thijs, der diese ganze Problematik der Berlingeschichte und insbesondere die Schwierigkeiten der 750-Jahrfeier untersucht hat. Dieser Kollege besucht mich gelegentlich, weil ich einiges zu dieser Zeit aufgeschrieben habe: was da für Sitzungen stattgefunden haben und so weiter. Darüber hinaus hat er im Landesarchiv Berlin und im ehemaligen Archiv der SED, jetzt Bundesarchiv in Lichterfelde, Unmengen von Unterlagen gefunden, die ich zum Teil auch nicht kenne. Und ich wundere mich manchmal darüber, was damals alles berichtet und besprochen wurde … Der Auftrag bestand jedenfalls im Vorfeld dieses Jubiläums darin, Lehre zur Berlingeschichte und zur brandenburgischen Geschichte, also Vorlesungen und Übungen, durchzuführen. Und dann sollte natürlich diese 750-Jahrfeier wissenschaftlich vorbereitet werden in der Gestalt dieses Buches „Geschichte Berlins – Von den Anfängen bis 1945“. Der zweite Teil über die Zeit nach 1945 ist dann bei der Akademie der Wissenschaften gemacht worden von Gerhard Keiderling.
Sind Ihnen politische Vorgaben gemacht worden bei dieser Publikation? Diese Geschichte Berlins sollte doch offenbar auf ein bestimmtes Ziel hin erzählt werden …
Wissen Sie, es wurde gleichzeitig an den sogenannten Thesen zur 750-Jahrfeier gearbeitet. Das war so eine besondere Methode in der DDR, die auch angewandt worden war zum Lutherjahr 1983 und bei den Feierlichkeiten zur Novemberrevolution 1958. Diese Thesen waren generelle Vorgaben in der Art eines Leitfadens, die man zu erfüllen hatte. Ansonsten hat sich im Grunde, ich kann Ihnen das ja ruhig sagen, niemand um unser Buch geschert – sie waren alle zufrieden, dass überhaupt was da war. Der Prorektor der Universität kam damals lediglich zu mir und meinte: „Man hat mir gesagt, ich soll mir das mal angucken.“ Aber es ist durch keine Zensur oder so was Ähnliches gegangen. Dadurch, dass die Publikation beim Dietz Verlag erschien und dadurch, dass ich in dieser Kommission „750 Jahre Berlin“ war, war das kein Thema. Dieter Klein sagte zu mir: „Du musst das selbst verantworten, ich verstehe davon ohnehin nichts.“ Das ist übrigens auch immer mein Standpunkt gewesen, wenn ich was zu beurteilen hatte. Ich habe es mir zwar angesehen, aber ansonsten galt der Grundsatz: Wenn man selbst schon nichts zu einem bestimmten Thema schreiben kann, soll man andere nicht hindern, etwas dazu zu schreiben. Obgleich es notwendigerweise hier und da auch Querelen gab. (…)
(Exkurs zur Affäre um Günter Paulus und sein Buch „Die zwölf Jahre des Tausendjährigen Reiches“; Materna hatte damals ein positives Gutachten zu diesem Buch verfasst)
Als dann dieses Berlin-Projekt hinter uns lag, sollten meine Mitarbeiter und ich – wir waren drei oder vier Leute – uns über die brandenburgische Geschichte hermachen und dasselbe Abenteuer, das wir mit Berlin gerade bestanden zu haben glaubten, für Brandenburg wiederholen. Das kam dann über Kreuz mit dem Ende der DDR und der sich entwickelnden Zusammenarbeit mit der FU. Ich hatte damals das Glück, dass ich an der Freien Universität Prof. Wolfgang Ribbe getroffen habe, der intensiv über Berlin und Brandenburg gearbeitet hat, der auch 1987 eine Geschichte Berlins in zwei Bänden veröffentlicht hatte und der nun dabei war, eine Brandenburgische Geschichte zu schreiben.
Hatten Sie schon 1987 im Zuge der Jubiläumsvorbereitungen Kontakt zu ihm gehabt?
Nein. Man durfte in der DDR zwar mit west-deutschen Historikern Kontakte pflegen; wir haben sogar im Frühjahr 1989 eine Ausstellung zur „Topographie des Terrors“ aus West-Berlin übernommen und haben Diskussionen mit Jürgen Kocka, Reinhard Rürup und anderen Spezialisten geführt, was heute bestimmte Leute wie zum Beispiel Heinrich August Winkler nicht wahrhaben wollen. (…) Was allerdings nicht genehmigt wurde, war eine direkte Zusammenarbeit unsererseits mit den West-Berlinern. Das hing mit der angeblich besonderen Rolle West-Berlins zusammen und dem Versuch, West-Berlin und die Bundesrepublik getrennt zu behandeln. Aber wenn man als DDR-Wissenschaftler die Bundesrepublik kontaktieren wollte, konnte man das tun. Und wir als Berlin-Historiker hatten immerhin die Genehmigung bekommen, begrenzt in West-Berlin zu forschen, und das haben wir auch gemacht. Wolfgang Ribbe war dann in der Wendezeit einer der wenigen an der Freien Universität, die gesagt haben: „Wir wollen uns mit den Leuten im Osten verständigen und eine Zusammenarbeit ermöglichen.“ So sind unsere gemeinsamen Publikationen über die Berliner Stadtgeschichte und über die brandenburgische Geschichte entstanden. Das Schöne daran war, dass hier zur Hälfte Mitarbeiter aus West- und aus Ost-Berlin involviert waren. (…)
(Exkurs über die Probleme der Evaluierung der Dozenten und die Neubesetzung von Lehrstühlen in der Nachwendezeit an der Humboldt-Universität; Materna berichtet von Merkwürdigkeiten bei Ausschreibungsverfahren, z.B. von dem „Kuriosum, dass es auf einmal für einen Stuhl zwei Leute gab“ und dass „man sich als Professor aus der DDR nun auf seine eigene Stelle bewerben durfte“; von 17 Ost-Professoren hätten lediglich vier eine Verlängerung ihres Arbeitsvertrags erhalten; Materna moniert das „unkollegiale Verhalten“ einiger West-Professoren in dieser Zeit des Umbruchs)
„Goethe und die Frauen“: Kulturelle Prägungen der Aufbaugeneration
Lassen Sie uns zurückgehen in die Zeit um 1950. Mich würde interessieren, welche kulturellen Prägungen damals für Sie eine Rolle gespielt haben und wann Sie zum ersten Mal etwas von Ernst Busch gehört haben …
Ich erinnere mich, dass wir um 1949 herum eine Art Kulturgruppe an der Ludwigsluster Schule hatten. Der Leiter dieser Gruppe war Friedo Solter, der später einer der führenden Theaterregisseure in der DDR wurde. Die Kulturgruppe war Teil der FDJ, in der ja fast alle Schüler des Internats Mitglied waren. Wenn man sich heute mal bei Klassentreffen sieht, könnte man allerdings fast meinen, dass ich das einzige Mitglied war – aber das nur am Rande … Jedenfalls machte diese Kulturgruppe ein bisschen auf Agitprop und organisierte auch alle möglichen Veranstaltungen. 1949 gestaltete sie zum Beispiel einen Goethe-Abend, aber natürlich nicht so, wie das die Ludwigsluster Bürgerwelt erwartete. Das Thema hieß „Goethe und die Frauen“. Heute würde das niemanden vom Stuhl reißen, weil alle längst wissen, was da mit der Christiane und der Friederike und den anderen war. Aber damals waren die Leute regelrecht empört über diesen Abend, denn der Schulunterricht war ja immer völlig steril in dieser Hinsicht gewesen und hatte solche Dinge ausgeklammert. Wir als Jungs und Mädchen von 16, 17 Jahren waren natürlich wild auf solche Geschichten. Uns hat das gefallen. Und dann kam über die Kulturgruppe ein Mann zu uns vom Schweriner Staatstheater, der mit Friedo Solter befreundet war, der uns mit neueren Texten und Liedern vertraut machte. So kamen wir frühzeitig auf Leute wie Becher, Brecht und Busch. Man hörte damals auch zum ersten Mal Lieder von Busch auf Schallplatten. Und man hörte diese Lieder über Rundfunkapparate, die ja um 1949 allmählich wieder Verbreitung fanden, nachdem sie vorher alle beschlagnahmt worden waren. Als ich dann 1951 nach Berlin kam, war Busch jedenfalls schon eine feste Größe. Nicht nur bei den Älteren, auch bei Leuten meines Alters war er eine bekannte Nummer. Er hat zum Beispiel bei den Weltfestspielen der Jugend, die 1951 hier in Berlin stattfanden, mit dem Chor der Humboldt-Universität Produktionen für den Rundfunk gemacht. Ich habe mich neulich mit einer ehemaligen Kollegin unterhalten, die damals in diesem Ensemble war, und sie hat mir bestätigt, dass Busch mit ihnen aufgetreten ist. Dieser Studenten-Chor sang Lieder wie „Stalin führt, und unser Werk gelingt“, dann gab es auch ein Lied auf Mao, das einige sogar auf chinesisch beherrschten, und natürlich verschiedene Volkslieder. Paul Rahner hieß der Dirigent dieses Ensembles. Und Ernst Busch sang damals mit dem Chor zusammen „Ami, go home!“. Das habe ich auch noch im Ohr, dieses Lied war sehr verbreitet zu Beginn der 50er Jahre.
„Ami, go home!“ und Stalin-Hymnen: Verbreitung der Busch-Lieder
Können Sie heute noch Textpassagen auswendig?
Ja, sicher: „Clay und Cloy aus USA sind für die Etappe da / Lasst die German boys verrecken in dem Sand“ hieß es in einer Strophe. Und der Refrain ging „Go home, Ami! Ami, go home! / Spalte für den Frieden dein Atom!“. Diese Zeilen waren uns sehr geläufig, der Text passte in die Zeit.
Fanden auch die von Busch gesungenen Hymnen auf Stalin entsprechende Verbreitung?
Wir als Jugendliche haben diese Stalinlieder privat nicht gesungen. Das waren Hymnen für bestimmte Aufführungen. Wissen Sie, der erste große versuchte Vormarsch des Stalinismus in die Alltagskultur der jungen Leute fand am 70. Geburtstag Stalins im Jahr 1949 statt. Da wurden überall an den Schulen Stalin-Feiern abgehalten. Bei dieser Gelegenheit wurden dann diese Hymnen vorgetragen, auf Russisch hieß das gym: Hymne. Aber ich kann nicht sagen, dass diese Hymnen Allgemeingut geworden wären. Bei „Ami, go home!“ war das anders. Diese Losung war stark und wurde bereitwillig aufgenommen. Übrigens wurde das Lied manchmal auch umgetextet. Die andere Seite machte daraus „Go home, Ivan! Ivan, Ivan, go home!“ und ergänzte noch „Nimm den Walter Ulbricht mit!“, das kam auch vor. Dieses Lied ließ sich je nach Bedarf variieren, unsere Leute sangen dann dafür „Nimm den Adenauer mit!“, also die ideologischen Auseinandersetzungen der Zeit spiegelten sich auch im Umgang mit diesem Song.
War Antiamerikanismus zentraler Bestandteil der Weltanschauung, die in der frühen DDR vermittelt wurde?
Das kann man schon sagen. Wobei man sich als junger Mensch natürlich nicht über die Konsequenzen dieser Dinge im Klaren war. Es war ja damals zum Beispiel auch die Zeit des Koreakrieges, und der amerikanische General Matthew Ridgway, der dort ab 1951 das Oberkommando führte, wurde von Gerhart Eisler, der ja der Propaganda-Chef der DDR war, als „Pest-General“ bezeichnet und hartnäckig deutsch „Rittgewee“ ausgesprochen. Wir haben diese Aussprache dann übernommen, um anzudeuten, dass wir ohnehin nicht verstanden, was die Amerikaner da machten und was das alles sollte. Dann gab es die Geschichte mit dem „Ami-Käfer“, die gleichfalls von Eisler propagandistisch ausgeschlachtet wurde: Wir wurden als Schüler veranlasst, Kartoffelkäfer von den Feldern zu sammeln, die angeblich die Amis beim Überfliegen der DDR auf dem Weg nach West-Berlin abgeschmissen hatten. Praktischerweise hießen diese Käfer offiziell Colorado-Käfer, was dann als Argument herhalten musste. Es gab damals entsprechende antiamerikanische Plakate mit der Aufschrift „Amikäfer flieg“ und so weiter. Das hat natürlich kein Mensch geglaubt. Als junge Leute haben wir das zwar aufgenommen, aber eher im Vorbeigehen ironisch kommentiert. Also, wir haben das nicht allzu ernst genommen.
Aber das war durchaus Teil einer Strategie und hatte Methode …
Sicher, solche Sachen wurden, heute würde man sagen: „instrumentalisiert“. Es gab auch Plakate, auf denen die Schweinereien, die die Amerikaner in Korea anrichteten, abgebildet waren. Da lugte dann im Hintergrund der Ami hervor, und vorne war eine Art Laus zu sehen, um den Einsatz biologischer Waffen anzuprangern. Daran kann ich mich gut erinnern.
Die Botschaft „Ami, go home!“ war ein propagandistischer Slogan, der auf verschiedenen Kanälen verbreitet wurde.
Ja, und zwar in verschiedenen Varianten. Es war der Versuch, zumindest eine antiamerikanische Stimmung hervorzurufen.
Würden Sie rückblickend sagen, wenn Sie etwa an Ihre damaligen Freunde und Bekannten denken, dass das gelungen ist?
Ich denke, eigentlich nein. Sicherlich war es so, dass man die amerikanische Politik, insbesondere was die Amerikaner in Korea machten, nicht direkt nachvollziehen konnte. Man fragte sich natürlich: „Was wollen die da eigentlich?“ Dieses Unverständnis ist verbreitet gewesen. Aber dass man gleichzeitig einen extremen Antiamerikanismus verinnerlicht hätte, das glaube ich nicht.
Schlagermusik und Schuhe mit Kreppsohlen: US-Einflüsse
Welche Rolle spielte die amerikanische Populärkultur für Sie und Ihre Altersgenossen?
Das ist ein besonderer Punkt. Natürlich hat sich ein großer Teil der jungen Leute die Schlagermusik auf AFN, also American Forces Network, angehört. Glenn Miller war sehr beliebt und uns allen ein Begriff. Deswegen war es von vornherein ein verlorenes Spiel, wenn man „Laurentia“ oder „Seht die roten Kremlmauern“ gegen Glenn Miller ausspielen wollte – aber genau das hat man in der DDR versucht. Ich glaube sogar, man sprach von der „amerikanischen Unkultur“, und das bezog sich auf alle möglichen Dinge. Zum Beispiel gab es damals diese Schuhe mit Kreppsohlen, diesen Kautschuksohlen. Da hieß es dann: „Das sind Amilatschen, die trägt man nicht!“ Oder dann gab es Ringelsocken, die im Westen produziert wurden und die auch bei uns verbreitet waren: „Das sind Amisocken, die trägt man nicht!“ Natürlich haben sich über solche Fragen, wenn man sie ins Politische transponierte, Gegensätze entfaltet, und es gab tatsächlich Leute, die sich entsprechend mokierten: „Was hast Du denn für Schuhe an!“ Abgesehen davon wussten natürlich alle, dass es diese Schuhe hier im Osten nicht zu kaufen gab, die hat man sich schon in West-Berlin besorgen müssen.
„Das Amerikanische“ wurde quasi auch als ein Etikett für alles Missliebige benutzt.
Genau. Im Grunde war es gleichzeitig eine Abwehr alles Modernen. Das möchte ich nachträglich so sagen. Die ältere Generation hatte man natürlich schon dadurch auf seiner Seite, dass sie beispielsweise die neue Jazzmusik nicht verstand. Meine Großmutter hörte nach wie vor ihre Strauß-Walzer, und wenn sie diese anderen Klänge hörte, hieß es: „Was machen die da für ’n Lärm!“ Aber das können Sie über die Jahre hinaus immer wieder verfolgen. Das ging uns später mit unseren eigenen Kindern nicht viel anders. Wir haben natürlich auch gesagt: „Was hast du für lange Zotteln, was soll das denn?“ Dieses Phänomen wird es immer geben, dieses Unverständnis gegenüber dem Neumodischen. Aber damals wurde das ganz klar benutzt, um eine Stimmung gegen die Amerikaner und gegen die Bundesrepublik und deren offizielle Politik zu erzeugen. Obgleich es in der Bundesrepublik natürlich auch genügend Leute gab, die ebenfalls diese neumodischen Dinge nicht mitmachen wollten. (…)
(Exkurs über die Übernahme sozialistischer Terminologie durch Künstler und Intellektuelle; Materna nennt als Beispiel einen Aufruf von DDR-Intellektuellen aus dem Jahr 1963 zum Thema Atomrüstung, der an die Intellektuellen in der Bundesrepublik gerichtet war; Materna: „Wenn man sich dieses Politdeutsch, dieses Parteichinesisch, heute durchliest, fasst man sich an den Kopf. Das musste ja, jedenfalls denke ich mir das heute, voll gegen den Baum gehen.“)
„Wat is dat denn!“ – Unglaubwürdigkeit sowjetischer Propaganda
In der Bundesrepublik gab es zeitgleich antiamerikanische Stimmungen, aber natürlich vor allem stark antisowjetische Töne.
Wissen Sie, die antisowjetische Stimmung war latent. Nur dass man sie bei uns im Osten in keiner Weise in der Öffentlichkeit hochkommen ließ. Insgesamt war es aber rückblickend aus Sicht der DDR so, dass der kulturelle und geistig-ideologische Krieg von vornherein verloren war, weil die Leute hier gesehen haben, dass die hiesige Propaganda unaufrichtig und unehrlich war. Es wurden ja nicht nur vermeintliche Übel aus dem Westen verteufelt wie der „Ami-Käfer“ und die „Ami-Latschen“. Gleichzeitig gab es eine übermäßige Betonung dessen, was in der SU angeblich prima war. Dabei hatten Millionen deutsche Soldaten sehen können, was dort für Zustände herrschten und zudem von ihnen angerichtet worden war. Da konnten die Sowjets noch so viele Filme zeigen und angeblich brandneue landwirtschaftliche Erkenntnisse propagieren von Mitschurin, der da seine großen Tomaten im frostigen Sibirien anbaute nach dem Motto „Die Welt soll blühen“ – das hat doch im Grunde keiner für voll genommen. Mein Großvater, der Bauer war, sagte: „Wat will de uns vertellen!“, als das mit den angeblich neuen Züchtungsmethoden aus der Sowjetunion losging. Er hatte seine Kartoffeln schon immer vorgekeimt, jetzt hieß das auf einmal „jarowisieren“. Und als das sogenannte Quadratnestpflanzverfahren kam, da sagte mein Großvater: „Wat is dat denn!“ Schon sein Großvater hatte 1850 den Markeur so und so gezogen, und wo er sich kreuzte, wurden Kartoffeln gepflanzt. Nichts anderes war das Quadratnestpflanzverfahren, neu war nur der Name, und das Ganze wurde als sowjetische Innovation verkauft. Also, die Leute haben all diese Dinge nie als Wahrheit aufgefasst. Und dadurch, dass die andere Seite diese Dinge zusätzlich aufgegriffen hat und auf ihnen herumritt, konnte eigentlich von unten her kaum eine echte ideologische Basis in der DDR entstehen. Als Beispiel: Wenn Sie in irgendwelche Werkstätten gingen, später dann zum Beispiel in die Autoreparaturwerkstätten, spielte da natürlich von morgens bis abends der RIAS, ganz offiziell. Und wenn Sie was gesagt haben, dann kriegten Sie zu hören: „Na, Sie können ja gehen und sich ’ne neue Werkstatt suchen!“ Das war die Ost-Berliner Realität.
„Eine Persönlichkeit besonderer Art“: Busch und seine Bedeutung
Welche Bedeutung hatte nun Ernst Busch für Sie und Ihre Altersgenossen?
Viele seiner Lieder waren uns vertraut, man kannte seine Schallplatten. Und dann nahm man Busch in den 50er Jahren natürlich auch als Schauspieler wahr, wir haben ihn auf der Bühne in verschiedenen Rollen gesehen. In der„Mutter Courage“ spielte er den Koch, das war unvergesslich, später sahen wir ihn als Galilei. Aber er war nicht nur eine prägende Persönlichkeit auf der Bühne, man wusste auch, welche Vergangenheit er hatte, und das hat dazu beigetragen, dass er insgesamt als bedeutende Figur des Kulturlebens, ja als Persönlichkeit besonderer Art galt. Man spürte irgendwie, dass er nicht so recht in dieses schablonenhafte Bild passte, das gemäß der DDR-Kulturauffassung allgemein von ihm gezeichnet wurde.
Was wusste man von Busch?
Man wusste, dass er vor ’33 schon ein arrivierter Schauspieler gewesen war. Man wusste, dass er in der Emigration gewesen war, und das war für uns junge Leute ohnehin schon ein Markenzeichen: Wer in der Emigration gewesen war, ganz gleich welcher politischen Couleur, war sozusagen sakrosankt für uns. Also, ob jemand ein jüdischer, ein kommunistischer oder ein sozialdemokratischer Emigrant gewesen war, spielte im Grunde keine Rolle für uns. Es gab da keine Überlegungen, mit welchen Besonderheiten es zusammengehangen haben mag, dass jemand ’33 Deutschland verlassen hatte …
War die Tatsache, dass jemand emigriert war, also eine Art Gütesiegel?
Ja. Gütesiegel „Emigrant vor der NS-Herrschaft“, das genügte. Wir hatten Hochachtung vor diesen Leuten. Das galt übrigens auch für unsere Professoren, wir hatten ja an der Humboldt-Uni eine starke „westliche“ Emigranten-Besetzung. Ob Sie an Bloch und Mayer in Leipzig denken oder in Berlin an den Mann von Anna Seghers, Johann-Lorenz Schmidt, der Professor für Wirtschaftswissenschaften war, oder an den Juristen Hans Nathan, der sich während der Emigration in Glasgow als Fahrkartenverkäufer durchgeschlagen hatte, den Historiker Karl Obermann, der aus den USA zurückkam, oder den weithin bekannten Jürgen Kuczynski und viele andere mehr.
Wurde den Emigranten nicht auch ein gewisses Misstrauen entgegengebracht?
Nein, das hat bei uns im Grunde keine Rolle gespielt. Es gab natürlich Versuche, so etwas zu schüren. Ich kann mich besinnen, dass im RIAS mal erzählt wurde, dass der Pieck und der Ulbricht gar keine Deutsche seien, sondern sowjetische Staatsbürger. Das stimmte auch in gewisser Weise: Ihnen war 1933 die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt worden, und wer 1938 keinen sowjetischen Pass bekam, der musste die SU verlassen. Zum Beispiel wurde Professor Gerhard Harig, der später in der DDR Staatssekretär für Hochschulwesen war, ausgewiesen und damit faktisch an die Nazis ausgeliefert. (…) Wie auch immer: Die Emigranten standen hoch im Kurs bei uns. Die Klammer war gewissermaßen der Widerstand gegen Faschismus und Krieg.
Ausstellung in der DDR über die Zeit des Nationalsozialismus
Ihr Interesse als Historiker an Ernst Busch hing also vor allem mit Buschs antifaschistischen Aktivitäten während der Emigration zusammen.
So ist es. Wir machten 1963 eine Ausstellung im Museum für Deutsche Geschichte über Deutschland von 1933 bis 1945. Das geschah im Rahmen unserer Gesamtdarstellung der deutschen Geschichte. Ein großer Teil dieser Ausstellung befasste sich nun mit dem Widerstand gegen das NS-Regime und auch ausführlicher mit dem Widerstand in der Emigration. Ich habe hier noch mein Notizbuch von damals, da stehen viele Namen deutscher Emigranten drin, die meine Mitarbeiter und ich alle besucht und gesprochen haben. Das geschah im Rahmen der Vorbereitung auf die Ausstellung. Und im Frühjahr ’63 haben wir auch Ernst Busch besucht, den ich bis dahin nur von Schallplatten und von der Bühne her kannte. Diese persönliche Begegnung war sehr eindrucksvoll. Leider haben wir damals diese Gespräche nicht auf Band aufgezeichnet, auch weil die meisten Gesprächspartner das nicht wollten, sondern uns höchstens Notizen gemacht. Die Ausstellung selbst ist allerdings gut dokumentiert, weil wir zu unseren Ausstellungen immer sogenannte bebilderte Drehbücher erstellt haben. Darin sind Fotos der Exponate enthalten, und dort ist auch die Herkunft der Dokumente festgehalten, die ja teilweise von unseren Gesprächspartnern zur Verfügung gestellt wurden. Übrigens kam es damals zu kleineren Unstimmigkeiten wegen einiger Fotos, die wir in der Ausstellung gezeigt haben: Der sowjetische Generalstabschef war zu Besuch und hat sich mit mir die Ausstellung angeschaut, das muss Ende ’63 oder Anfang ’64 gewesen sein. Jedenfalls hat er anschließend zum Direktor gesagt, die Ausstellung sei ja sehr interessant, aber es seien zu viele Nazi-Größen zu sehen: Hitler, Himmler, Göring, Ley, Ribbentrop und alle möglichen Leute. Dann hat unser Direktor, der ein sehr ängstlicher Mensch war, zu mir gesagt: „Geh mal nachsehen, ob das stimmt und zähl mal durch.“ Naja, das hab ich dann gemacht. Aber natürlich wusste ich sehr genau, welche Fotos wir da aufgehängt hatten. Meine Mitarbeiter und ich waren der Meinung, dass die NS-Diktatur schlecht ohne ihre Diktatoren darzustellen ist. Darum war eben nicht nur Hitler, sondern wie gesagt die ganze Mannschaft dort abgebildet. Nun sagt aber unser Direktor: „Du musst mal sehen, ob Du nicht hier und dort jemanden rausnehmen kannst.“ Ich sage: „Warum denn?“ – „Naja, weil der sowjetische Genosse Marschall daran Anstoß genommen hat.“ Ich sage: „Na und! Diese Ausstellung haben sich jetzt schon Tausende angeguckt, und niemand hat daran bisher Anstoß genommen.“ Also, mir erschien diese Diskussion absurd.
Die Ausstellung handelte aber nicht nur vom Nationalsozialismus, sondern eben auch vom antifaschistischen Widerstand …
Richtig. In diese Ausstellung eingebettet waren nun Abschnitte über den Widerstand, beispielsweise über den Spanischen Krieg …
…,der in der Bundesrepublik „Spanischer Bürgerkrieg“ hieß und in der DDR meistens „Spanischer Befreiungskampf“ genannt wurde.
Das wirklich gute Buch darüber war von Ludwig Renn und hieß einfach „Der Spanische Krieg“. Aber es kann sein, dass wir die Ausstellung, die wir dann 1966 eigens zu diesem Krieg gemacht haben, „Der Spanische Befreiungskampf“ genannt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Wort „Bürgerkrieg“ wurde bei uns jedenfalls nicht verwendet, das ist richtig.
Welche Emigranten haben Sie bei der Vorbereitung der NS-Ausstellung in den Jahren ’62/’63 beispielsweise besucht?
In meinem Notizbuch hier (Materna blättert in seinem Büchlein) stehen Leute wie Otto Korfes, der zu den Stalingrader Generalen gehört hatte und dann im Nationalkomitee Freies Deutschland aktiv gewesen war. Hier stehen Namen wie Fred Zimmering, der in der Emigration in England gewesen war, dann lese ich hier Hans Siebert, Eva Schmidt, Arnold Zweig, Georg Knepler, Nathan Notowicz, Ludwig Renn. Die haben wir besucht und gebeten, etwas Charakteristisches aus ihrer Emigrationszeit zu unserer Ausstellung beizusteuern. Leider habe ich meist nur die Adresse und die Telefonnummer aufgeschrieben. Hier sehe ich gerade, dass zum Beispiel bei dem 99jährigen Professor Hauser aus Dresden etwas mehr Informationen stehen, ansonsten finden sich hier eben Namen, aber die Aufzeichnungen dazu sind eher spärlich.
Ihnen ging es also vor allem darum, von den Gesprächspartnern etwas für die Vitrine zu bekommen.
So ist es. Ich habe mich in der Vorbereitung auf unser jetziges Gespräch übrigens mit den beiden damaligen Mitarbeitern unterhalten, die mit mir bei Ernst Busch waren. Sie waren sich nicht mehr ganz sicher, was Busch uns damals mitgegeben hat. Nach meiner Meinung haben wir von ihm eine Platte mit Spanienliedern bekommen. Diese Platte hatte er wohl ’38 in Barcelona aufgenommen. Die Platte war dann zusammen mit den anderen Exemplaren dieser Produktion von Spanien nach Antwerpen gelangt, wo Busch nach seiner Rückkehr aus dem Spanischen Bürgerkrieg anscheinend Veranstaltungen machte. Die Platten sind aber nicht mehr auf den Markt gekommen, sondern lagen lange Zeit in einem Schuppen in Antwerpen. Busch hat sie irgendwann später nach dem Kriege aus Belgien erhalten. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir diese Schallplatte, die er zusammen mit der Verpackung aus Karton dem Museum zur Verfügung gestellt hat, behalten durften. Wenn ja, müsste es heute noch im Archiv des Deutschen Historischen Museums einen Nachweis darüber bei den Legenden geben. Da müssten Sie mal nachfragen. Es kann aber auch sein, dass wir diese Kartonhülle für die Ausstellung nachgebildet haben. Diese Hülle war, so weit ich mich erinnere, mit grünem Leinen bezogen, und vorne drauf war der rote Dreistern der Internationalen Brigaden. Zur Zeit unseres Besuchs war Busch jedenfalls mit der Produktion neuer Spanienplatten beschäftigt, die auf dem Label Aurora erschienen. Und da muss wohl etwas schief gegangen sein. Denn Busch zeigte uns gleich zu Beginn unseres Gesprächs ein Cover und fragte uns streng: „Was ist hier verkehrt?“ Wir hatten keine Ahnung, was er meinte. Er klärte uns dann auf, dass „Canciones de las Brigadas Internacionales“ falsch geschrieben sei, „Internacionales“ war in der Mitte mit „t“ geschrieben. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für Busch, über so etwas konnte er sich mächtig aufregen!
Türöffner Alfred Meusel: Der Besuch im Hause Busch 1963
Welche Erinnerungen haben Sie sonst noch an das Gespräch mit ihm? Wie hat sich Ihr Besuch bei Busch denn abgespielt?
Also, Ernst Busch wohnte damals in Pankow in der Heinrich-Mann-Straße 16. Seine Telefonnummer habe ich hier auch noch stehen: 48 57 02. Wir erschienen also Anfang des Jahres ’63 an einem Vormittag, etwa gegen neun Uhr, zu dritt im Hause Busch und blieben zwei bis drei Stunden dort. Eigentlich haben wir überhaupt nur Eintritt bei ihm gefunden, weil wir Meusel-Schüler waren. Es war nämlich schon schwierig, zu ihm zu kommen. Busch war in dieser Zeit eher öffentlichkeitsscheu. Erst als er hörte, dass wir nicht von der „Jungen Welt“ sind, sondern aus Alfred Meusels Museum, konnten wir ihn besuchen. Busch hatte nämlich 1960 zusammen mit Alfred Meusel im Regierungskrankenhaus in Buch gelegen. Warum Busch dort gewesen ist, weiß ich nicht, Meusel war wegen seiner Herzgeschichten dort und ist nicht mehr lebend rausgekommen. Er starb im September1960, ich habe seine Urne beigesetzt. Jedenfalls rührte die Bekanntschaft der beiden von ihrem gemeinsamen Krankenlager im Regierungskrankenhaus her. Busch erzählte uns, dass Meusel und er sich, dem Ort ihres Zusammentreffens angemessen, tüchtig über die Regierung unterhalten hätten. Das hätte ich hören mögen, was die beiden da gesprochen haben. Busch erklärte uns dann, dass es eine weitere Verbindung zwischen ihm und Meusel gebe, nämlich die Teilnahme an der Revolution 1918 in Kiel. Busch lag damals angeblich mit einem Maschinengewehr hinter einer Litfaßsäule oder so, aber das wollen wir mal dahingestellt sein lassen …
Hat Busch das erzählt? Ich meine, das mit dem Maschinengewehr?
Natürlich. Diese Erzählungen waren aber nicht allzu überraschend für uns. Auch Meusel hatte oft wenig zimperliche Geschichten von der Revolution 1918 in Kiel erzählt, wobei ich mich nicht erinnern kann, dass in diesen Geschichten Ernst Busch vorkam. Aber in Buschs Erzählung von der Revolution kam nun auch Meusel vor.
Also hat Busch sich mehr oder weniger in gemeinsamer Aktion mit Meusel in Kiel 1918 dargestellt?
Gewissermaßen, ja. Ich vermute allerdings, dass die beiden sich tatsächlich erst 1960 im Krankenhaus richtig kennengelernt haben und in Kiel keinen oder kaum Kontakt gehabt hatten. Unser Anknüpfungspunkt im Gespräch mit Busch war nun aber der Krieg in Spanien. Wir trugen ihm unser Anliegen vor, das darin bestand, Fotos aus diesem Krieg zu bekommen, die noch nicht allgemein bekannt waren. Die Bilder, auf denen Ernst Busch mit Egon Erwin Kisch und anderen zu sehen war, die kannte man ja allgemein. Wir wollten auch andere Abbildungen präsentieren. Busch hat uns dann, für uns völlig unerwartet, Fotos von Maria Osten und Michail Kolzow gezeigt und uns von deren Schicksal erzählt. Wir wussten nicht, dass die beiden Journalisten Opfer des stalinistischen Terrors geworden waren. Wir wussten natürlich von den ungeheuerlichen Dingen, die in der Sowjetunion passiert waren. Aber was Busch uns über Osten und Kolzow berichtete, war völlig neu für uns. Bei der Gelegenheit hat er uns nun gleich seine ganze Auffassung über Stalin vorgetragen, dass das natürlich ein Unmensch war und dass das ganze Regime im Grunde genommen zu verurteilen gewesen wäre. Wir haben ihn allerdings nicht gefragt, seit wann er diese Ansichten hat.
Opfer stalinistischen Terrors: Maria Osten und Michail Kolzow
Haben Sie sich nicht gewundert über diese Aussagen eines Mannes, der Stalin besungen hatte?
Nein, wir haben uns nicht gewundert. Wissen Sie, das Wundern hatten wir uns schon frühzeitig abgewöhnt. Und was sich heute vielleicht paradox anhören mag, war uns ein alltägliches Phänomen. Wir waren durchaus kritische Sozialisten in dem Sinne, dass wir zwar der Meinung waren, man müsse eine neue Gesellschaftsordnung errichten, aber natürlich nicht so, wie das in der Sowjetunion praktiziert worden war. Ich hatte zum Beispiel eine Bekannte, die 1956 als Mitarbeiterin ans Museum kam und deren Mann beim kommunistischen Sicherheitsapparat bei Hans Kippenberger gewesen war. Diese Frau hatte erst ’55 aus der Sowjetunion zurückkehren dürfen, wobei man in der DDR gerne zu erwähnen vergaß, dass es Adenauer gewesen war, der den Weg für die Freilassung dieser letzten deutschen antifaschistischen Emigranten geebnet hatte. Diese Frau nun, die Jahrgang 1905 war und ursprünglich aus dem Saarland kam, hat mal zu mir gesagt: „Ingo, du kannst dir nicht vorstellen, was in den Lagern in Kasachstan und Sibirien, in denen ich war, passiert ist – schlimmer kann es in Ravensbrück nicht gewesen sein!“ Also, wir wussten das. Aber natürlich war es immer wieder neu und beeindruckend für uns zu erleben, wenn einer wie Busch diese stalinistischen Verbrechen und vor allem den Umgang mit diesem Thema in der DDR anprangerte. Er sagte damals sinngemäß zu uns: „Solange Leute wie Osten und Kolzow nicht offiziell rehabilitiert sind und über das, was ihnen passiert ist, nicht in aller Öffentlichkeit gesprochen werden kann, können die mich alle mal gern haben!“
Hat Busch den Eindruck erweckt, sich mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben, also mit dem stalinistischen Terror?
Er hat nicht wörtlich von „Terror“ gesprochen. Aber er hat mindestens von den Opfern des stalinistischen Regimes gesprochen, das weiß ich noch. Für ihn standen sicherlich konkrete Einzelschicksale im Vordergrund, aber er hatte längst das schreckliche Phänomen dahinter erkannt und hat das auch klar benannt. Wissen Sie, wir kannten ja die Gerichtsreden von Andrej J. Wyschinski aus den 30er Jahren, die Anfang der 50er Jahre in der DDR erschienen waren. In diesen Reden stehen ja all diese schrecklichen Vorwürfe an die angeklagten sowjetischen Funktionäre drin, und keiner von uns konnte ehrlichen Herzens glauben, dass diese Vorwürfe viel mit der Wahrheit zu tun hatten. Diese Begründungen und diese Redensarten, die Wyschinski führte, waren ja nicht weit weg von Freisler: „Ich beantrage, dass man die Angeklagten wie tolle Hunde erschießt!“ – Was ist da der Unterschied zu Freisler? Und diese Schriften standen ja bei uns in jeder Bibliothek.
Hat Busch Ihnen erklärt, warum er 1937 von Moskau nach Spanien gegangen ist?
Er hat gesagt: „Ich musste dahin, wo etwas passierte.“ Und Spanien war für ihn ein Hoffnungsblick.
Haben Sie ihn konkret danach gefragt?
Ja, wir haben ihn gefragt, warum er nach Spanien ging. Und er hat sinngemäß geantwortet: „Da ging ich hin, weil da etwas passierte und weil Hoffnung bestand, dass wir dort den Hitler, den Mussoloni und den Franco schlagen können. Wir dachten, wir könnten dadurch einen Wandel auch in den westlichen Ländern zu Gunsten des Antifaschismus durchsetzen. Natürlich waren wir voller Illusionen!“ Das hat er mehrmals gesagt, dass er voller Illusionen gewesen sei. Im Übrigen wissen Sie ja sicherlich: Von seiner Grundauffassung her war er ein anarchistischer Sozialist.
Würden Sie sagen?
Ja, würde ich sagen.
Ernst Busch und die SED – Parteiüberprüfung 1950/51
Wie kommen Sie drauf?
Naja, weil er sich zum Beispiel diesen parteidogmatischen Auffassungen niemals gebeugt hat. Er hat uns in diesem Gespräch auch gesagt, dass man ihm 1951 sein Parteibuch nicht zurückgegeben hat. 1950/51 waren ja diese Parteiüberprüfungen: Da wurden Leute aussortiert, die gegen die Oder-Neiße-Grenze waren, die in der westlichen Emigration gewesen waren oder die nicht plausibel erklären konnten, warum sie eigentlich das KZ überlebt hatten, das gab es tatsächlich: dass Leute sich rechtfertigen mussten, warum sie es nicht bis zum Tode geschafft hatten, sag ich jetzt mal etwas ironisch. Er selbst hat sein Buch nicht zurückbekommen, weil er sich über Stalin und die späten 30er Jahre in der Sowjetunion kritisch geäußert hat.
Er wollte wohl bestimmte Fragen beantwortet haben.
Er wollte Fragen beantwortet haben, und zu uns hat er gesagt: „Wenn sie hierher kommen und mir das Buch wiederbringen, bin ich einverstanden. Aber ich gehe es mir nicht abholen, und ich bezahle auch nicht den Beitrag nach!“ Das weiß ich noch ganz sicher, dass er das mit dem Beitrag gesagt hat. Das haben mir meine Kollegen auch neulich noch bestätigt, als ich ihnen angedeutet habe, was ich Ihnen sagen werde.
Ihnen hat Busch gesagt, dass sein Parteibuch einbehalten wurde?
Ja, so ist es mir in Erinnerung. Er sagte, sie hätten ihm das Parteibuch nicht wiedergegeben. Und er würde es wieder nehmen, aber nur, wenn sie es ihm ins Haus brächten und damit sozusagen ihre Fehleinschätzung zurücknähmen. Aber den Beitrag nachzubezahlen käme nicht in Frage! Als weiteren Themenkomplex haben wir ihn gefragt, seit wann er eigentlich ein bekannter Mann gewesen ist. Da sagte er: „Naja, meine brillante Karriere begann ja schon Ende der 20er Jahre als Liebhaber in Ufa-Filmen.“ Er hat uns dann Fotoalben vorgeblättert, wo er mit bekannten Schauspielerinnen aus dieser Zeit zu sehen war. „Die Karriere stand mir offen“, sagte er, „aber da gehören wir ja nicht hin!“ Und dann hat er sich mit zum Teil drastischen Worten von dieser Liebhaber-Sphäre distanziert. Das wäre ja nicht das gewesen, was auf sein Leben passen würde.
Aber offenbar hat er Wert darauf gelegt, Ihnen einiges aus dieser Sphäre zu zeigen …
Darauf hat er Wert gelegt, und ich glaube, dass es ihm durchaus sehr gut gefallen hat, dass er schon in der Weimarer Republik eine bekannte Persönlichkeit war. Er war wohl auch eine zeitlang so etwas wie ein Frauenschwarm gewesen. Ich weiß nicht genau, die wievielte längere Lebensgemeinschaft er zur Zeit unseres Gesprächs hatte, ich glaube, es war die dritte. Seine Frau Irene kam jedenfalls irgendwann herein und guckte. Busch sagte: „Sie guckt, weil ich schon wieder viel zu viel quatsche!“ Sie hatte wohl ein bisschen Sorge um seine Gesundheit, und damit war das Gespräch im Übrigen auch beendet: Nachdem sie gekommen war, war es Zeit geworden für uns zu gehen. Vielleicht hing unser Aufbruch auch damit zusammen, dass das Mittagessen fertig war.
„Wer ist der größte sozialistische Dichter?“: Busch-Anekdoten
Wie war insgesamt die Atmosphäre bei dem Gespräch?
Sehr locker und sehr vertraulich. Er hat sich über viele Dinge geäußert, über die man sich sonst in der Öffentlichkeit nicht äußerte. Deutlich war seine Distanz zu Ulbricht und dieser damals herrschenden Politschicht. Meiner Meinung nach war das eindeutig. Unter anderem kam das darin zum Ausdruck, dass er sich äußerte über die Einschätzung von Brecht und Becher, das war damals ein Thema. Ulbricht hatte Becher, ich glaube: im Zusammenhang mit dessen Tod 1958, zum größten sozialistischen Dichter erklärt oder zum größten Dichter der sozialistischen Periode oder so etwas. Die genaue Formulierung weiß ich nicht mehr. Aber Busch nahm darauf Bezug und meinte, das sei eine typische Fehleinschätzung, und man könne das in keiner Weise unterschreiben. Und er sagte: „Als wir mit dem Berliner Ensemble in England waren, gab es bei Lord Soundso einen Empfang, und alle sollten sich im ersten Stock einfinden. Da hab ich mich erst mal unten an die Treppe gestellt und jeden, der da ankam, gefragt: ’Wer ist der größte sozialistische Schriftsteller?’ Und wer nicht ’Brecht’ sagte, kam gar nicht erst rauf.“ Das war so eine typische Busch-Geschichte. Den Namen dieses englischen Lords weiß ich nicht mehr, das war offenbar der Sponsor dieses BE-Gastspiels in England. Busch gab noch eine zweite Episode in dieser Richtung zum Besten: Damals lief ja gerade die zweite Bitterfelder Konferenz, bei der es um die Verbindung von Künstlern und Arbeitern ging. Und passend dazu erschien in der DDR-Gewerkschaftszeitung „Tribüne“ ein Artikel von vier Frauen aus dem Elektroapparatewerk (EAW) Berlin-Treptow, das früher übrigens EAW „Stalin“ geheißen hatte. Der Artikel muss etwa 1962 erschienen sein, jedenfalls war das Werk bereits umgetauft worden. Nun beschwerten sich diese vier Frauen ganz im Sinne des „Bitterfelder Wegs“ über den unsozialistischen Spielplan der Berliner Theater. Es wären keine sozialistischen Stücke zu sehen, immer nur Klassik und Weiß-der-Deubel-was und bestenfalls noch Brecht und mehr nicht. Und da hat der Busch zu uns gesagt: „Wisst Ihr, was dann passiert ist? Die Helene Weigel hat diese vier Frauen aus dem EAW eingeladen zu einem Gespräch über die Spielpläne der Berliner Theater. Und da stellt sich heraus, dass die vier Frauen den Artikel natürlich gar nicht geschrieben haben. Der Journalist von der ’Tribüne’ hat den Artikel geschrieben und die vier Frauen als sein Sprachrohr benutzt. Und es zeigt sich, dass die Frauen überhaupt keine Theaterbesucher sind, die kennen kein einziges Theater von innen. Da hab ich zur Heli gesagt: Weißt Du was, die lade ich zur nächsten Sonntags-Matinee ins Deutsche Theater ein. Da werden die in die erste Reihe gesetzt, und bevor es losgeht, stelle ich mich vor den Vorhang und sage: Wir haben heute vier Frauen aus dem Berliner EAW zu Gast, die jüngst die Spielpläne der Berliner Theater kritisiert haben, zu Recht oder zu Unrecht: Ich freue mich, dass sie heute hier sind, sie sind heute überhaupt zum ersten Mal in einem Berliner Theater!“ Heli sei von diesem Vorschlag ganz angetan gewesen, meinte Busch, „aber die beiden Wolfgänge mit ihren spitzen“, oder sagte er: „dicken Ärschen“, er meinte Wolfgang Heinz und Wolfgang Langhoff, die Intendanten, hätten keine Courage gehabt, so etwas zu machen. Das ist typisch Busch gewesen.
Aber sind solche Erzählungen nicht in gewisser Weise typisch für Bühnenmenschen überhaupt?
Mag sein, aber bei Busch gab es, ich muss das noch mal wiederholen, diesen Hang zum Anarchistischen. Er scherte sich nicht um Regeln, Konventionen und politische Empfindlichkeiten. Es war wohl, das ist richtig, auch eine gute Portion Schalk und Lust am Spielen dabei. Eine letzte Anekdote, die das illustriert, fällt mir noch ein. Er hat uns von einer Matinee erzählt, ich glaube, es ging um Tucholsky, bei der auch Karl Kleinschmidt auftreten und sprechen sollte. Kleinschmidt war Domprediger in Schwerin und organisierte den Kulturbund in Mecklenburg und machte allgemein in Kultur und Literatur. Und er war mit Busch befreundet. Jedenfalls hatte sein Zug aus Schwerin Verspätung, und die Matinee musste ohne ihn anfangen. Busch sagte zu uns: „Da bin ich dann auf die Bühne und hab gesagt: Der Karl Kleinschmidt hat natürlich wieder mal Verspätung, der Zug ist nicht pünktlich. Nun werde ich Ihnen mal erzählen, was Kleinschmidt zu sagen hat!“ Dann hat der Busch erst mal den Teil von Kleinschmidt vorgetragen, zwischendurch kam der Kleinschmidt, dann hat Busch gesagt: „So, jetzt ist Karl da, dann kann er ja hier übernehmen. Karl, komm her, mach mal weiter hier, das und das hab ich schon gesagt …“ Also, das meinte ich, als ich sagte: Das ist typisch Busch. Selbst in solchen Dingen war er, wenn man so will, nicht ein kleiner, sondern ein großer Komödiant … Ich glaube, dass es ein Wesenszug von Busch war, dass er mit festgeklopften Abläufen nichts anfangen konnte.
Zum Schluss würde mich noch interessieren, wie Sie und Ihre Kollegen nach Ihrem Besuch bei Busch mit den erhaltenen Informationen und gehörten Geschichten umgegangen sind? Wurden sie vertraulich behandelt oder zumindest im privaten Kreis weiter erzählt oder flossen sie gar in irgendeiner Weise in die Arbeit des Historikers ein?
Zu verschiedenen Anlässen, zum Beispiel wenn die neuen Platten mit den alten Liedern bei Aurora neu erschienen, gab es unsere Busch-Berichte als „Zubrot“. Das geschah meist in der Familie oder im Kollegenkreis, mitunter auch vor Studenten oder bei Vorträgen über die „Arbeiterkultur“ in den 20er Jahren oder wenn es um die Widersprüche und die Kultur in der DDR vor dem Juni 1953 ging. Natürlich sprachen wir immer über „unseren Busch“, denn das war und blieb er für uns. Für uns war er nicht der „Barrikaden-Tauber“, ich weiß auch gar nicht, wer das eigentlich erfunden hat …
Letzte Frage: Haben Sie ein Lieblingslied von Busch?
Meine Lieblingslieder von ihm sind vor allem die Tucholsky-Vertonungen von Eisler und die politischen Massengesänge mit den Texten von Brecht. Auch die Spanienlieder, die Busch ja zum Teil selbst getextet hat, gefallen mir. Als einzelnes vielleicht: „Wenn die Igel in der Abendstunde …“.
Interview: Jochen Voit
Foto: privat
(Interviewfassung autorisiert von Prof. Dr. Ingo Materna am 12.9.2006)

Hans Christian Nørregaard
über seine Arbeit als dänischer Rundfunkreporter in der DDR und seine Begegnungen mit Ernst Busch
„Busch, Biermann, Dylan, das sind ja Individualisten und Provokateure. Ich mag Leute, die ab und zu mit dem Rücken zum Publikum spielen, wie Miles Davis: Ihr könnt mich ...“
(Gespräch am 25. Mai 2005 in Berlin)
Hans Christian Nørregaard ist Jahrgang 1943. Er wächst in Åbenrå (deutsch: Apenrade) in Dänemark auf. Die Eltern sind „kleinbürgerliche Provinzler“, wie er sagt. Der Vater ist Vertreter in einer Eisen- und Stahlfirma, die Mutter Hausfrau. Nørregaard besucht das Gymnasium und vervollkommnet seine Deutschkenntnisse nebenbei durch das westdeutsche Fernsehen, das er zu Hause empfangen kann. Durchs Fernsehen wird er auch auf den Dramatiker Brecht aufmerksam, während er sich sonst – auch publizistisch – für den amerikanischen Jazz interessiert. Nach dem Abitur zieht er nach Kopenhagen, wo er Literatur und Germanistik studiert. Im Jahr 1963 reist er zum ersten Mal nach Ost-Berlin, um mit Helene Weigel zu sprechen und im Brecht-Archiv zu arbeiten. Durch ein Stipendium der Freien Universität in West-Berlin 1965/66 kann er diese Arbeit fortführen; zeitgleich beginnt er, für Danmarks Radio als Kulturkorrespondent zu arbeiten. Am Rand der Proben zur „Ermittlung“ von Peter Weiss lernt er Ernst Busch in Ost-Berlin kennen und versucht, ihn für ein Radio-Interview zu gewinnen. 1967 kommt es dann zu einem längeren Gespräch bei Busch zu Hause. Doch bei keinem der beiden Besuche gelingt es Nørregaard, sein mitgebrachtes Tonbandgerät zum Einsatz zu bringen. Nørregaards Tätigkeit als Co-Regisseur eines Fernsehfilms im Jahr 1968 über das Kulturleben in der DDR („Wir waren die erste dänische Fernseh-Crew in der DDR überhaupt!“), bei dem Wolf Biermann und Robert Havemann illegal mitwirken, unterbricht seine Verbindung mit Busch. Im März 1976 schließlich kann sich Nørregaard einen langjährigen Wunsch erfüllen und eine Dokumentation über Ernst Busch fürs dänische Fernsehen drehen. Gefilmt wird vom 10. bis zum 15. März im Schallplattenstudio in der Brunnenstraße und bei Busch zu Hause in Niederschönhausen. Die fertige Sendung bekommt den Titel: „Sådan gik min tid på jorden“ – Ernst Busch og hans århundrede („So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war“ – Ernst Busch und sein Jahrhundert). Sie läuft am 7. November 1976 erstmals im dänischen Fernsehen; zum 80. Geburtstag Buschs wird sie unter dem Titel „Ernst Busch und sein Jahrhundert“ auch in der ARD gezeigt.
Nørregaards Dokumentation läuft zwischen 1976 und 1979 fünfmal im Fernsehen, und zwar in Dänemark, Schweden, Norwegen, der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden. In Buschs Todesjahr 1980 wird sie erneut fünfmal ausgestrahlt: in den Niederlanden, der Schweiz und dreimal in der Bundesrepublik. Im DDR-Fernsehen wird die Sendung nicht gezeigt. Ernst und Irene Busch sehen die Sendung erstmals im westdeutschen Fernsehen an Buschs 80. Geburtstag, darauf schreibt Irene Busch am 31. März 1980 an Nørregaard: „Da Ihr Film nicht nur über ARD gesendet wurde sondern auch in Belgien und Holland zu sehen war, kam eine große Resonanz aus diesen Ländern zu uns. Zu Holland kann man echt sagen, dass die Holländer ihren Busch wieder neu entdeckt haben.“ (Ernst-Busch-Archiv, o.S.)
Hans Christian Nørregaard ist überdies Autor einer zehnteiligen Rundfunkserie über Ernst Busch: „Fra kejser til kaos“ (zu deutsch: „Vom Kaiser bis zum Chaos“) 1970. Nørregaard ist ein international anerkannter Brecht-Forscher, der auch in deutscher Sprache veröffentlicht. Zurzeit arbeitet er an einem umfangreichen Buch über Bertolt Brecht und Dänemark. Nørregaard lebt in Kopenhagen.
JV: Sie sind 30 km nördlich der deutsch-dänischen Grenze aufgewachsen. Inwiefern hat das Ihren Blick auf die beiden Teile Deutschlands geprägt?
Hans Christian Nørregaard: Wir lebten am Rande Dänemarks. Etwa 1959 wurde ein Sender in Flensburg gebaut, seitdem konnten wir neben dem dänischen Fernsehen auch die ARD sehen. Die DDR – die SBZ, die Zone, das Pankower Regime oder sogar Mitteldeutschland, wie das damals genannt wurde – wurde ja vom westdeutschen Fernsehen direkt verteufelt, besonders nach dem Bau der Mauer. Aber auch bei uns in Dänemark. Die Luftbrücke 1949 und der Arbeiteraufstand 1953, das passierte ja alles kurz nach dem Krieg und der Besetzung. Die Deutschen hatten den Krieg verloren und Millionen von Menschen ausgerottet und waren selber an ihrem Unglück schuld. Aber 1961 haben die vom Mauerbau betroffenen Deutschen, die Leute, die aus den Fenstern sprangen, die Herzen gewonnen. Und Kennedy hat mit seiner „Ich bin ein Berliner“-Rede diese Stimmung noch konsolidiert. Dazu kam bei uns, dass Willy Brandt, damals Regierender Bürgermeister von Westberlin, in Interviews mit dänischen Medien immer norwegisch sprach, was für Dänen unmittelbar verständlich ist. Die DDR war kein Land, wo man freiwillig hinfuhr. Kurz nach dem Abitur war ein Mitschüler von mir für einige Stunden in Ostberlin und hat mir nachher berichtet, er habe auf der Straße irgendjemanden etwas gefragt, etwas völlig Belangloses, und der habe nach kurzer Zeit das Gespräch abgebrochen mit dem Argument, es sei für ihn zu gefährlich mit einem Westler gesehen zu werden. Solchen Blödsinn habe ich gehört, nicht nur in den Medien, sondern auch von Bekannten.
Bereits als Schüler haben Sie angefangen, sich für Brecht zu interessieren. Wodurch kam dieses Interesse?
Über einen Umweg: Durch „Mack the Knife“ von Louis Armstrong.
Haben Sie den Song damals im Radio gehört?
Natürlich, aber auch bei Konzerten. Armstrong gab damals, wenn er nach Kopenhagen kam, auch Konzerte in den größten Provinzstädten Dänemarks: 1959 in Odense, da war ich noch ein kleiner Schuljunge. Aber im Jahr danach, in Århus, habe ich ein Interview mit ihm machen können, das ich an verschiedene Zeitungen verkaufte. Er war nicht länger der große Instrumentalist, aber als Sänger noch fabelhaft. Er hat ja auch das Singen und die Schönheit des Singens völlig revolutioniert wie etwa Picasso das Malen.
„Brecht hat Armstrongs ‚Mack the Knife‘ gehört und großartig gefunden.“
Sind Sie dann durch Armstrong zur „Dreigroschenoper“ gekommen?
Nein, gar nicht. Die Fünfzigerjahre waren eine sehr verklemmte Epoche, wo fast nichts los war. Darum wurde ich vom Jazz enorm fasziniert, auch weil das eine so junge Musik war, dass sämtliche Entwicklungsstufen damals noch durch authentische Solisten vertreten waren. Von den Bluessängern aus dem Mississippi-Delta bis zur Avantgarde. Als ob man im selben Jahr die Minnesänger, Bach, Mozart und Stockhausen hätte live erleben können. Wobei ich den Jazz nie nur konsumiert, sondern auch als Ausdruck einer unterdrückten Rasse empfunden habe. Ich habe sehr früh eine Menge darüber gelesen, Bücher und Zeitschriften, auf Englisch natürlich. Ich machte eine Verabredung mit einer recht großen Zeitung, Jyllands-Posten, die vor einigen Jahren auf traurige Art weltberühmt wurde, weil sie diese blöden Mohammed-Karikaturen brachte. Und die Interviews gaben mir die Legitimität, mich mit diesen Menschen eingehend zu unterhalten. Die Mitglieder der Avantgarde waren Wegbereiter der Bürgerrechtsbewegung, des ganzen Aufbruchs in den USA. Am frühen Nachmittag fuhr ich manchmal zu den wichtigsten Konzerten in Kopenhagen und konnte mit dem Nachtzug gerade die zweite Unterrichtsstunde schaffen. Ohne Schlaf. Wenn ich von den Lehrern nach dem Grund meines Ausbleibens in der ersten Stunde gefragt wurde, und ich dann sagte, ich komme direkt aus Kopenhagen, bekam ich keine Anmerkung. Das hat ihnen imponiert. Ich machte also Interviews mit den bedeutendsten Musikern und war auch mein eigener Pressefotograf. Dadurch habe ich Reisen und Spesen finanzieren können. Unter denen, die ich sprach und fotografierte, war auch der bedeutendste unter den Avantgardisten, den ich heute noch sehr verehre und oft auf CDs höre, der Sopran- und Tenorsaxofonist John Coltrane, auf dessen Errungenschaften fast alle Saxofonisten noch bauen, ohne sein Niveau zu erreichen. Leider starb er schon 1967, nur 40 Jahre alt. Heute kann man ein ganzes Buch über Coltrane aus marxistischer Sicht kaufen, wo er als Rebell gefeiert wird. Privat war er ein sanfter, gütiger Mensch. Das eine schließt das andere nicht aus.
Louis Armstrong war dagegen eher der Spaßmacher …
Weil er sich bei einem weißen Publikum durchsetzen musste. Da nahm er eben auch Sachen wie „Mackie Messer“ in sein Programm auf. Kennen Sie den ganzen Hintergrund?
Nein.
Nach jahrzehntelangem Basteln war es endlich gelungen eine fast kongeniale englische Übersetzung der „Dreigroschenoper“ hervorzubringen. Ein Librettist und Komponist, Marc Blitzstein, ein Linker, der Brecht gekannt hatte, hat das geschafft. „The Threepenny Opera“ wurde mit Lotte Lenya, der Witwe Kurt Weills, in New York der längst fällige Durchbruch Brechts auf dem amerikanischen Kontinent. Ein Plattenproduzent kam auf die Idee, „Mack the Knife“ als Duett von Lenya und Louis Armstrong in einem Studio aufzunehmen. Im September 1955 war das. Das klappte aber nicht, ihre Stimmen vertrugen sich nicht. Sicherheitshalber machte man dann eine Aufnahme mit Armstrong allein und schickte die auf den Markt, worauf sie ein Welterfolg wurde. Glücklicherweise wurden die misslungenen Aufnahmen nicht gelöscht. Das Duett Armstrong-Lenya wurde archiviert. Und eine acht Minuten lange, immer wieder unterbrochene Version, wo Armstrong freundlich, mit großer Autorität, aber vergeblich versucht, Lenya das „Swingen“ beizubringen. Gibt es heute alles auf CD. Kurz vor seinem Tod hat Brecht Armstrongs „Mack the Knife“ gehört und es großartig gefunden. „Das ist ein Neger,“ hat er in Ostberlin den staunenden Mithörern erklärt. Armstrong erzählte später – leider nicht mir – dass ihm alles, was der Song berichtet, von Kindheit an vertraut war. Er war ja unter Räubern, Messerstechern, Huren und Zuhältern aufgegewachsen. Seine Mutter hat sich verkaufen müssen, wenn sie kein Geld hatte. Ich halte noch Armstrongs „Mackie Messer“ für den besten überhaupt. Auch wegen des morbiden Humors ist er der ideale Moritatensänger.
Ich wusste nicht, dass Brecht seine Version noch gehört und gut gefunden hat …
Ich habe mich immer für musikalische Verbindungen interessiert. Quer durch die verschiedenen Kulturen und Genres. Ich bin weder Purist, noch Puritaner. Jahre später, als Lotte Lenya mit der „Seeräuberjenny“ weitermachte, hatte der blutjunge, damals völlig unbekannte Bob Dylan eine Freundin, die mit der Vorstellung zu tun hatte. Und von der „Seeräuberjenny“ inspiriert schrieb Dylan dann „When the Ship Comes in“.
„Alles, was aus Westdeutschland kam, war direkt scheußlich.“
Die deutsche Kultur spielte damals für Sie keine Rolle?
Nein, überhapt nicht. Deutsch war eben nur ein Schulfach mit einer komplizierten Grammatik. Alles, was wir aus Westdeutschland bekamen, war direkt scheußlich. Die Schlager, die Berg- und Heimatfilme, die ganze Verdrängung nach dem Krieg. Weil ich mich immer für Geschichte interessiert habe, verfolgte ich aber die politische Entwicklung sehr genau.
Auch durch das deutsche Fernsehen?
Eben. Weil das dänische Fernsehen noch in den Kinderschuhen steckte. Der kalte Krieg kam direkt in die gute Stube. Ich gehöre zur ersten Generation, die durch das Fernsehen geprägt wurde. Die ARD hat aber auch viele moderne Theaterstücke produziert, die man sonst in der dänischen Provinz nicht zu sehen bekam. Im Januar 1962 brachte man Brechts „Leben des Galilei“ in der Inszenierung des Brecht-Schülers Egon Monk. Ernst Schröder spielte die Titelrolle. Das war der große Augenöffner, fast eine Offenbarung. Ich wollte sofort alles über Brecht erfahren. Das ging also nicht über „Die Dreigroschenoper“.
Und dann wollten Sie unbedingt auch Ernst Busch als Galilei in Ostberlin sehen?
Nein, ich habe Busch nie als Galilei erlebt. Oder in einer Rolle überhaupt. Da bin ich zu spät gekommen. Er hatte sich schon vom Theater zurückgezogen.
„Im Brecht-Archiv durfte man damals rauchen und Brechts Kupferaschenbecher benutzen.“
Sie fuhren aber nach Ostberlin, um das Berliner Ensemble zu erleben?
Das schon, aber nur nebensächlich. Das war im Spätsommer 1963. Ich hatte mich per Brief mit Helene Weigel verabredet und wollte sie über das Exil in Dänemark 1933-39 ausfragen. Sie empfing mich in ihrem Büro im Berliner Ensemble. Ich konnte auch im Brecht-Archiv, wo man damals rauchen und Brechts Kupferaschenbecher benutzen durfte, die ganzen Rezensionen von Brechts Stücken 1936 in Kopenhagen und die Zeitungspolemik über seine Person durcharbeiten. Die Artikel hat er damals ausschneiden lassen. Das war eine Hetze wie bei den Nazis, und in Dänemark war das in der Zwischenzeit völlig verdrängt worden. Ich wohnte in Westberlin – drei Wochen, glaube ich – und fuhr fast jeden Tag rüber. Ich sah mir natürlich auch die Vorstellungen im Berliner Ensemble an. Also, was zufällig da lief. Die Weigel habe ich damals noch nicht auf der Bühne erlebt. Erst später.
„Arbeitersänger? Das kam mir ziemlich albern und DDR-konform vor.“
Und Ernst Busch?
Er war für mich noch kein Begriff. Aber in einem großen Schallplattengeschäft am Alexanderplatz konnte man die Platten mit den Liedern aus „Mutter Courage“ und „Die Mutter“ kaufen, die gab es schon auf Vinyl. Auch „Ami go home“, wo ich den Namen Hanns Eisler als Komponisten auf dem Label bemerkte. Da fragte ich die Verkäuferin „Wer singt denn da?“ – „Das ist doch der große Arbeitersänger Ernst Busch.“ Arbeitersänger? Das kam mir ziemlich albern und DDR-konform vor. Ich habe nicht „Ami Go Home“ gekauft, aber die anderen. Das Stück „Mutter Courage“ hatte ich schon gelesen, und die Musik dazu ist Paul Dessaus beste Arbeit, von dem Amateurmusiker Brecht bis ins letzte Detail geprägt, fast diktiert. Aber besonders Eislers „Mutter“-Lieder auf Schallplatten waren nach „Galilei“ im Fernsehen meine zweite grosse Offenbarung in Sachen Brecht. Das war auch meine erste bewusste Begegnung mit der Stimme von Ernst Busch. Da wollte mir plötzlich einer etwas. Und der argumentierte so klar und eindringlich, wie das auch von anderen, z.B. Heinar Kipphardt, beschrieben worden ist.
„Ich erreichte, dass die dänische Kabarettistin Lulu Ziegler „Die Ballade vom Wasserrad“ 1964 im Studio aufnahm.“
Was haben Sie mit Ihrem neu erworbenen Wissen angefangen?
Wieder zurück in Kopenhagen habe ich das Optimale aus diesem kurzen Besuch in Ostberlin herausgeholt. Im Westen stand die Brecht-Forschung ja überhaupt erst am Anfang. An der Uni konnte ich mit einem Aufsatz über den „Galilei“, der ja ursprünglich in Dänemark geschrieben war, fast triumphieren, obwohl mein Wissen damals aus heutiger Sicht recht mangelhaft war. Ich machte aber auch meine erste Rundfunksendung. 60 Minuten über Brecht in Dänemark, das war eine Pionierarbeit. Brechts einzige Uraufführung in Kopenhagen war „Die Rundköpfe und die Spitzköpfe“ gewesen, ein heute mit Recht selten gespieltes Stück, aber mit 3-4 klassischen Eisler-Liedern drin – Eisler war ja monatelang bei Brecht in Dänemark gewesen. Es gelang mir durchzusetzen, dass der damalige Star, eine recht berühmte Kabarettistin namens Lulu Ziegler, „Die Ballade vom Wasserrad“ im Studio aufnahm, und zwar begleitet von dem Pianisten, der 1936 die Orginalpartitur von Eisler für zwei Klaviere arrangiert hatte. Da sind wir bei dem Problem der Rekonstruktion. Die hatten das in der langen Zwischenzeit nie wiederholt und auch später nicht. Außerdem wollte die Ziegler das in der Originalsprache, also auf Deutsch, machen, während sie natürlich 1936 eine Übersetzung gesungen hatte. Man hätte sämtliche Lieder, jedenfalls die besten, aufnehmen sollen. Die Interpreten lebten 1964 alle noch. Aber das historische Bewusstsein tritt fast immer verspätet ein. Darum bleibt diese eine Aufnahme mit der Ziegler alles, was von den „Rundköpfen“ 1936 in irgendeiner Form überliefert ist. Ist denn das authentisch? Nein. Aber besser als gar nichts. Viel, viel besser. So war es auch mit Busch, wenn er die Mehring-Eisler-Lieder aus dem „Kaufmann von Berlin“ erst nach einem halben Jahrhundert aufnahm. Durch solche Sachen habe ich mich für ein Stipendium an der Freien Universität 1965-66 qualifizieren können.
„Yves Montand war damals der Liebling in der DDR und überhaupt im Osten.“
Sie gingen 1965 für ein ganzen Jahr nach Westberlin. Warum nicht nach Ostberlin?
Ich wollte meine Bewegungsfreiheit haben. Zum Beispiel sprach ich in einem Westberliner Studio Theaterrezensionen, die nach Kopenhagen gesendet wurden. Ich weiß nicht, wie das aus Ostberlin geklappt hätte. Ich kaufte mir auch mein erstes transportables Tonbandgerät, ein Uher Report. Das war eigentlich für Amateure, aber von so hoher Qualität, dass die Aufnahmen von den Rundfunkanstalten akzeptiert wurden. Das durfte ich ohne Tonbänder mit nach Ostberlin nehmen. Dort konnte man Bänder der Marke ORWO, Agfa Wolfen, kaufen. Wenn ich dort etwas aufgenommen hatte, habe ich die Bänder – die waren ja klein – unter dem Hemd versteckt. Ich wusste schon, Körperdurchsuchungen machen die nie. Es hieß nur: „Leeren Sie bitte ihre Taschen!“ Nicht, dass diese Aufnahmen besonders kontrovers gewesen wären. Es war nur leichter so, anstatt das durch die offizielle Kontrolle gehen zu lassen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hätte. Natürlich war das nicht erlaubt, aber eben leichter. Wenn ich aus dem Archiv des Berliner Ensembles Aufnahmen brauchte, dann machten sie Kopien. Die waren sehr hilfsbereit. Zum Beispiel von der „Resolution der Kommunarden“ mit Hilmar Thate. Die gab es noch nicht auf Schallplatte. Überhaupt gab es sehr wenige Schallplatten dort. Titel, meine ich. Denselben Titel konnte man aber in demselben Geschäft hundertmal kaufen. Vielleicht wegen der Planökonomie. Da war ja auch nur eine einzige Firma, VEB Deutsche Schallplatten. Da kaufte man sich alles, was auch nur von peripherem Interesse war. Eben damals fingen die Busch-Mappen von Aurora an zu erscheinen. Die kaufte ich mir natürlich und wartete ungeduldig auf die nächste. „Ami go home“ konnte man nicht länger kaufen, die habe ich damals verpasst. Jetzt wusste ich ungefähr, wer er war. Nicht seine ganze Biographie, aber dann erschien das Buch über ihn, zum größten Teil von Hugo Fetting. Am Anfang steht ein Artikel von Herbert Ihering, der Busch als Chansonnier mit Yves Montand vergleicht, was ich unzutreffend fand. Aber Montand war eben damals der Liebling in der DDR und überhaupt im Osten. Das hätte man später bei einem eventuellen Nachdruck ändern müssen, als er mit den Kommunisten brach. In Fettings langem Beitrag über Busch vernahm man auch etwas zwischen den Zeilen, was nicht völlig klar war. So war es ja generell in der DDR. Eine Menge Andeutungen.
„Wenn Busch auf einem Spanien-Label angibt, der Chor bestehe aus Veteranen der Interbrigaden, und man Jahrzehnte später erfährt, dass es sich in Wirklichkeit um den Chor des Hebbel-Theaters handelt, wovon viele ohne Zweifel in Hitlers Wehrmacht gedient haben, dann lacht man spontan, aber auch das macht nichts. Alle großen Künstler sind Manipulatoren. Der Hebbel-Theaterchor sang ohne Zweifel besser als die Spanien-Veteranen.“
Konnten Sie auch auf der anderen Seite, in Westberlin, Informationen über Busch und linkes deutsches Liedgut bekommen?
Von der Jazzwelt, die das schon zu einer Wissenschaft perfektioniert hatte, war ich mit diskographischen Erläuterungen verwöhnt. Das wann, wo und wer. Das war bei Busch und Aurora fast verschleiert. Zum Beispiel seine Spanien-Mappe: Etwas hört sich älter an, etwas völlig neu. Zur gleichen Zeit konnte man aber auf dem Kurfürstendamm in Westberlin die beiden LPs vom amerikanischen Folkways-Label mit Liedern aus dem Spanischen Bürgerkrieg kaufen. Da sind u.a. seine sechs authentischen Titel aus Barcelona drauf, und im Textheft gibt es genaue historische Informationen dazu. Folkways kannte ich bestens von zu Hause. Das war ein ausgeprägt linkes, idealistisches Unternehmen. Der Initiator war ein jüdischer Einwanderer aus Osteuropa, Moses Asch. Der hatte u.a. eine Riesenmenge an nichtkommerzieller amerikanischer Volksmusik, besonders der schwarzen, herausgebracht, die die großen Firmen links liegen gelassen haben. Das ist eben ein positiver Ausdruck des westlichen Pluralismus. Man kann alles für sein Geld bekommen, auch das Gute. Während das im Osten zentral gelenkt wurde, im Falle Busch ausnahmsweise von Busch selber. Aber die Ostberliner konnten sich nicht wie ich die Folkways-Platten kaufen und selber vergleichen. Immerhin war das interessant, was er alles herausbrachte. Auch alte Texte, neu komponiert. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden. Besonders nicht, wenn das von Eisler ist. Ich möchte nur wissen, dass es sich so verhält. Etwas davon hat Schärfe, etwas davon hat Charme. Zum Beispiel: „Man muss nicht mehr Rabindranath-Tagoren, / den haben wir beim Werfelspiel verloren.“ Das hat irgendetwas mit dem indischen Schriftsteller Rabindranath Tagore und seinem deutschen Kollegen Franz Werfel zu tun, aber worum handelt es sich genau? Ich habe Germanisten gefragt, auch Professoren. Die wissen es auch nicht. Klingt darum fast dadaistisch. Macht nichts. Bin nur neugierig. Wenn Busch auf einem Spanien-Label angibt, der Chor bestehe aus Veteranen der Interbrigaden, und man Jahrzehnte später erfährt, dass es sich in Wirklichkeit um den Chor des Hebbel-Theaters handelt, wovon viele ohne Zweifel in Hitlers Wehrmacht gedient haben, dann lacht man spontan, aber auch das macht nichts. Alle großen Künstler sind Manipulatoren. Der Hebbel-Theaterchor sang ohne Zweifel besser als die Spanien-Veteranen.
Erste Begegnung mit Busch: Uraufführung der „Ermittlung“ von Peter Weiss in Ostberlin am 19. Oktober 1965
Persönlich kennengelernt hatten sie Busch aber immer noch nicht. Wann haben Sie ihn zum ersten mal live auf der Bühne gesehen?
Also den Busch gab es noch irgendwo, da er ja weiterhin Platten besang und produzierte. Wenn er dann auch plötzlich selber auftrat, eilte ich natürlich hin, völlig egal was es war. Für den Rundfunk war ich sowieso bei der Uraufführung der „Ermittlung“, dem Auschwitz-Oratorium von Peter Weiss, in Ostberlin, in Westberlin dann bei Erwin Piscator und in Stockholm bei Ingmar Bergman. Das waren eben große Verhältnisse. In Ostberlin war das eine Lesung im Plenarsaal der Volkskammer am 19. Oktober 1965. Das war das erste Mal, dass ich Busch überhaupt live sah und hörte. Er hat sich große Mühe mit dem Text gemacht. Es fiel ihm nicht leicht. Er sprach ja einen der Zeugen. Diese Angespanntheit wurde aber eine Qualität, weil das nicht nur ein Schauspieler war, der da auftrat. Wie bei der Weigel, die auch eine Zeugin sprach. Und überhaupt diese ganzen „bewährten Antifaschisten“, wie das immer offiziell hieß. Nicht nur Theaterleute, auch Schriftsteller und andere Künstler. Das war sehr beeindruckend, das muss ich schon zugeben. Nur: Fast die Hälfte der Beteiligten hat elf Jahre später die Ausbürgerung von Wolf Biermann durch die Regierung öffentlich gebilligt.
Was Ihre Bewunderung für diese Leute geschmälert hat, vermute ich …
Kann man sagen … Dann habe ich Busch bei einem Festprogramm zum 20. Jahrestag der SED im Deutschen Theater gesehen, das war im April 1966. Er sang dort Lieder, meistens von Becher und Eisler, aber auch Weinert, Brecht, Mühsam. Das letzte Mal, dass ich ihn öffentlich sah, war bei einer Gedenkfeier für den Regisseur Erich Engel im Berliner Ensemble. Er las da zusammen mit Helene Weigel. Busch und Weigel waren ein unschlagbares Paar auf der Bühne. Sie saßen nebeneinander, es gibt Fotos davon, aber das Datum ist nirgends in der Literatur verzeichnet. Da Erich Engel am 10. Mai gestorben war, muss es also im Frühling 1966 gewesen sein. Auch dort sang er Mühsam-Lieder, wahrscheinlich, weil er die eben bereit hatte.
Wann kam es zum ersten persönlichen Kontakt?
Ich meine, ich nutzte die erste Gelegenheit und suchte ihn in der Volkskammer nach der „Ermittlung“ auf, also im November 1965. Backstage, sozusagen. Sagte, ich wollte gern ein Tonbandgespräch mit ihm führen. In solchen Fällen war er immer sehr entgegenkommend, völlig ohne Allüren. „Werden wir schon machen,“ sagte er. Ich war dann in Stockholm und anderswo und bin dann Anfang 1966 mit meinem Uher in seinem Haus eingetroffen. Er wohnte damals noch in der Heinrich-Mann-Straße.
Wie war Ihr erster Eindruck von ihm?
Der Volksschauspieler war ja nicht ausgeprägt leutselig. Er konnte direkt hässlich aussehen.
Wegen der Gesichtslähmung?
Die hatte er unter Kontrolle. Durch sie verfügte er aber über mimische Mittel, womit er einen einschüchtern konnte, wenn er wollte. Fast wie ein Test. Auffallend war auch, dass er so klein war. Das wird selten erwähnt, sieht man auch nicht auf Fotos und in den Filmen. Dadurch muss er seinerzeit als jugendlicher Liebhaber Probleme auf der Bühne gehabt haben.
„Ein Nachmittag, der vom Schimpfen geprägt war – ab und zu beschwichtigte seine Frau Irene: ‚Er kann doch nichts dafür‘.“
Sie haben dann ein Interview mit ihm gemacht?
Nein, dazu kam es nie. Ich erzählte ihm, dass ich also eine Rundfunksendung mit seinen Platten machen wollte und dabei erwähnte ich wahrheitsgetreu, ich sei beim VEB Deutsche Schallplatten gewesen um einige Freiexemplare zu bekommen und habe dort gefragt, wie der dänische Rundfunk die Wiedergabe ihrer Produkte honorieren sollte. Zwischen Dänemark und der DDR gab es keine formale Vereinbarungen. Der freundliche Mann dort sagte, dass sei kein Problem, das ginge nach Tarif. Eigentlich war es töricht von mir, Busch das zu erzählen. Die sonst entspannte Stimmung änderte sich sofort. Er eilte ans Telefon und rief die Akademie an, die ja als Mitherausgeber der Aurora-Serie zeichnete. Er erklärte denen rasend, dass er keine einzige Platte bespielen wollte, ehe nicht die Auslandsrechte nach seinen Vorschriften geklärt wären. Ich war natürlich erstaunt über so viel Temperament. Das Thema beherrschte fast den Rest des Nachmittags, der vom Schimpfen geprägt war. Er bekam nie das Geld, das ihm zustand, wobei – das muss ich sagen – Busch überhaupt nicht geldbesessen war; das war eher eine spontane, fixe Idee. Er wollte auch plötzlich den Gebrauch seiner Platten überall in der Welt kontrollieren. Er schimpfte darüber, dass der VEB Deutsche Schallplatten ihn ohne seinen Einfluss gegen Fischer-Dieskau bei der Deutschen Grammofongesellschaft im Westen tauschte. Er schimpfte über Folkways in Amerika – er nannte das Folkwang, kannte sich mit der englischen Sprache nicht besonders gut aus – die ihm keine Gebühren für die Spanien-Platten zahlte. Er schimpfte darüber, dass der deutsch-schwedische Publizist Erwin Leiser im schwedischen Rundfunk sein „Moorsoldaten“-Lied spielte und in seinem Kommentar behauptete, so gehe es heute in Bautzen zu. Er schimpfte darüber, dass der VEB Deutsche Schallplatten wegen der Mauer die „Grabrede über einen Genossen, der an die Wand gestellt wurde“ aus dem Handel gezogen hatte. Das letzte kann ich bestätigen. In der „Mutter“-Reihe fehlte die „Grabrede“ und natürlich auch die Titel auf der anderen Seite, „Lob der Dialektik“ und so weiter. Ich musste Jahre warten, bis sie wieder geduldet wurde. Für mich gab das ja eine plötzliche Einsicht in die Machenschaften der Zensur. Nicht: Wir stehen zu unserem „antifaschistischen Schutzwall“, und ihr könnt dabei ruhig die „Grabrede“ von Brecht und Eisler hören, die ohnehin 1931 entstanden ist. Das war Feigheit, schlechtes Gewissen, weil auch an der Mauer Menschen wie der Genosse an der Wand erschossen wurden. In dem Sinne sprach Busch ohne Zensur, wenn ein Organ der DDR seine Interessen verletzte. Ab und zu beschwichtigte seine Frau Irene: „Er kann doch nichts dafür“, womit ich gemeint war. Ich habe es auch nicht persönlich genommen, er brauchte eben ein Publikum. Dabei wurde Kaffee getrunken. Überhaupt war man gerne da, nicht nur wegen seiner Indiskretionen. Aber sonst hatten meine Gesprächspartner, Manfred Wekwerth, Benno Besson und so weiter so zivilisiert und kontrolliert formuliert, dass es eine Befreiung war, einen solchen Menschen in der DDR überhaupt zu erleben. Auch darum habe ich ihn sofort gemocht.
Hat er sich sonst kritisch über die DDR geäußert?
Nein, nie. Er hat sich ja fast immer auf den letzten Stand der Dinge eingerichtet. Zum Beispiel auch wenn er umgetextet hat.
„Busch meinte, man könne in der DDR nicht von den Alpen und vom Rhein singen. Darum änderte er diese Zeilen in der ‚Kinderhymne‘ und sang stattdessen: ‚Denn die Herren sind vertrieben / Wir bau’n unsern Staat allein.'“
Können Sie Beispiele nennen?
Ja. Als er bei dieser SED-Feier gesungen hat, forderte er das Publikum zum Mitsingen auf. Bei „Roter Wedding“ hat Busch in der ersten Strophe „Die Arbeiterklasse marschiert“ gesungen, während die Leute „Der rote Wedding marschiert“ sangen, weil sie es eben so kannten. Hat etwas Verwirrung und Befremden gestiftet. Warum macht er das? Natürlich hat er dann im Refrain „Roter Wedding grüßt euch, Genossen“ gesungen, weil man ja nicht zu Eislers Melodie „Die Arbeiterklasse grüßt euch, Genossen“ singen kann. Der Grund war natürlich, dass Wedding jetzt zu Westberlin gehörte. Der rote Wedding marschierte nicht mehr, war zu den Amis übergelaufen. Schlimmer war es später in meinem Film, als er Brechts „Anmut sparet nicht noch Mühe“ umgetextet hat, weil das ein wunderbares, in jeder Einzelheit durchdachtes Gedicht ist. Da heißt es im Original: „Und nicht über und nicht unter/ Andern Völkern wolln wir sein / Von der See bis zu den Alpen / Von der Oder bis zum Rhein.“ Hat Busch auch früher immer gesungen. 1976 waren aber in der DDR die zwei deutschen Staaten offizielle Doktrin geworden. Man sang nicht mehr die Nationalhymne mit „Deutschland, einig Vaterland“. Die wurde nur instrumental dargeboten. Darum meinte Busch wohl, man könne nicht länger in der DDR von den Alpen und vom Rhein singen. Darum hatte er diese beiden Zeilen geändert und sang stattdessen: „Denn die Herren sind vertrieben / Wir bau’n unsern Staat allein.“ Es reimt sich, aber es ist eine unzulässige Vergröberung.
Das stimmt. Aber ist Brecht zu Lebzeiten nicht relativ tolerant gegenüber Busch gewesen, wenn es ums Umtexten ging?
Bei Kampfliedern vielleicht. Aber hier ist das etwas anderes. Weil das eine aggressive und protzende Äußerung ist. Der Text von Brecht ist wie die Melodie von Eisler sehr zart, sehr demütig: Liebe Nachbarn, ihr braucht euch nicht länger vor Deutschland zu fürchten. Da soll von Vertreibung keine Rede sein, weder von Herren noch von Knechten. So etwas gehört in diesen Kontext überhaupt nicht hinein. Busch hat eben durch diese Zeilen aus einem Deutschland-Lied ein DDR-Lied machen wollen.
Haben Sie versucht, Busch für Ihren Film den Originaltext singen zu lassen?
Nein, weil er ausnahmsweise das eine Lied mit sich selbst und einem Kinderchor schon vorher auf Band aufgenommen hatte, speziell für meinen Film, und es im Playback-Verfahren singen wollte. Da war keine weitere Diskussion möglich. Ich überließ ihm ja weithin solche Entscheidungen, habe mich nur ein wenig geärgert. Aber diese Art von Geschichtsklitterung war ja typisch für die DDR, und Busch hat manchmal mitgemacht.
„Grotesk, aber auch rührend: Der Barrikaden-Tauber und das Windelkind.“
Das war 1976 …
Ja, ich habe einen Sprung gemacht. Zurück zum ersten Besuch zehn Jahre vorher. Es gab da eine bezaubernde Episode: Ich wusste nichts über sein Privatleben, auch nicht, dass er eine bedeutend jüngere Frau hatte. Aber plötzlich wurde von Irene Busch ein kleines Kind hereingebracht, weil Busch es betreuen sollte. Sie hatten ein Kindermädchen, aber aus irgendeinem Grund hatte sowohl sie als auch Irene Busch woanders zu tun. Wir, Ernst Busch und ich, waren allein mit dem Kind, das war natürlich der Ullrich. Er konnte schon gehen, aber noch nicht sprechen. Busch kommentierte ihn mit keinem Wort, sagte auch nicht, dass es sein Sohn war, sondern sprach ohne Unterbrechung weiter mit mir. Ulli sollte auch aufs Töpfchen, wollte aber nicht, erhob sich wieder. Busch wusste nicht, was er machen sollte. Einmal lief Ulli ins Nebenzimmer. Dazwischen gab es eine Schiebetür. Busch versuchte diese Tür zuzuschieben, während Ulli sich im Nebenzimmer befand, aber das Kind war ihm zu schnell und war zurück bei uns. Busch kapitulierte resigniert. Das ist das einzige Mal, dass ich ihn jemals resigniert gesehen habe. Der alte Mann konnte nichts mit dem kleinen Kind anfangen. Das war natürlich grotesk, aber auch rührend: Der Barrikaden-Tauber und das Windelkind.
Womit haben Sie sich sonst 1965-66 in Berlin beschäftigt?
Ich habe nie früher oder später so viel Theater gesehen. Natürlich habe ich mir im Berliner Ensemble den kompletten Spielplan angesehen. Es gab aber schon eine gewisse Ermüdung dort. Die größte Freude hatte ich an den Vorstellungen Benno Bessons im Deutschen Theater. Das ist das beste Theater, das ich je gesehen hatte. Besson war ja der begabteste Brecht-Schüler, aber aus dem französisch-sprechenden Teil von der Schweiz, das gab eine gute Mischung, das gallische und das deutsche. Er hat auch die Brecht-Methode an französischen Stücken praktiziert. „Der Tartüff“ von Molière, Offenbachs „Die schöne Helena“ als Operette für Schauspieler. Den berühmten „Drachen“ von Jewgeni Schwarz mit Eberhard Esche habe ich vier- oder fünfmal gesehen, Politik und Poesie in einer glücklichen Symbiose. Nach Brechts Tod müssen Bessons Jahre am Deutschen Theater das zweite goldene Zeitalter des DDR-Theaters gewesen sein. Wurde wohl auch nie wieder erreicht.
„Überzeugende Ensemblekunst gab es nur jenseits der Mauer.“
Die Theater in Westberlin?
Waren nichts im Vergleich. Einige große Solisten: Curt Bois, Bernhard Minetti. Überzeugende Ensemblekunst gab es nur jenseits der Mauer.
Haben Sie bei alledem auch noch Zeit für Ihr Studium gefunden?
Das lassen wir lieber. Ich hatte beim Rundfunk Fuß gefasst. Und nach diesem Jahr in Berlin wurde ich beim Rundfunk Redakteur eines monatlichen Kulturmagazins über Deutschland oder vielmehr über die beiden deutschen Staaten. 1967 war ich oft in Berlin. Im Juni flog ich nach Schönefeld und wohnte eine Woche in einem Hotel in Ostberlin. Ich hatte jetzt ein professionelles Nagra-Tonbandgerät vom Rundfunk mitgebracht. Auch Bänder hatte ich ausnahmsweise im Koffer. Ich wusste, dass die Kontrolle in Schönefeld sehr oberflächlich war. Wenn man in Ostberlin wohnen sollte, wurde man sehr höflich behandelt, sie brauchten ja die Devisen. Das war eine merkwürdige Woche, denn der Sechstagekrieg zwischen den arabischen Staaten und Israel war eben ausgebrochen, und am 2. Juni war in Westberlin der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten bei einer Demonstration gegen den Schah erschossen worden.
„Hollywood am Zeuthener See“: Zu Besuch bei Paul Dessau
Was hatten Sie diesmal in Ostberlin vor?
Material für etwa fünf Sendungen zu sammeln. Unter anderem hatte ich eine Verabredung mit Paul Dessau. Er holte mich von der S-Bahn in seinem Auto – einem Mercedes, glaube ich – selber ab und fuhr mich in seine Villa am Zeuthener See. Er trug kurze Hosen, war überhaupt sehr rüstig, fast sportlich mit seinen 72 Jahren. Ich weiß noch den genauen Tag, denn er hatte einen Vertrag aufgesetzt, den ich noch habe, wonach ich mich verpflichtete, ihm für das Interview 250 Kronen auf ein Westberliner Konto zu zahlen. Eigentlich ein lächerlich niedriges Honorar, etwa 30 Euro nach den heutigen Verhältnissen. Normalerweise wurden Interviewpartner nicht honoriert, war aber ein Prinzip von ihm. Der Vertrag datiert vom 7. Juni 1967. Übrigens wollte er gern nach Kopenhagen kommen, um mit den Rundfunksinfonikern eins seiner Orchesterwerke zu dirigieren. Sollte ich dort ausrichten, was ich natürlich auch tat. Die Sachverständigen meinten aber nicht, dass er ein besonders guter Dirigent sei, und seine Musik war im Westen sowieso nicht gefragt. Eine Einladung blieb also aus. Ich fragte ihn natürlich nach seinen Erfahrungen mit der Formalismusdebatte, wo er und Brecht scharf angegriffen wurden: „Die Verurteilung des Lukullus“ 1951. Das fertigte er ab: „Brecht änderte Einiges, und ich änderte Einiges, und wie das so üblich ist bei Änderungen bei Kunstwerken, meistens gewinnen diese Kunstwerke, und so haben wir eigentlich unserer Regierung, unserer Parteiführung zu verdanken, dass diese Kunstwerke sich verschönert haben. Das ist das Fazit dieser Unterhaltung.“ Das ist ein direktes Zitat aus unserer – Unterhaltung.
Schöne Grüße von Paul Dessau! Darauf Busch: „Was geht der mich an? Nicht eine Bohne!“
Hat es Dessau übel genommen, dass Sie ihn nach der Formalismusdebatte gefragt haben?
Ganz im Gegenteil. Er war begeistert, weil er glaubte, die Wahrheit dementiert zu haben. Aufrichtig waren solche Leute fast nie. Dessau war wirklich ein arrivierter Mann geworden. Nach Eislers Tod galt er als der prominenteste DDR-Komponist überhaupt, was er auch sichtbar genoss. Er lebte wie in Kalifornien, fast Hollywood, aber sehr geschmackvoll, modern. Er war aber aufrichtig und sichtbar nervös für einen kurzen Moment, als er mich fragte, ob ich Neuigkeiten über den arabisch-israelischen Krieg wüsste. Was sollte ich da wissen können, da ich in einem Ostberliner Hotell wohnte? Hatte er vielleicht vergessen. Er war ja Jude, und Israel galt in der DDR als Feindesland. Gehört ja auch zur traurigen deutschen Geschichte, dass man da leise treten musste. Natürlich sprachen wir auch über „Die Thälmann-Kolonne“, seinen einzigen Hit. Von Ernst Busch war auch die Rede, den ich wenige Tage danach wieder besuchen sollte, was ich auch Dessau gegenüber erwähnte. Wahrscheinlich sprachen wir darüber, dass Busch manchmal schwierig sei. „Grüßen Sie ihn von mir,“ sagte er, „das wird Sie leichter über die Türschwelle bringen.“ Was ich auch sofort tat, als ich bei Busch ankam. Dieser Anfang war ebenso unglücklich wie das erste Mal, als ich mit den Schallplattenrechten loslegte. „Was geht der mich an? Nicht eine Bohne!“ Und er fuhr fort darüber, dass Dessau vor 1933 nichts gegen die Nazis unternommen hatte und sich jetzt zum grossen Antifaschisten stilisieren wollte. Über „Die Thälmann-Kolonne“, die ja in Paris entstanden war, sagte Busch: „Die hat seine Frau in der Küche beim Kartoffelschälen ins Kochbuch geschrieben.“ Dessaus damalige Frau, Gudrun Kabisch, eine preußische Generalstochter, hat ja den Text unter einem Pseudonym verfasst. Als ich wissen wollte, ob sie auch das Lied komponiert habe, wusste er das nicht so genau. Er fuhr dann mit einem Vergleich fort: Sein Freund Grigori Schneerson hatte ja Brechts „Aufbaulied“ komponiert, während eine Komposition von Dessau dazu bekannter ist – ich glaube, sie ist auch von der FDJ verbreitet worden. Busch sagte, er habe Hanns Eisler gebeten die beiden Melodien zu vergleichen. Eisler habe die von Dessau als „ein hysterisches Kinderliedchen“ bezeichnet, während er über die von Schneerson gesagt haben soll: „Die könnte man eventuell noch unter dem Galgen singen“. Das ist Wort für Wort, was Busch mir gesagt hat.
Dass Busch sich über diese Bewertung gefreut hat, ist klar. Schneerson war sein bester Freund …
Ja, wobei ich die Version von Schneerson ein bisschen süßlich finde wie auch die Aufbau-Schlager von Louis Fürnberg. Optimismus ist so eine Sache … An die Version von Dessau erinnere ich mich nicht mehr so genau. Übrigens hat Busch behauptet, dass Brecht bei einer der Aufnahmen des Schneerson-Liedes – es gibt davon mehrere – im Studio dabei war und im Chor mitgesungen hat, seine Stimme sollte auch erkennbar sein. Er hat einmal versucht, mir das vorzuspielen, ist aber an eine falsche Version geraten. Sollte man untersuchen.
Hat Busch Ihnen gegenüber die Geschichte vom „Herrnburger Bericht“ und Paul Dessau erwähnt?
Nein, gar nicht. Er hat mir das Heft von Charlotte Wasser über sich gegeben. Da steht ja die Urfassung des Gedichtes „Angebot“ von Brecht drin, wo Busch noch nicht gestrichen ist: „Und wenn Ernst Busch singt / Wärt ihr nur dabei!“. Jahre später, die Mauer stand noch, war ich bei Hans Bunge, der immer so kontroverse Dinge wusste und auch ein Freund von Busch war. Da habe ich Bunge gefragt: „Was war eigentlich mit Busch und Dessau?“ Und Bunge hat mir dann die ganze Geschichte über den „Herrnburger Bericht“ erzählt.
Wie wohnte Busch verglichen mit Dessau?
Hell, bürgerlich, mit einem großen Kronleuchter, aber sympathisch. Die Stube war von den vielen Bücherregalen dominiert. Die Familie war jetzt in die Leonhard-Frank-Straße umgezogen. Als ich nach seinem Tode erfuhr, dass hier ein Ernst Busch-Haus eingerichtet werden sollte – ich war nie da – überlegte ich, ob das nicht ein bisschen zu viel sei. Die Aura eines Sängers und Schauspielers hängt wohl nicht mit einer Wohnung zusammen. Vielleicht eher die eines Schriftstellers, der hier seine Werke geschrieben hat. Diese Ein-Mann-Museen haben mitunter etwas Problematisches. Ich habe auch nie eine Führung durch das Brecht-Weigel-Haus mitgemacht. Ich würde mir ziemlich blöd vorkommen.
Auch diesmal wieder kein Interview mit Busch?
Die Nagra blieb auf dem Flur. Einige Tage später kam sie aber völlig unerwartet zum Einsatz. Ich machte einen kurzen Ausflug nach Westberlin, um echten Kaffee zu trinken. Wegen Koffeinmangel hatte ich im Osten Kopfschmerzen bekommen. Das war am Samstag, den 10. Juni. Der Kudamm war voll von Studenten, sie versuchten mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Ich habe auch Gudrun Ensslin gesehen, wie sie von der Polizei abgeschleppt wurde. Ich beschloss, meine Nagra in Ostberlin zu holen und wusste, dass ich mit den Bändern Probleme bekommen würde. Ich nahm eine Handvoll Flugblätter mit und ging zu den DDR-Grenzern am Bahnhof Friedrichstraße und zeigte ihnen die Flugblätter, deren Inhalt radikal links war, und argumentierte: „In Westberlin ist beinahe die Revolution ausgebrochen!“ Und weil die Läden in Westberlin schon geschlossen seien, müsse ich unbedingt Bänder aus meinem Hotel holen. Da war nichts zu machen. Ich durfte wie gewöhnlich nur das Tonbandgerät über die Grenze bringen. In Westberlin, wo die Studenten sich völlig isoliert und verraten fühlten, versorgten die mich mit privaten, in gewissen Fällen schon gebrauchten Bändern, damit ihre Gesichtspunkte auch im Ausland verbreitet wurden. Als ich genug Material hatte, versprach ein Student mir, meine Aufnahmen mit der Post nach Kopenhagen zu schicken, was er auch tat. Eine entscheidende Sache in Ostberlin wurde auch durch diesen Abstecher nach Westberlin geprägt. Auch das war ein Zufall.
„Wolf Biermann zu finden war nicht schwer. Man sollte nicht vermuten, dass in einer Überwachungsgesellschaft Volksfeinde im Telefonbuch stehen.“
Worum ging es?
Es hatte mit dem Zeitgeist damals zu tun. An diesem Samstag in Westberlin hatte ich in der Zeit vom 9. Juni, dem Tag vorher, einen sehr akribischen, kompetenten Artikel von Dieter E. Zimmer gelesen: „Wolf Biermann wird nicht vergessen“. Ich war nie bei Biermann gewesen und beschloss, ihn aufzusuchen. Seine Adresse war damals nicht so bekannt, wie sie es später wurde, als er sie als Titel seiner ersten LP benutzte.
Wie haben Sie ihn dann gefunden?
Er stand im Telefonbuch. Es gab nur ein Telefonbuch für ganz Ostberlin. Da stand er drin. In einer Überwachungsgesellschaft sollte man nicht vermuten, dass Volksfeinde im Telefonbuch stehen.
Haben Sie ihn angerufen?
Nein. Ich war mir nicht ganz sicher. Er stand als Karl-Wolf Biermann da. Das ist sein voller Name. Er ist nach einem Hamburger Kommunisten benannt, Karl Wolff, der 1934 von den Nazis hingerichtet worden war. Ich ging dorthin: Chausseestrasse 131. Das war auf dem vertrauten Weg zum Brecht-Archiv. Auf dem Hof spielten einige Jungen Fußball. Die habe ich nach ihm gefragt. Es gab zwei Treppenhäuser, sie haben mir das richtige gezeigt. Biermann sah fast traurig aus – nicht nur wegen des Schnauzbarts und der schweren Augenlider. Er wirkte erschöpft, seine Stimme war müde. Ich dachte zuerst, der singt nicht mehr.
Hatten Sie Ihr Aufnahmegerät mitgebracht?
Ja. Nachdem wir eine ganze Weile gesprochen hatten, holte er seine Gitarre. Er sang für mich, als ob ich ein ganzer Konzertsaal voller Menschen wäre. Ich erinnere mich besonders an die „Bilanzballade im dreißigsten Jahr“, weil die eine so packende Musik hat. Er sang noch „Es senkt das deutsche Dunkel“. Auch Gedichte hat er mir, nicht vorgelesen, sondern mit voller Lautstärke rezitiert: jenes über die Plastik von Fritz Cremer, „Der Aufsteigende“, wovon er eine kleine bronzene Vorarbeit besaß. Auch das zentrale „Brecht, deine Nachgeborenen“. Alles Unveröffentlichtes.
„Biermann verkörperte damals sehr dynamisch eine neue Generation, während zum Beispiel der Oktoberklub ein lahmer Liederkranz war.“
Das haben Sie alles aufgenommen?
Nein, das wollte er nicht. Das war eigentlich blöd, weil ich das professionell hätte aufnehmen und ohne Schwierigkeiten nach Kopenhagen mitnehmen und weitervermitteln können. Das war aber nicht seine Absicht …
Sondern?
Viele Jahre später, nach dem Hinauswurf, hat er selbstironisch darüber berichtet, wie er zufällige Gäste mit seinen Liedern geradezu überfallen hat. Da ist er aber ungerecht sich selbst gegenüber. Das war damals Teil seiner Überlebensstrategie und deshalb so unvergesslich. Ich blieb auch nicht der zufällige Gast, sondern dieser erste Besuch wurde der Anfang einer freundschaftlichen Beziehung. Wir duzten uns auch bald. Er war ja überzeugter Kommunist und bekannte sich zur DDR als „die bessere Hälfte“. Er war wie bekannt Sohn eines Hamburger Kommunisten und Juden, der in Auschwitz ermordet worden war. Er sah sich in der Tradition von Brecht, Eisler, Busch. Er war auch mit den Arbeiterliedern bestens vertraut. Seine Mutter hatte ihm das ursprünglich beigebracht. Er wusste aus dem Stehgreif, auf Deutsch natürlich, den dänischen Sozialistenmarsch von 1871 zu singen. Ich habe ihn und seine Mutter, die alte Kommunistin Emma, die einmal zu Besuch dort war, den „Roten Wedding“ singen hören. Wenn er dabei ein bisschen Ironie einblendete, unterbrach ihn die Mutter: „Du sollst darüber nicht Spaß machen, dafür ist dein Vater gestorben.“ Ich weiß auch noch, wie er und ich einmal über Fahnenlieder diskutiert haben, von denen es ja eine Menge gibt. Über die rote Fahne, die Hakenkreuzfahne, die dänische Nationalflagge, die als die älteste in der Welt gilt und so weiter. Ich habe die Frage aufgeworfen, ob diese Fahnen in den Liedern ohne weiteres auswechselbar sind. In gewissen Fällen ja. Wenn es nur um die Fahne als Fetisch geht. Da hat Biermann als positives Gegenbeispiel „Des Volkes Blut“ hervorgehoben, ursprünglich ein polnisches Lied, dessen deutsche Übersetzung angeblich von Rosa Luxemburg stammt. Besonders hat er im Refrain den Zweizeiler „Rot ist das Tuch, das wir entrollen, / Klebt doch des Volkes Blut daran!“ hervorgehoben. Das hat er als ethisches Pathos bezeichnet. Ich habe dieses Lied nicht wiedergehört, bis es auf einer der Barbararossa-CDs mit Busch im Jahr 2000 plötzlich auftauchte. Leider hat Biermann nie eine Platte mit diesen klassischen Arbeiterliedern gemacht, die er auf seiner Gitarre auch hervorragend begleitete, aber dafür eine Spanien-Platte mit vier der Busch-Lieder. Biermann verkörperte damals sehr dynamisch eine neue Generation, während zum Beispiel der Oktoberklub ein lahmer Liederkranz war. Nach dem Vorbild von Pete Seeger, dessen Vortrag zu diesem furchtbaren Banjo in der Länge unerträglich war, bis Bob Dylan als der große Retter plötzlich auftauchte. Bei uns, meine ich, nicht in der DDR. Busch, Biermann, Dylan, das sind ja Individualisten und Provokateure. Ich mag Leute, die ab und zu mit dem Rücken zum Publikum spielen, wie Miles Davis: Ihr könnt mich … Meine wesentlichen Gespräche während des Aufenthalts Juni 1967 in Ostberlin, die mit Busch und Biermann, sind leider nur in meinem Gedächtnis gespeichert. Ich hatte aber eine Verabredung mit Biermann getroffen, dass ich ein Interview mit ihm aufnehmen sollte. Das hat sich nur immer wieder verschoben.
Dann folgt das historische Jahr 1968 …
Eben. In den kommenden Monaten war ich oft in Westberlin, wegen der Studenten und so, aber jedes Mal besuchte ich auch Biermann, ohne Tonbandgerät. Ich lernte dabei Leute in seiner Umgebung kennen. Seine Mutter, wie schon erwähnt. Seine damalige Lebensgefährtin, die Schauspielerin Eva-Maria Hagen. Ich lernte auch einen seiner Westberliner Kuriere, eine junge Frau, kennen. Sie vermittelte mir einen Kontakt zu Rudi Dutschke, den ich vor dem Attentat interviewte. Mit Biermann gingen wir auch ins Theater und ins Restaurant. Da erlebte ich eine vielsagende Episode: In einem neu eröffneten Restaurant in der Friedrichstraße gab es ausnahmsweise Eisbein mit Sauerkraut. Die Ostberliner Restaurantküche gab sich sonst ein bisschen international, Steaks mit Pommes frites und so. Biermann mochte Eisbein, ich mag besonders Sauerkraut und Erbsenpüree. Also hin, wir waren mehrere Leute. Während des Essens kam ein Kellner zu Biermann und fragte ihn höflich, ob er nicht der Schotte sei, der eben die Europameisterschaft im Kunstschlittschuhlaufen gewonnen hätte. Das war überall im Fernsehen gelaufen, daran war an sich nichts besonderes. Nur: Vom Typ und Körperbau her sah Biermann gar nicht wie ein Kunstschlittschuhläufer aus, das Bild war in jeder Hinsicht absurd. Der Befragte antwortete wahrheitsgemäß: „Nein, mein Name ist Wolf Biermann.“ Am Tische sprachen wir ein bisschen über diese groteske Verwechslung und konnten sie nicht ernst nehmen. Nach kurzem kam der Kellner zurück: „Entschuldigen Sie bitte. Ich wusste schon, dass Sie Wolf Biermann sind, aber ich und meine Kollegen diskutierten, ob das auch der Fall sein könnte. Wir glaubten, Sie seien von denen da oben erledigt worden.“ Das war ein Ausdruck der Sympathie, aber auch ein Zeichen dafür, dass er in der Bevölkerung bekannt war, auch wenn sein Name schon mehrere Jahre von den DDR-Medien verschwiegen worden war … Darf ich chronologisch weitererzählen?
„Erwähnen Sie auf keinen Fall die Mauer, die Kirche und Wolf Biermann!“ – Abenteuerliche Vorbereitungen einer TV-Dokumentation über das Kulturleben der DDR
Bitte sehr.
Anfang März 1968 saß ich in einem Büro im Rundfunkhaus in Kopenhagen, das ich mittlerweile okkupiert hatte, ich arbeitete sonst meistens zu Hause. Da klingelte das Telefon. Das war einer vom Fernsehen, den ich nicht kannte. Rundfunk und Fernsehen sind dieselbe Institution, Danmarks Radio, wie die ARD eine Anstalt des öffentlichen Rechts, damals noch dazu mit Monopolstellung. Der mir bisher Unbekannte – er hieß Erik Drehn-Knudsen – erzählte, dass der neue Chef der TV-Kulturabteilung eine Folge über das Kulturleben in verschiedenen Ländern senden wollte, und er, Drehn, war für die Sendung über Deutschland zuständig. Er hatte Erfahrung mit Fernsehproduktion, brauchte aber einen Experten, der für den Inhalt mitverantwortlich war. Er verstand zwar Deutsch, kannte sich aber in den aktuellen Verhältnissen nicht besonders aus und war nie in der DDR gewesen. Ich war ihm als Experte empfohlen worden. Danmarks Radio verfügte damals über recht große Mittel. Zum Beispiel würden wir als Vorbereitung drei Wochen in den beiden deutschen Staaten herumreisen können. Die Aufnahmen mit Kameramann und Tonmeister würden auch drei Wochen dauern. Wenn das nach Luxus klingt, muss man bedenken, dass allein Westdeutschland ein Riesengebiet ist, die Aufnahmen mussten also sehr gut vorbereitet sein. Immerhin klang das sehr interessant, ich hatte immer gern fürs Fernsehen arbeiten wollen. Ich sagte sofort zu. Ich sagte aber auch schon am Telefon, wir müssten Wolf Biermann in der Sendung haben, obwohl das von vornherein völlig ausgeschlossen war.
Das war Ihre Bedingung?
Ja, denn im Gegensatz zu Ernst Busch war Wolf Biermann brennend aktuell. Ich stellte uns diese Aufgabe: Wolf Biermann muss mit, alles andere ist eine Kapitulation. Eventuell auch sein Freund, Robert Havemann, dessen Buch „Dialektik ohne Dogma“ auf Dänisch erschienen war. Natürlich mussten wir mit den offiziellen Organen der DDR Kontakt aufnehmen, zuerst per Telex. Die ließen uns sehr früh wissen, dass sie nicht in einer Sendung zusammen mit der Bundesrepublik als „Deutschland“ behandelt werden wollten. Darum mussten wir von Anfang an zwei Sendungen planen. Drehn und ich flogen dann zu den Vorbesprechungen nach Ostberlin. Ein westdeutscher Journalist sagte mir vorher: „Erwähnen Sie mit keinem Wort die Mauer, die Kirche oder Wolf Biermann. Sonst bekommen Sie keine Einreiseerlaubnis.“ Durch den Kurier in Westberlin ließ ich etwas salopp Biermann wissen, dass ich jetzt lieber Fernsehen als Rundfunk mit ihm machen wollte. Wir brauchten nie mit ihm zu telefonieren oder Briefe an ihn zu schreiben. Ich wusste in diesem konkreten Fall schon eine Menge über Wanzen, also eingebaute Mikroabhörgeräte, Stasi und so weiter. Vielleicht fand ich ihn ein wenig paranoid, seine Behauptungen entsprachen aber der reinen Wahrheit, wie wir heute wissen. In Ostberlin konnten Kollege Drehn und ich frei herumlaufen, ohne Gerät waren wir ja nicht gefährlich. Ehe wir uns in den Dschungel der Behörden und Bürokraten begeben mussten, suchten wir Biermann auf. Das war am 30. März, einem Samstag. Etwas mit der Verabredung hatte aber nicht geklappt, er hatte uns einige Tage früher erwartet. Er sollte das ganze Wochenende bei Robert Havemann in Grünheide verbringen, die drei Kinder von Havemann konnten jeden Moment dasein um ihn abzuholen. Natürlich war das unmittelbar ärgerlich. Dieses Missverständnis sollte sich aber als Glück im Unglück erweisen. Wir fragten, ob wir mitfahren dürften, denn Havemann stand ja auch auf der illegalen Liste. Wir fuhren dann mit der S-Bahn nach Erkner, wo Havemann mit seinem Wartburg wartete. Er reagierte ein bisschen befremdet auf uns, denn wir waren ja nicht angekündigt. „Das sind dänische Freunde,“ erklärte ihm Biermann. In dem später berühmten Wochenendhaus in Grünheide am Möllensee besprachen wir das Ganze. Wegen der Wanzen, die tatsächlich da eingebaut waren, lief „A Whiter Shade of Pale“ von Procol Harum die ganze Zeit lautstark auf einem Tonbandgerät. Biermann hatte ja eigentlich grundsätzlich nicht Ja zu dem ganzen Unternehmen gesagt, war eigentlich vom Typ her ängstlich. Havemann war mutiger.
„Wissen Sie, dass man gestern Martin Luther King erschossen hat?“
Weil er älter und erfahrener war?
Biermann war im besten Sinne des Wortes ein Muttersöhnchen. Er war von der Mutter und der Großmutter, diesen wunderbaren Kommunistinnen in Hamburg, großgezogen worden. Havemann war schon 1943 vor dem Volksgerichtshof von Roland Freisler zum Tode verurteilt worden. Aber wo sollten wir die Aufnahmen machen? Kamera, Lampen, Tonbandgerät und den ganzen übrigen Kram in Biermanns Wohnung in der Chausseestraße die Treppe raufzuschleppen, wo immer eine Menge Leute auf der Straße herumliefen, auch Leute in Uniform, war ausgeschlossen. Bisher war es keinem Westdeutschen oder Ausländer gelungen, die das versucht hatten. Sie waren alle entdeckt und des Landes verwiesen worden. Wir mussten eventuelle alternative Zugangswege suchen. Das ist, was man heute ein logistisches Problem nennt. Plötzlich kam Kollege Drehn auf eine Idee, die sich als genial erweisen sollte, obwohl sie unmittelbar noch törichter klang: „Wir könnten es hier machen.“ Wir saßen immerhin etwa 50 km von Ostberlin, unserem Standort während der kommenden ersten Drehtage. Wie sollten wir unbeobachtet herauskommen? Drehn blätterte in seinem Kalender, der Drehtermin war schon von Kopenhagen aus festgelegt, so was plant man ja lange voraus. Während unseres Aufenthalts würde es einen Sonntag geben, den 2. Juni, den Pfingsttag obendrein, wo auch planmäßig gedreht werden sollte. Es würde leicht sein, die Vertreter des deutschen Arbeiter- und Bauernstaates davon zu überzeugen, dass unserem Kameramann und unserem Tonmeister eben dieser Pfingsttag als freier Tag zustand – laut dänischen gewerkschaftlichen Regeln. Diese Intrige wurde schon damals in Grünheide skizziert. Biermann und Havemann brauchten nur dafür zu sorgen, dass sie am kommenden Pfingsttag dort wären, während Drehn und ich von Kopenhagen aus und später nach der Ankunft in Ostberlin alle Hindernisse, theoretische wie praktische, aus dem Wege räumen mussten. Havemann sagte sofort zu, das war für Biermann die entscheidende Motivation. Seine durchgehende Grundhaltung war sonst „Die wissen es schon“, was nicht besonders produktiv war. Wenn das Überwachungssystem perfekt war, ließ sich natürlich gar nichts machen. Wir setzten auf seine Fehlerhaftigkeit. Zum Beispiel gab es zwischen Ostberlin und der übrigen DDR Wachposten, die die Pässe kontrollierten. Wir würden zwar ein Visum für die ganze DDR bekommen, aber wahrscheinlich würde man die dänischen Kennzeichen auf dem Auto registrieren. Havemann wusste einen öden Waldweg, wo nur eine leere Wachhütte stand. Er markierte diesen Waldweg auf unserer mitgebrachten Landkarte. Solche Probleme gab es natürlich dutzendweise. Wir waren auch beim DDR-Fernsehen in Adlershof und sahen uns Filmaufnahmen mit dem Berliner Ensemble, der Komischen Oper, auch mit Ernst Busch an, die wir eventuell für harte Währung kaufen könnten, wenn wir Zitate brauchten. Ich hatte die Grundidee, Goethes und Schillers Weimar mit dem KZ-Lager Buchenwald zu verbinden, um die humanistische Grundlage der DDR zu visualisieren. Ich war schon 1966 privat dort gewesen. Der Bildhauer Fritz Cremer hatte das Buchenwald-Monument gemacht. Darum suchten wir ihn am 2. April in seiner Wohnung auf um ihn für die Mitwirkung zu gewinnen. Er war sofort bereit, uns sein Atelier zu zeigen. Er fuhr uns in seinem Auto dorthin. Das Atelier lag in einem Sperrgebiet dicht an der Mauer, wo man sonst nicht hin kommen durfte. Es gab einen Wachposten, wir mussten die Pässe zeigen. Es war ein riesiges Gebäude, das früher von einem der beiden Nazibildhauer, Thorak oder Breker, benutzt worden war. Die Plastiken von Cremer waren großartig, dort wollten wir gerne filmen, wenn es soweit war. Wir fuhren zu seinem Haus zurück und wurden auch von seiner Frau sehr freundlich empfangen. Sie waren alle beide sehr interessiert und offen. Ich erzählte, was wir in Ostberlin bisher gemacht hatten, abgesehen von der Geheimsache natürlich. Ich erwähnte auch die Filme, die wir beim Fernsehen gesehen hatten. Unter anderem mit dem Sänger Ernst Busch. Frau Cremer fragte: „Wissen sie nicht, dass es noch einen anderen Sänger hier in der DDR gibt?“ Ich wusste schon, dass Biermann mit den Cremers irgendwie befreundet war. Biermann hatte ja Freunde unter den Etablierten, aber das war immer so ein bisschen geheim. Sollte ich den Namen aussprechen? Das taten Kollege Drehn und ich nie untereinander, schon gar nicht im Hotel, wir benutzten stattdessen verschiedene Decknamen. „Sie meinen Wolf Biermann?“ wagte ich dann zu fragen. Genau, wenn wir ihn noch nicht kannten, wäre Frau Cremer dazu bereit, uns eines Abends mit ihm zusammen einzuladen. Pause. Fritz Cremer sah aus, als wäre das auch nach seiner Auffassung eine glänzende Idee. Diese gemeinsame Einladung lag noch einige Sekunden in der Luft und forderte eine höfliche Antwort. Ich musste andeuten, dass ihr Vorschlag überflüssig sei. Also, die Cremers waren hoffnungslos naiv, dass sie nicht ahnten, wie verpönt Biermann in der DDR war. Parallel dazu liefen allmählich unsere Verhandlungen mit den Behörden. Wer eigentlich zuständig war, war am Anfang ein Rätsel. Wir sprachen mit Vertretern des Kulturministeriums und des Außenministeriums. Endlich sind wir bei Edgar Oster in der Charlottenstraße gelandet. Er war Direktor des Reisebüros für Journalistenreisen, eine Zweigstelle des Außenministeriums. Herr Oster übte die ganze Macht aus und wurde unser böser Geist. Er ließ uns merken, dass es unklug von uns war, dass wir schon Leute wie Fritz Cremer aufgesucht hatten. So etwas sollten wir ihm und seinen Leuten überlassen. Wir durften eine Wunschliste zusammenstellen und alle Fragen lange vorher schriftlich formulieren, damit auch die Antworten gut vorbereitet werden konnten. Abgesehen von dem illegalen Teil wurden Kollege Drehn und ich uns darüber einig, nur systemkonforme Wünsche zu äußern. Nur wollten wir gern Cremer auf der Liste behalten. Ein gewisser Einfluss blieb mir. Als ich erfuhr, dass wir unbedingt ein Pionierlager besuchen sollten, fragte ich, ob die Pioniere nicht „Anmut sparet nicht noch Mühe“ von Brecht und Eisler singen könnten. War also meinerseits gar nicht ironisch gemeint. Das haben sie tatsächlich auch gelernt, war natürlich gestellt oder eben bestellt. Ob diese Mädchen schon vorher das Lied kannten, weiß ich nicht. Ich führte immer die Gespräche, während Kollege Drehn Notitzen machte. Das war eine gute Arbeitsteilung. Dabei hatte ich die ganze Zeit Augenkontakt mit den Leuten, denn ich brauchte währenddessen nicht in irgendwelche Dokumente zu gucken. Mein schlimmstes Erlebnis mit Herrn Oster hatte ich am 5. April. Wir trafen wie gewöhnlich um etwa 10 Uhr in sein Büro ein und setzten uns. Da fragte er mich plötzlich unvermittelt: „Wissen Sie, dass man gestern Martin Luther King erschossen hat?“ Und da wartete er mit einem merkwürdigen, süffisanten Lächeln auf meine Reaktion, das ich spontan unpassend fand, bis ich etwas sagte. Dabei fiel mir gewiss nichts Originelles ein. Nachher habe ich stundenlang versucht, dieses unpassende Lächeln zu interpretieren und kam zu dem Schluss: Dieser Mann war wahrscheinlich so primitiv, dass er gehofft hat, ich würde in diesem Moment mein wahres Gesicht, also das Gesicht des Klassenfeinds, zeigen und so etwas sagen wie: „Aaah, dann haben sie dieses schwarze Schwein also endlich abgeknallt!“
„Reisebegleiter hieß ja Aufpasser, Kontrolleur. Das war völlig klar.“
Sie hatten noch nichts von dem Attentat gehört?
Nein, es traf mich unvorbereitet und ich war erst mal benommen … Diese ganzen Erfahrungen hatten allmählich Kollege Drehn, der ein etwas vorsichtiger Mensch war, ursprünglich Bibliothekar, auf die illegalen Aspekte scharf gemacht. Ich kannte ja das alles von früher, er fühlte sich allmählich von denen gedemütigt, weil sie uns alles vorschreiben wollten. Um nach Weimar, Buchenwald und so zu kommen, durften wir nicht einfach den Zug nehmen. Das dänische Fernsehen musste für eine Ostlimousine, einen Chauffeur und einen Reisebegleiter zahlen. Der Reisebegleiter war ein Germanistikstudent von der Humboldt-Universität, Günther Drommer. Um die Wende lektorierte er für den Aufbau-Verlag die Bücher von Markus Wolf und hat wohl auch daran mitgeschrieben, angefangen mit der „Troika“. Diese ganzen Leute hatten überhaupt keine Erfahrungen mit Westmenschen. Zum Beispiel fragte Drommer uns, ob wir etwas dagegen hätten, wenn in einem Restaurant der Chauffeur mit bei Tisch säße. Die hatten also eine Auffassung, dass man fast erschrak. Sonst war die Stimmung freundlich. Während der Fahrt sprach ich mit Drommer. Er erzählte, dass sein Studium ihm erlaubte, westdeutsche Bücher zu lesen, die in der DDR verboten waren, etwa von Günter Grass. „Ich hab mir auch ‚Die Drahtharfe‘ schicken lassen,“ fügte er hinzu. Ich merkte, wie ich rot anlief, und kommentierte seine Aussage mit keinem Wort. Kollege Drehn verstand sie nicht, der Chauffeur auch nicht, was schon wichtiger war. „Die Drahtharfe“ war der erste, bisher einzige Lieder- und Gedichtband von Wolf Biermann, der in Westberlin erschienen war. Der Name Biermann war so tabuisiert wie der Name Trotzki in der schlimmsten Stalin-Zeit. Das war fast metaphysisch. Der Kellner hatte ja auch nicht gesagt: „Sind Sie Wolf Biermann?“ sondern „Sind Sie der schottische Schlittschuhläufer?“ Dann musste der Betroffene selber den verbotenen Namen aussprechen, wenn er dazu den Mut oder die Lust hatte: „Nein, ich bin…“ Nicht wahr? Wir wussten, dass wir auch während der Aufnahmen einen Reisebegleiter bekommen würden, und wir hofften, dass es nicht der Drommer wurde, der uns recht sympathisch war, denn dann würden wir ihn reinlegen müssen. Wer uns da in die Quere kam, würde eventuell seinen Job bei Herrn Oster oder der Stasi verlieren. Reisebegleiter hieß ja Aufpasser, Kontrolleur. Das war völlig klar.
Haben Sie in Kopenhagen vor der Abreise keinerlei Hilfestellung oder Beratung durch, sagen wir, erfahrene Auslandskorrespondenten bekommen?
Wir waren die erste dänische Fernseh-Crew in der DDR überhaupt. Wir mussten alles selber erfinden. Von Kopenhagen lief dann der Telexverkehr mit Herrn Oster auf hohen Touren. Auch wurde die Reihenfolge der Aufnahmen immer wieder geändert. Nur den freien Tag trauten sie sich nicht zu streichen. Ein Pilotwagen des dänischen Fernsehens war damals ein heller Mercedes Kombiwagen, der – sollte es sich zeigen – überall in der DDR großes Aufsehen erregte. Also eine wunde Stelle. Hinten konnte man reinschauen. Da stand das ganze Gerät in Metallkästen, während die Stative für Kamera und Lampen in Hüllen von Sackleinen danebenlagen. Wenn wir in der Nacht zwischen Samstag und Sonntag nach Grünheide fahren und das Gerät und die Stative bei Havemann unterbringen könnten, könnte der vollgepackte Wagen den ganzen Pfingsttag vor dem Hotel stehen. Wir haben durch den Kurier bei Havemann nachgefragt. Er hatte eine Garage, wo wir das alles unterbringen konnten. Ich dachte mir, wenn das klappte, würde er im eigentlichen Sinne straffällig werden, als Komplize, bei der Mitwirkung an irgendeinem Verbrechen. So lange er nur passiv in seinem Wochenendhaus saß, hätte er nichts verbrochen. Die Behörden der DDR sollten verhindern, dass wir ihn erreichten. So waren wohl die Spielregeln. Dennoch hatte er keine Bedenken, und so wurde das abgemacht.
Und Sie und Ihr Kollege fühlten sich wie Helden in einem Spionage-Krimi …
Naja, ein bisschen schon. Denn obwohl die Risiken nicht vergleichbar waren, riskierten auch Drehn und ich allerhand. Keiner in Kopenhagen wusste von dem Plan, auch der Kulturabteilungschef nicht. Wenn man uns in der DDR erwischt hätte, wären wir zu Hause als tollkühne Abenteurer beschimpft oder sogar ausgelacht worden. Ohne Material für eine Sendung zurückzukehren wäre sowieso peinlich gewesen. Außerdem konnten die DDR-Behörden den Wagen und das ganze teure Gerät konfiszieren. Es gab ja überhaupt keine diplomatischen Verbindungen zwischen Dänemark und der DDR. Es war meine erste Erfahrung mit dem Fernsehen, und auch Drehn war noch freischaffend. Die Medien waren schon damals voller Intrigen und Eifersucht: „Das hättet ihr euch doch denken können, dass das nie gutgehen würde, Trottel!“ Nicht nur aus Sicherheitsgründen haben wir den Chefs und den sogenannten Kollegen nichts erzählt.
„Bei denen waren die Menschen ohne weiteres austauschbar.“
Wann sind Sie dann losgefahren?
Am 29. Mai. Erst zwei Tage vor der planmäßigen Abreise bekamen wir endlich die Einreiseerlaubnis. Unser Wagen mit den vier Insassen wurde von einem neuen Reisebegleiter, Herrn Kaufmann, einem reiferen, dicken Herrn mit Glatze und dunkler Brille, empfangen. Beim ersten Arbeitsgespräch mit ihm wurde die Reihenfolge der Aufnahmen durchgesprochen. Die hatten sie zum X-ten mal geändert. Gottseidank blieb der Pfingsttag offen. „Da werde ich etwas Sightseeing arrangieren,“ sagte Herr Kaufmann nach der Devise: nur nicht allein lassen. Plötzlich entdeckte ich, dass Fritz Cremer von der Liste verschwunden war. Er war bisher immer drauf gewesen. Ich fragte, wieso. „Der ist zur Zeit nicht in Berlin.“ Vielleicht wusste Kaufmann es nicht besser, er war ja nur der Laufbursche vom Oster. Da wurde ich ausnahmsweise aggressiv: „Das stimmt nicht, ich habe aus Kopenhagen mit ihm telefoniert“ – was der Wahrheit entsprach – „und er wird uns Montag in seinem Atelier erwarten.“ „Dann muss etwas schief gelaufen sein.“ Herrn Kaufmann war das ein bisschen peinlich. Ich beschloss, nichts weiteres in der Sache zu unternehmen. Am nächsten Tag bei Herrn Oster habe ich nur gefragt, ob Cremer von unserem Ausbleiben orientiert war. Das wurde bejaht. Die wollten uns einen anderen bildenden Künstler besorgen, den Maler Willi Sitte in Halle. Bei denen waren die Menschen ohne weiteres austauschbar. Danach stießen Drehn, Oster, Kaufmann und ich mit einem Glas Vodka auf eine gute Reise an, während der Kameramann und der Tontechniker draußen im Korridor vor Osters Büro wie die Kulis warten mussten. So etwas wäre im kapitalistischen Dänemark natürlich unerhört gewesen.
Was hatten die DDR-Behörden gegen Cremers Mitwirkung?
Das ist ohne weiteres erklärbar. Er war ein impulsiver Mensch. Dem konnte man nicht vorschreiben, was er zu sagen hatte. Er war der größte Bildhauer in der DDR, Mitglied der Akademie der Künste, mit Auszeichnungen überhäuft. Auch Mitglied der SED. Hat ihm alles nichts genützt. Das Schweinische war, dass Herr Oster log. Cremer war gar nicht orientiert und wartete an jenem Montag in seinem Atelier vergeblich auf uns. Das weiß ich, weil ich ihn später von Kopenhagen anrief. Ich habe ihn leider nie wiedergesehen. Wenn wir Ernst Busch auf der Wunschliste gehabt hätten, wäre dasselbe passiert. Er ließ sich auch nicht steuern. Das ist an und für sich ein furchtbares Regime, das so verfügt und nur Marionetten duldet. Diese Erfahrung hat uns moralisch in der Biermann-Havemann-Sache sehr bestärkt. Wir müssen das tun!
War Ihr „Reisebegleiter“ irgendwie mit kulturellen Themen vertraut? Ich meine, war das ein Gebiet, auf dem er sich gut auskannte?
Keineswegs. Ich habe mich riesig für die Leute auf der anderen Seite interessiert. Oster, Drommer, Kaufmann und wie sie alle hießen. Nicht als graue Masse, sondern als Individuen. Wie schon angedeutet habe ich nach der Wende Günther Drommer im Aufbau-Verlag aufgesucht. Er war nie über uns verhört worden und wusste gar nicht, dass wir auch illegal gearbeitet hatten. Was sein Nachfolger als Reisebegleiter, Harry Kaufmann, betraf, war er nicht besonders mitteilsam mit seinen Privatangelegenheiten. Muss Jude gewesen sein.
„Wir spielten die dummen Dänen, die sollten uns für völlig ungefährlich halten.“
Wie kommen Sie darauf?
Nach dem Ausschlussprinzip. Er trug das VVN-Abzeichen, war also Verfolgter des Naziregimes. Nicht wegen politischer Tätigkeit, das kann ich nicht glauben, dazu war er zu faul. Später tauchte seine bedeutend jüngere Frau auf, die sehr gesprächig war, ich hatte das Vergnügen. Sie war völlig unkritisch der DDR gegenüber, er hatte dazu keine Meinung, nur einen Job. Er hatte einen Sohn aus erster Ehe, der Clifford hieß, und er nannte seine Frau, die eigentlich Dorothea hiess, Dolly. Ich glaube, er ist während der Nazizeit in den USA gewesen. Warum er gerade nach Ostdeutschland, nicht nach Westdeutschland zurückgekehrt war, war mir ein Rätsel. Frau Dolly war von mir sehr positiv eingenommen, weil ich eine Menge über Brecht, Becher und so weiter wusste. Die anderen spielten die dummen Dänen, ich ab und zu auch. Das war genau abgesprochen, die sollten uns für völlig ungefährlich halten.
Wie haben der Kameramann und der Tonmeister auf das Ganze reagiert?
Das war ihnen alles völlig neu. Und aufregend. Obwohl sie überall in der Welt unterwegs gewesen waren. Auch in Diktaturen. Sie hatten keine Probleme mit der Geheimniskrämerei. Zum Beispiel: Wir müssen davon ausgehen, dass Kaufmann Dänisch versteht. Alle diese Vorsichtsmaßnahmen. Der Tonmeister hatte so ein Schmuggler-Gen, das konstruktiv eingesetzt wurde. Auch spielte er am überzeugendsten den Blöden, der sich auch gerne auf Deutsch unterhielt. Ab und zu musste ich ein Auge auf ihn haben, weil das drohte, zu weit zu gehen. Frau Dolly Kaufmann fand ihn ungemein ordinär, das spürte man. Der Kameramann war ernst, sachlich, verstand in der Tat kein Wort Deutsch. Selber habe ich mich nie in meinem Leben so lange verstellen müssen. Da bekommt man ab und zu eine Wut, sind sehr interessante psychologische Mechanismen. Also: die Rollenverteilung war perfekt. Auch in der Freizeit blieben wir zusammen, was bei Auslandsreisen einer Fernsehcrew bei weitem nicht oft der Fall ist. War schon eine Art Kameradschaft.
Und die „dummen Dänen“ hat man Ihnen geglaubt?
Da war eine sehr dumme Geschichte am 31. Mai. Kaufmann musste ständig telefonieren gehen. Mit Oster und anderen. Das geschah normalerweise bei Außenaufnahmen. Wenn er weg war, filmten wir eine Ruine oder, da wir zufällig in der Nähe waren, Biermanns Haus in der Chausseestraße. Das wurde später in der Filmmontage verwendet, ohne kommentiert zu werden. Sonst kontrollierte Kaufmann jeden Kamerawinkel. Am besagten Tag befanden wir uns in der Nähe vom Alexanderplatz, der völlig umgebaut wurde mit Fernsehturm und so. Wir sollten uns in einer halben Stunde vor unserem Hotel mit Kaufmann treffen um weiter zu dem Erfolgschriftsteller Hermann Kant zu fahren. Als er uns verlassen hatte, kamen wir auf die dumme Idee, auf die Baustelle zu gehen, um die Bauarbeiter über ihre Kulturgewohnheiten zu befragen. Das war an sich völlig unschuldig. Während ein Arbeiter erzählte, wie die Brigade ein Konzert mit Igor Oistrach arrangiert hatte und anderes mehr, wurden wir unterbrochen. Die hatten ja Walkie-Talkies. Wieso wir dort ohne Aufsicht filmten, wollte ein Vorarbeiter wissen. Uns wurde das weitere Drehen untersagt, und wir mussten mit ihm gehen. Die Volkspolizei hatte ein provisorisches Revier auf der Baustelle. Da wurden sämtliche Pässe sorgfältig abgeschrieben. Wir kamen etwas verspätet vor dem Hotel an. Kaufmann hielt da und wartete auf uns. Ich habe ihm sofort alles erzählt auf meine dumm-dänische Art. Er hatte so eine „ist wohl alles halb so schlimm“-Attitüde, weil ich so aufgeregt tat. Kurz nachdem wir die Wohnung von Hermann Kant betreten hatten, klingelte das Telefon. „Gespräch für Herrn Kaufmann.“ Dann konnte man indirekt hören, wie er in die Mangel genommen wurde. „Aber die gehen ständig auseinander,“ versuchte er, was gar nicht stimmte. Er sollte uns nie wieder während der Dreharbeit verlassen. Er sass dann schwitzend und schweratmig direkt neben mir, als ich Hermann Kant befragte. Er stöhnte so kräftig, dass es mich nachher wunderte, dass man es nicht auf dem Tonband hören konnte.
Haben Sie Hermann Kant über Biermann befragt?
Nein, natürlich nicht. So wie ich auch Fritz Cremer nicht über Biermann befragt hätte, also bei offenem Mikrofon und mit Kaufmann in der Nähe. Kant war später bei der Ausbürgerung von Biermann als Nachfolger von Anna Seghers Präsident des Schriftstellerverbandes und ein eifriger Befürworter dieser Maßnahme.
Eindrücke in der Pionierrepublik „Wilhelm Pieck“ am Werbellinsee
Hat Ihr „Reisebegleiter“ seine Bewachung verschärft?
Also, Kaufmann hatte möglicherweise den Eindruck bekommen, dass er uns nicht trauen konnte. Das war sehr ärgerlich und so gar nicht notwendig. Am 1. Juni, dem Samstag vor Pfingsten, hatten wir aber wieder Glück, weil das der längste und anstrengendste Tag wurde. Der 1. Juni galt in der DDR offiziell als der internationale Tag des Kindes. Darum fuhren wir schon früh morgens in die Pionierrepublik „Wilhelm Pieck“ am Werbellinsee. Da war die absolute Elite der Kinder aus der ganzen Republik versammelt. Erst gab es die Rituale, die auch ohne uns stattgefunden hätten. Friedenstauben wurden nach gereimten Sprüchen losgelassen. Sprechchöre: „Amis raus aus Vietnam“. Aufmärsche mit Nationalfahnen aus allen möglichen Ländern, auch Dänemark.
Ihretwegen? Die dänische Fahne?
Nein. Ich vermute, dass alle Länder, wo es Pioniere, also kommunistische Kinderorganisationen, gab, durch ihre Fahnen vertreten waren. Dass es sich in Dänemark um weniger als hundert Pioniere aus den Kopenhagener Hinterhöfen, fast aus dem Lumpenproletariat, handelte, hat der Fahnenträger natürlich nicht gewusst. Der Cutter von meinem Busch-Film später war übrigens als kleiner Junge Pionier gewesen. Also eine Seltenheit bei uns. Wir haben viel darüber gesprochen. Er war nicht selber Kommunist geworden, hatte aber ein harmonisches Verhältnis zu seinem Elternhaus. Hat sich auch mächtig für Busch interessiert … Dann bekamen wir eine Kindergruppe aus Rostock zur Verfügung oder vielmehr: sie bekam uns zur Verfügung gestellt. Wir filmten die Übergabe einer Pionierfreundschaft an den Pionierleiter durch ein etwa 12-jähriges Mädchen, eine Freundschaftsrätin, vermute ich, die zuerst „Augen geradeaus!“ kommandierte. Wurde alles sehr stramm, sehr schneidig abgewickelt. Ich möchte aus dem weiteren Text zitieren: Der Pionierleiter übernahm die Truppe mit den Worten: „Grüßt euch mit dem Gruß der Thälmann-Pioniere für Frieden und Sozialismus: Seid bereit!“ Die Kinder antworteten: „Immer bereit!“ Er fuhr fort: „Wir singen zu Beginn die erste Strophe des Liedes, ‚Wer kann die Lieder der Freiheit verbieten‘, drei-vier.“ Dann haben die Kinder das Lied abgeleiert, wie das eben so ist. In unserem Kontext natürlich besonders ironisch. Wer kann die Lieder der Freiheit verbieten? Wir haben das nicht bestellt, war Zwangspensum. Der Kameramann hat vor sich hin „Hitler-Jugend“ gemurmelt, ich flüsterte ihm leise „Halt die Klappe“ zu, weil das ja unmittelbar verständlich war. Er war tatsächlich über diese fremden Sitten tief empört. In der Sendung wurde so was nicht kommentiert, nur die Aussagen und Lieder wurden durch Untertitel getextet, dann konnten die Zuschauer dazu selber Stellung nehmen.
Hatten Sie dieselbe Assoziation wie Ihr Kameramann?
Hitler-Jugend, meinen Sie? Mir war so etwas nicht völlig neu, Pioniere und so. Es gab damals etwa 1,7 Millionen Pioniere in der DDR. Davon kamen die meisten, das ließe sich statistisch nachweisen, aus Familien, wo die Eltern oder Großeltern unter Hitler mitgemacht hatten. Diese Kinder hatten einen Freibrief bekommen, wodurch sie von einer völlig entgegengesetzten Tradition adoptiert worden waren: die Tradition des Spartakus, der Interbrigaden in Spanien, des ganzen antifaschistischen Kampfes. Aber hauptsächlich durch Rituale und Parolen, die für den Einzelnen nicht durchschaubar und darum wohl recht sinnlos waren. Der Pionierleiter überreichte auch Buchprämien an Pioniere, die, ich zitiere: „die Frage richtig beantworteten, was Karl Marx als Wichtigstes für uns schrieb. Dass er eben ‚Das kommunistische Manifest‘ für uns schrieb. Besonders für die Menschen schrieb, die sich noch von dem Kapitalismus befreien müssen.“ Muss so ein Quiz gewesen sein. Er sprach auch – fast wie ein Quizmaster im Fernsehen – von „den glücklichen Gewinnern“. Ziemlich unbeholfen also. Humorlos vor allem. Später sind wir nach Dortmund gekommen, wo es eine völlig authentische rote, linkssozialdemokratische Tradition unter den Ruhr-Arbeitern gab, die natürlich unterdrückt, aber unversehrt das Dritte Reich überlebt hatte. Da war auch die Kindererziehung recht antiautoritär.
„Spaniens Himmel“ gehörte zum lustlosen Lernen in der Schule und in der Pionierfreundschaft dazu.“
Glauben Sie, dass die Pioniere Ernst Busch kannten?
Gewiss, dem Namen nach. „Spaniens Himmel“ und so. Das gehörte wohl zum lustlosen Lernen in der Schule und in der Pionierfreundschaft. Daran ist nichts besonderes. In der Schule bei uns hat man auch die Klassiker totgeschlagen. Alles, was von den Autoritäten und vom Staat gefördert wird, ist wohl irgendwie suspekt. Auch darum habe ich mich ja so eingehend für Jazz interessiert, weil der von den Lehrern als minderwertig betrachtet wurde. Gehörte fast mit Motorrädern und Jugendkriminalität zusammen. Die waren ebenso borniert und – sagen wir ruhig dumm – wie die Autoritäten in der DDR.
Gab es für Sie auch positive Eindrücke bei den Pionieren?
Dass da Jungen und Mädchen zusammen waren. Das hat es weder in der Hitler-Jugend noch damals bei den Pfadfindern im Westen gegeben. Auch bekam man den Eindruck, dass es bei denen weniger förmlich zuging, wenn sie nicht eben stramm standen und Sprüche aufsagten. Das war ja überhaupt das Problem in der offiziellen DDR.
Wie meinen Sie das?
Die arrangierte, fast befohlene Spontaneität. Die faden Parolen und Losungen. Die abkommandierten Volksmassen. Mir fallen dabei die Westberliner Studenten ein. Unvergessen bleibt mir eine Riesendemonstration durch die ganze Innenstadt im Februar 1968. Da wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht auf großen Plakaten mitgetragen. Natürlich wurde der „Ho Chi Minh“-Ruf ständig wiederholt, was in der Länge schon nerven konnte. Hat wohl keinen Gegner zum Nachdenken gebracht. Die Studenten skandierten aber auch regelmäßig den Spruch: „Wir sind die kleine, radikale Minderheit.“ Das mag ein Zitat eines CDU-Politikers oder aus der Springer-Presse gewesen sein. Da marschierten also Zehntausende, ich glaube an die Hunderttausend, und dementieren allein durch ihre Zahl diesen Satz. Das war eben sehr elegant. So kann Politik auch sein.
Sie verbrachten diesen ganzen Tag bei den Pionieren?
Wir fingen früh morgens in dem Pionierlager an und waren erst um Mitternacht fertig, nachdem im Deutschen Theater dieselbe Vorstellung zweimal nacheinander gegeben worden war.
Hatte das Theaterstück etwas mit den Pionieren zu tun?
Überhaupt nicht. Das war eine Inszenierung von Benno Besson mit Eberhard Esche und Ursula Karusseit. Das Stück war von einem schreibenden Arbeiter verfasst. Eine Zusammenarbeit solcher Art war für unser Thema interessant.
„Die Wachhütte auf dem Waldweg, den Havemann empfohlen hatte, war bemannt. Und es gab einen Schlagbaum.“
Und das gab es zweimal am selben Abend?
Ja. Dabei konnte der Kameramann während der ersten Vorstellung die Aufnahmen vorbereiten und dann während der zweiten drehen. Wir verfügten über zwei Logen. Frau Dolly war auch in einem schicken Abendkleid da. Nur konnte sie nicht vom übrigen Publikum bewundert werden, weil das Ehepaar Kaufmann natürlich mit uns in der Loge isoliert war, und wir liefen da in Hemdsärmeln herum. Das war ein irres Arbeitsprogramm während eines einzigen Tages. Herr Kaufmann war völlig am Ende, auch wir gähnten eifrig. Kaufmann sagte zum Abschied: „Sie brauchen jetzt ihren Schlaf. Ich schaue morgen im Hotel vorbei.“ Dann packten wir das ganze Zeug zusammen und fuhren es direkt nach Grünheide. Nur den Kameramann ließen wir im Hotel zurück, weil er seine Augen für den nächsten Tag schonen musste. So eine Mission wirkt wie Epo, das Adrenalin pumpt. Wir waren plötzlich hellwach. Es war jetzt stockdunkel. Das lief nicht völlig unproblematisch. Die Wachhütte auf dem Waldweg, den Havemann empfohlen hatte, war bemannt. Und es gab einen Schlagbaum. Der Tonmeister, der unbedingt den Wagen fahren wollte, hielt sehr ruhig und vornehm an. Er hatte etwas hervorstehende Augen, die dabei fast die Augenhöhlen verließen. Ich saß neben ihm und memorierte eine völlig unmögliche Deckgeschichte, die ich aber bereit hatte, weil Drehn und ich schon in Kopenhagen sämtliche nur denkbaren Eventualitäten durchgenommen hatten. Wir waren natürlich furchtbar nervös. Die Wachposten haben uns aber nur weitergewunken, ohne von dem Auto weiter Notiz zu nehmen. Solche Erlebnisse, die wir Havemann und Biermann weitererzählten, bestärkten Biermann in seiner Annahme, die wissen schon alles und warten nur auf die passende Gelegenheit um zuzuschlagen. Havemann empfing uns in Grünheide, um das Haus wurde sehr leise gesprochen. Wir leerten die Metallkästen und die Hüllen aus Sackleinen in seiner Garage. Da er die Garage auch als Schreinerwerkstatt verwendete und das Sackleinen jetzt sehr schlaff aussah, gab er uns einige passende Holzstöcke, die in die Hüllen gesteckt wurden um sie auszufüllen. Dann ging es zurück nach Berlin. Das ist, was man in der Dramaturgie „the point of no return“ nennt: Jetzt gab es keinen Weg zurück.
Der Wagen sollte also zur Tarnung vor dem Hotel stehenbleiben?
Ja. Jetzt konnte der aufsehenerregende Mercedes-Kombiwagen den ganzen Pfingsttag vor dem Interhotel Unter den Linden stehen, voll gepackt und doch leer.
Man konnte hinten reinschauen …
Genau. Wenn Herr Kaufmann oder andere Mitarbeiter von Herrn Oster vorbeikämen, würden sie nichts Verdächtiges sehen können. Wir stellten uns auch vor, und das ist später bestätigt worden, dass Angestellte in den Interhotels ein scharfes Auge auf so was hatten. Der Pfingsttag war ein wunderbarer Frühsommertag. Wie fast ganz Ostberlin fuhren wir mit der S-Bahn ins Grüne. Bei Havemann gab es sehr viele Leute. Biermann war mit seiner Gitarre eingetroffen. Auch Eva-Maria Hagen und ihre Tochter, die damals 13-jährige Nina Hagen. Die durften aber nicht gefilmt werden, weil Eva-Maria Hagen eine populäre DEFA-Filmschauspielerin war und ihre Karriere nicht riskieren wollte. Ich habe die beiden mit unserer Nikon fotografiert. Dagegen wollten die Havemann-Kinder, Frank, Florian und Sibylle, gern im Film mitwirken. Der Kameramann hat die Stube völlig professionel verdunkelt und die Lampen aufgebaut. Dann ging es los: Havemann argumentierte als Kommunist druckreif für die Freiheit der Künste und der Kultur, auch in der DDR. Biermann sang zwei Lieder nach eigener Wahl: „Noch“ mit dem wiederkehrenden Satz „das Land ist still“ über die DDR, aber auch „Drei Kugeln auf Rudi Dutschke“ gegen die Machthaber in der Bundesrepublik. Also sehr durchdacht und ausgewogen. Das ganze war nicht als Hetze gegen die DDR gedacht, sondern als eine innere Kritik auf dem Boden des Kommunismus. Beide lobten als Vorbild den „Frühling im roten Prag“, um Biermann zu zitieren.
„Auf dem unbewohnten Nachbargrundstück entdeckte Biermann ein leeres Auto mit einer riesigen Antenne auf dem Dach. Havemann hatte ein Luftgewehr, und Biermann schoss mehrmals dicht über die Antenne damit.“
Diese Hoffnung gab es noch?
Einige Monate noch. Am Rande gab es auch jetzt beunruhigende Vorkomnisse. Während eines Filmwechsels entdeckte Biermann auf dem unbewohnten Nachbargrundstück ein leeres Auto mit einer riesigen Antenne auf dem Dach. Havemann hatte ein Luftgewehr, und Biermann schoss mehrmals dicht über die Antenne damit. Als wir fertig waren und abgebaut hatten, nahmen wir nur die Filmaufnahmen – vier Rollen – und das Tonband mit uns. Als Havemann uns wie verabredet zum S-Bahnhof in Erkner fahren wollte, wurden wir binnen einer Minute von einem Motorrad mit einer Antenne überholt. Ich saß vorne neben ihm und sah, wie er fast erbleichte: „Das war die Stasi“ – das konnte er dem Kennzeichen entnehmen. Darum fuhr er uns einen S-Bahnhof weiter in Richtung Ostberlin, nach Wilhelmshagen. Ich, der ich immer sehr dünn gewesen bin, hatte sämtliche Metallkästen mit den Filmen, Blech oder so was, unter dem Hemd. Darum wollte ich nicht direkt zurück ins Hotel gehen. Der Tonmeister und ich gingen ins Operncafé und aßen zwei Gänge mit reichlich Sekt dazu. Ich schickte ihn als Vorbote ins Hotel, und als er von seinem Fenster mit einer riesigen Geste ein „alles klar“-Zeichen in Richtung Unter den Linden machte, ging ich zu ihm aufs Zimmer. Ich schlief mit allen vier Filmrollen am Leib auf seinem Bett ein, während er und Drehn den Mercedes-Kombi nach Grünheide fuhren, um das ganze Gerät zu holen, was ich ihnen nachher sehr übelnahm. Aber immerhin: mission completed.
Sie blieben aber noch einige Tage in der DDR?
Eine halbe Woche. Am nächsten Morgen ging es südwärts. Vor uns fuhr dann immer eine Tatra-Limousine mit Kaufmann, Frau Dolly und einem Chauffeur. Der Rest der Reise verlief ohne Zwischenfälle mit Besuchen bei Willi Sitte in Halle, in dem Kulturhaus in Bitterfeld und in einer LPG. Viele anonyme Leute waren aus der Produktion geholt worden um für uns zu singen, zu spielen und zu tanzen. Da hüpften zum Beispiel dralle Arbeiterinnen herum, um uns nach den Anweisungen eines pensionierten Ballettmeisters klassisches Ballet nach DDR-Art auf Amateurniveau zu zeigen. Auch ein einzelner Ballettherr war unter all den Frauen dabei, der war garantiert schwul. Alles sehr gekünstelt. Nur die Bauernkapelle in der LPG „Vorwärts“ in Berlstedt legte mit ihrer lustigen Kaffeehausmusik richtig los, sodass wir ihre Melodien wochenlang nachher aus dem Gedächtnis im Auto trällerten. In den Pausen und abends in den Restaurants kamen das Ehepaar Kaufmann und wir uns immer näher, so wie es nicht selten mit Gefangenen und Wärtern geht. In Weimar war plötzlich Günther Drommer, der Student, da. Er hat dort in der Nähe seine Eltern gehabt oder so was. Drehn und ich wollten, dass er uns Gesellschaft leisten sollte. Auch er war eifrig, waren wir doch die netten Jungs aus dem Westen. Wir sollten mit den Kaufmanns in dem Kellerrestaurant des Interhotels weitermachen. Da herrschte aber Kravattenzwang, und Drommer besaß keine Kravatte. Kaufmann, der zwanzig Kravatten mitbrachte, war gar nicht gnädig, duldete keine Konkurrenz. Also, Tschüss Drommer! Dann Weimar, Buchenwald, auch im Krematorium wurde gefilmt. Wir waren dem Ehepaar Kaufmann so nahe gekommen, dass sie sagten, wäre die Reise umgekehrt verlaufen und in Berlin geendet, hätten sie uns bei sich zu Hause eingeladen. Und besonders Frau Dolly hatte mich so lieb gewonnen, weil ich ein so guter und loyaler Kenner und Verehrer der DDR war, dass sie mir zum Abschied ein Buch schenkte, „Dr. Schlüter“ von Karl Georg Egel. Die letzte Hürde: Schon bei Oster in Berlin sollten wir eine Erklärung unterschreiben, nach der wir uns verpflichteten, unser Filmmaterial nicht nach Westdeutschland weiter zu verkaufen oder zu vermitteln. Das war Routine. Da versuchten sowohl Drehn als auch ich etwas Dummes, um diese Verpflichtung zu meiden. Wir erklärten, dass wir beide freiberuflich für das dänische Fernsehen arbeiteten, was der Wahrheit entsprach, und darum nicht in dessen Namen unterschreiben könnten, was keineswegs stimmig war. Ja, dann musste Kopenhagen bestätigen, sonst würde man in Ostberlin die Filme behalten und sie dort entwickeln lassen. Am Vortag unserer Ausreise nach Westdeutschland teilte Kaufmann uns mit, dass die Bestätigung noch nicht in Berlin eingetroffen war. Drehn musste mit Kopenhagen telefonieren, er konnte natürlich nicht Klartext sprechen. Irgendeiner dort hat glücklicherweise schnell reagiert, und wir konnten die DDR verlassen.
Hatten Sie nie Gewissensbisse dem Ehepaar Kaufmann gegenüber?
Nein, wer sich für eine schlechte Sache hergibt, muss auch dafür büßen. Das ist das Prinzipielle. Dabei handelt es sich natürlich auch um Menschen. Kurz vor der Sendung habe ich ihnen einen Brief geschickt, ich hatte Kaufmanns Visitenkarte mit der Privatadresse bei mir. In dem Brief habe ich erzählt, was wir gemacht hatten – natürlich ohne Einzelheiten – damit sie vorbereitet waren. Ich habe das auch eingehend begründet.
Haben Sie eine Antwort darauf bekommen?
Nein, obwohl ich in dem Brief indirekt um ihre Stellungnahme zu meiner Erklärung gebeten habe. Ob Kaufmann den Brief sofort zu Oster gebracht hat, weiß ich nicht. Würde ich vermuten.
Sie fuhren unmittelbar weiter durch die ganze Bundesrepublik?
Ja. Darüber gibt es nicht viel zu erzählen. In Tübingen haben wir den alten, weisen Philosophen Ernst Bloch aufgesucht, der über die Langeweile in den beiden deutschen Staaten gesprochen hat.
Sie machten dann wie verabredet zwei Sendungen?
Ja, das hatten wir denen in der DDR versprochen. Das wurde als bindend betrachtet.
„Ich hatte den Eindruck, dass die Stasi nicht so schnell und effektiv war wie später immer behauptet.“
Arbeiteten Sie und Ihr Kollege zusammen am Schneidetisch?
Mit einer Cutterin zusammen, ja. Wir waren bestrebt, die DDR-Sendung sachlich, keineswegs demagogisch zu machen. Nur einmal waren wir uns nicht völlig einig. Es gab eine Sequenz aus Bitterfeld mit einem Kasperletheater, wo eine dicke Frau, eine Erzieherin, zusammen mit drei kleinen Mädchen mit Pionierhalstüchern ein pädagogisches Stück über das Zähneputzen zum Besten gab. Die dicke Frau sprach mit verstellter Kinderstimme die wortreiche Hauptrolle, während die Mädchen nur kurze Sätze hatten. Insbesondere eins der Mädchen, 9-10 Jahre alt, schaute ängstlich rauf zu der dicken Frau und senkte mit einer fast tragischen Miene den Kopf nach jedem ihrer kurzen Sätze. Da wir den Verlauf mehrmals parallel hatten, wollte ich mehr von dem Mädchen haben, aber Drehn fand das zu übertrieben. Ich habe nachgegeben. Ich schrieb und sprach 90 % des Kommentars. Den Übergang vom legalen zum illegalen Teil wollte Drehn gern schreiben und sprechen. Nach 45 Minuten wurden erst jetzt die Drehbedingungen völlig undramatisch erwähnt, während Kaufmann im Bilde auf Nikon-Fotos zu sehen war. Ich habe dann Biermann und Havemann vorgestellt und dabei irgendetwas gesagt, das der Kulturabteilungschef nicht mochte. Ich durfte nicht die Illegalität der Aufnahmen unterstreichen, nur andeuten. Ich musste diese Passage neuschreiben und neusprechen. Ich weiß das noch, weil ich mich gerade in Apenrade bei meinen Eltern erholte. Da gab es ein Rundfunkstudio, wo ich die revidierten Sätze sprechen konnte. Das Dutschke-Lied mit Biermann im Bilde wurde übrigens kommentarlos, nur mit seinem Namen oben in der Ecke, als Finale der Sendung über Westdeutschland, die zuerst lief, verwendet. Sehr raffiniert, aber Biermann war damals auch in Dänemark sehr bekannt. Besonders die DDR-Sendung, die am 2. August lief, wurde von der Presse gelobt. Sie fing mit dem Pionierchor und „Anmut sparet nicht noch Mühe“ an, wie ich das schon von Anfang an geplant hatte.
Es wurde also nicht darauf hingewiesen, unter welch ungewöhnlichen Umständen die Aufnahmen mit Biermann und Havemann zustande gekommen waren?
Nein. War ja auch nur unsere Sache, wie das gemacht worden war. Aber es gibt ein Nachspiel: Kurz nach der Sendung, noch im August, kam die Invasion in Prag durch die Warschauer Pakt-Länder. Die Havemann-Söhne, Frank und Florian, die ja auch bei uns zu sehen waren, verteilten Flugblätter dagegen, wurden verhaftet und auch verurteilt. Besonders Havemann drängte per Kurier darauf, dass die Grünheider Aufnahmen auch im westdeutschen Fernsehen, das ja in der DDR gesehen werden konnte, gezeigt wurden. Ich fühlte mich sehr verpflichtet. Ich ließ Drehn beim Kulturabteilungschef fragen, die Antwort war Nein. Ich ließ das nicht gelten. Ich verabredete mich mit Biermann und Havemann in der Chausseestraße und flog nach Westberlin. Ich passierte nicht ohne Beben die Sektorengrenze, das war am 31. Oktober, ich könnte zum ersten Mal mit einem gewissen Recht abgewiesen werden. Aber ich hatte ja den Eindruck, dass die Stasi nicht so schnell und effektiv war wie später immer behauptet. Und ich kam ohne Schwierigkeiten durch. Merkwürdig. Die Söhne saßen wie erwähnt im Gefängnis. Sie waren vor Gericht gefragt worden, wie wir damals nach Grünheide gekommen waren. Wahrheitsgemäß konnten sie antworten, dass sie das nicht wussten.
„Unsere Aufnahmen geisterten jahrelang durch westdeutsche TV-Sendungen – mit dänischen Untertiteln, denn die konnte man ja nicht entfernen.“
Hatten Biermann und Havemann konkrete Befürchtungen?
Ja. Zum ersten Mal seit Jahren waren ihre Namen am 29. Oktober im Neuen Deutschland erwähnt worden. In einem Artikel, wo es um die Urteile gegen die Söhne und andere Jugendlichen ging. Thomas Brasch war auch darunter. Da stand: „Zu ihrer gegen die sozialistische Ordnung in der DDR gerichteten Haltung wurden die Angeklagten von Robert Havemann und Wolf Biermann systematisch inspiriert.“ Es war nicht ausgeschlossen, dass man auch gegen die beiden angeblichen Hintermänner Anklage erheben würde. Havemann litt seit den Jahren im Nazigefängnis an einer Lungenkrankheit und wäre durch eine neue Haft gesundheitlich gefährdet gewesen.
Was konnten Sie tun?
Nichts. Aber ich empfahl Havemann, einen persönlichen Brief an den Intendanten von Danmarks Radio zu schreiben, einen Sozialdemokraten, wurde später Kulturminister. Zuletzt wurde er Hofmarschall bei der Königin, aber das gehört nicht hierher. Havemann schrieb den Brief mit der Hand, „Sehr geehrter Herr Sølvøj“, ich gab ihm natürlich die Details. Er argumentierte dafür, dass die Grünheider Aufnahmen allein von ihm und Biermann genehmigt waren, und somit nicht von den Vereinbarungen mit den DDR-Behörden umfasst waren. „Es würde uns sehr bedrücken, wenn der Arm der hiesigen Zensur bis nach Kopenhagen reichen sollte.“ Der Brief, der vom 21. November datiert ist, wurde mir aus Westberlin zugeschickt. Ich habe ihn weitergeleitet, liegt heute im Reichsarchiv. Der Intendant Sølvøj schrieb mir, man würde sich bemühen, eine Lösung zu finden. Ich war gespannt. Die Lösung wurde eine Wiederholung im dänischen Abendprogramm. Endlich bekamen einige Journalisten Wind von der Sache: DDR-Professor riskiert Todesstrafe wegen dänischer Fernsehsendung. Zu dieser maßlosen Übertreibung haben wir, Drehn und ich, mit keinem Wort, keiner Äußerung beigetragen. Der tiefere Sinn der Sache war, dass der NDR über diese Wiederholung informiert wurde, sie fuhren einen Aufnahmewagen nach Flensburg. Die Wiederholung lief am 24. Januar 1969. Ein größerer Auszug wurde am 3. Februar von der ARD in „Panorama“ gebracht. Nach der Sendung habe ich Havemann in Grünheide angerufen, das konnte man ja, er hatte sie natürlich gesehen und war sehr erleichtert. Biermann und er waren ja davon abhängig, dass sie vom westdeutschen Fernsehen am Leben gehalten wurden. Jahrelang geisterten diese Aufnahmen durch westdeutsche Fernsehsendungen und Dokumentarfilme – mit dänischen Untertiteln, denn die konnte man ja nicht entfernen. Dadurch bekamen diese technisch einwandfreien Aufnahmen endlich einen Schein der Illegalität, was ich von einem ästhetischen Gesichtspunkt aus höchst interessant finde. Auch die Nikon-Fotos aus Grünheide wurden weit verbreitet, kamen in den Spiegel und in ein sehr opulentes Kindler-Literaturlexikon, völlig anonymisiert. Auch wurde im Bildtext Biermanns Wohnung in der Chausseestraße fälschlicherweise als Ort angegeben. Ich habe mir sämtliche Negative gesichert und habe sie heute noch. Die Urheberrechte gehören theoretisch dem Kameramann und mir, nur wir beide haben damals fotografiert. Filmzitate und Fotos sind uns nie von den Westdeutschen bezahlt worden. Ist auch völlig in Ordnung. Diente eben einer guten Sache.
„Von der gegen mich verhängten Einreisesperre in die DDR habe ich erst nach der Wende bei der Gauck-Behörde erfahren.“
Erfuhren Sie danach Repressalien?
Nach der westdeutschen Ausstrahlung verhängte die DDR eine Einreisesperre über mich. So etwas bekommt man aber nicht mit der Post zugeschickt, davon habe ich erst nach der Wende bei der Gauck-Behörde erfahren. Die Sperre galt aber erst von April 1970 bis Dezember 1973. Also wenn Gottes Mühlen langsam mahlen, mahlen die der Stasi noch langsamer. Aber immerhin über dreieinhalb Jahre. Interessant wäre – das habe ich nicht einmal versucht – die MfS-Protokolle über Biermann und Havemann an den aktuellen Daten zu lesen. Was war mit der Antenne auf dem Autodach oder dem Motorrad mit den Stasi-Kennzeichen? Reiner Zufall? Kaum. Die wurden ja rund um die Uhr überwacht. Möchten Sie die Begründung der Einreisesperre hören?
Bitte.
„Lt. Auskunft vom April 1970 reiste N. mit weiteren Mitarbeitern des dänischen Fernsehens im Mai/Juni 1968 in die Hauptstadt der DDR ein, um angeblich einen Film über das kulturelle Leben der DDR zu drehen. N. nutzte die Einreise zur konspirativen Verb.-Aufnahme mit HAVEMANN und BIERMANN und führte ein Interview mit diesen. Dieses wurde im dänischen u. westd. Fernsehen gesendet. HAVEMANN wendet sich darin gegen die führende Rolle der Partei in der Kultur.“ – Der Witz ist ja, dass die nicht wahrhaben wollen, dass wir tatsächlich einen Film über das Kulturleben in der DDR drehten, wovon Havemann und Biermann nur ein Bestandteil waren.
Hatten Sie ein solches Einreiseverbot einkalkuliert?
Selbstverständlich. Ich hielt mich etwa sechs Jahre von der DDR fern. Ich machte weiterhin Fernsehen, auch über skandinavische, dänische Themen, Fiktion noch dazu. Aber ich machte auch für den Rundfunk diesen Zehnteiler mit Liedern von Ernst Busch, „Fra kejser til kaos“, vom Januar bis Mai 1970. Im April schrieb ich einen Porträtartikel über Busch in der führenden Intellektuellenzeitung Information, die damals links lag, den ich noch als recht gelungen betrachte.
„Ich habe immer die Parteien links von den Sozialdemokraten gewählt.“
Waren Sie selber links? Damals?
Bin ich heute noch. Ich habe immer die Parteien links von den Sozialdemokraten gewählt. Ich war nicht 1968 eines Besseren belehrt worden oder auf andere Gedanken gekommen. Ich bildete mir ein, die DDR einigermaßen zu kennen. Und langsam reifte der Gedanke: Busch ist allmählich 75 geworden, vielleicht sollten wir etwas Größeres riskieren? Ich hatte mit einem dramadokumentarischen Film mit Schauspielern – 90 Minuten – zum 100. Todestag von Hans Christian Andersen einen beachtlichen Erfolg gehabt und war – jedenfalls vorübergehend – einer der Lieblinge von diesem Kulturabteilungschef, der uns doch in der Biermann-Havemann-Sache einige Schwierigkeiten bereitet hatte. Ich schrieb ihm, ich möchte einen Film über und mit Ernst Busch machen. Er hatte natürlich keine Ahnung, wer das war. Aber um ihm den Mann und das Thema schmackhaft zu machen schrieb ich seine Kurzbiographie. Ist immer ein gutes Argument, und – wie gesagt – der Chef hatte Vertrauen in mich und meine Urteilskraft. Darf ich dazu eine Anekdote erzählen?
Nur zu …
Ein damaliger Mitarbeiter der Kulturabteilung hat neulich seine Erinnerungen veröffentlicht und füllt viele Seiten mit einem Klagelied darüber, dass er kurzfristig keine Kameracrew bekommen konnte, als sich John Lennon und Yoko Ono völlig unerwartet einige Tage in Jütland aufhielten. Die hatten das japanische Kind von Yoko Ono entführt oder so was. Das war mitten in der Beatles-Ära, die waren noch nicht auseinandergegangen. Der Chef fragte nur: Wer ist John Lennon? Und die Antwort hat ihn nicht überzeugt. War wohl nach seiner Auffassung Kinderkram. Wenn sie das heute hätten, wäre es ein Riesending, das sich international verkaufen ließe.
Waren Sie selber ein Beatles-Fan?
Damals habe ich das alles gehört und auch die Platten gekauft, die ich nicht länger spielen kann, während ich zum Beispiel Bob Dylan auch auf CDs komplett erworben habe. Nach dem Übergang von LPs zu CDs merkt man sich, was man nicht gerne missen möchte: Armstrong, Sidney Bechet, Coltrane, Miles Davis, Bob Dylan, Leonard Cohen. Ernst Busch, natürlich. Mehr als 30 CDs mit Busch, glaube ich. Und alles, was irgendwie mit Brecht und Eisler zu tun hat. Da bin ich völlig unersättlich.
Wie steht es mit Biermann?
21 Stück. Habe ich mir später für eine weitere Sendung für mein eigenes Geld anschaffen müssen. Ich werde darauf zurückkommen.
Die dritte und letzte Begegnung mit Ernst Busch 1976
Der Kulturchef hat also ihren Plan mit dem Busch-Film akzeptiert?
Ja, und hier folgt endlich nach langer Pause mein dritter Besuch im Hause Busch. Ich erzählte ihm nicht, welche Verbrechen ich in der Zwischenzeit begangen hatte. Ich besuchte natürlich auch Wolf Biermann in der Chausseestraße. Der erzählte mir über den Feuertod meiner Landsmännin Ruth Berlau in der Charité, den er fast als Zeuge erlebt hatte, weil er dort auch vorübergehend im Krankenbett lag. Weder Busch noch Biermann hatten sich verändert, auch fand es Biermann nicht verwunderlich, dass ich nach unseren gemeinsamen Erfahrungen einen Film über Busch machen wollte.
Biermann war ja auch 1970 zu Buschs 70. Geburtstag unter den Gratulanten gewesen …
Ja, und Busch hat sich so hingestellt, dass andere Gratulanten Biermann die Hand geben mussten, wenn sie zu Busch wollten. Auch ausgeprägte Biermann-Feinde. Hat Hans Bunge erzählt.
Sie meinen, Busch stand damals zu Biermann?
Busch war ja auch eine Eulenspiegel-Natur. Er hat eine solche Situation genossen.
Wie war nun 1976 Ihr Wiedersehen mit Busch?
Busch und Frau Irene hatten mich von früheren Besuchen in freundlicher Erinnerung. Wie früher mit dem Rundfunk wollte Busch gerne reden, mit mir Kaffee und Vodka trinken, aber bei einer Sendung – diesmal fürs Fernsehen – nicht mitmachen. Da – muss ich sagen – wurde ich von Frau Irene sehr unterstützt. Einen Vergleich mit Frau Dolly Kaufmann drängt sich auf: Irene Busch war nicht nur Staat – Partei war sie auch. Sie war aber außerdem freundlich, hatte Charme. Wenn er zu laut schrie, hat sie ihn gedämpft. Wie immer. Sie hat ihren Ehemann unbedingt verehrt, aber warum auch nicht? Sie waren ein gut eingespieltes Paar. Sagt man nicht so im Sport und in der Musik? Das Nein hat sich dann langsam aber sicher in ein Ja verwandelt. Ich war auch in der Brunnenstraße und habe Busch bei der Arbeit mit Rudolf Lukowsky und Bernd Runge beobachtet.
„Die Archive des MfS waren offenbar in meinem Fall nicht besonders effektiv, die hätten eigentlich belegen müssen, dass ich ein ganz Schlimmer war.“
Haben Sie nicht wieder mit der offiziellen DDR in Verbindung treten müssen?
Das lief diesmal ganz anders. Die Kulturabteilung wollte, dass ich die Aufnahmen mit einer Crew vom DDR-Fernsehen machen sollte. Weil das billiger war. Das Verhältnis zwischen Dänemark und der DDR hatte sich in der Zwischenzeit normalisiert mit gegenseitiger Anerkennung, Botschaften und so. Dennoch war ich natürlich sehr gespannt, ob ich zugelassen würde. Formal war die Einreisesperre abgelaufen, aber so lief das ja nicht. Ehe es so weit kam, war ich aber wie schon 1968 in Adlershof, um Archivmaterial zu sehen. Ich wollte besonders gern eine Filmaufnahme mit Busch und Eisler zusammen haben. Das hatten sie nicht. Ich bekam den Eindruck, dass das Archiv sehr schlecht, sehr zufällig geordnet war. Es gab aber eine sehr einprägsame, stumme Szene, wo Busch als Galilei am Schluss des Stückes Suppe aß. Diese Beobachtung verdient, ins Protokoll der Filmaufnahmen mit Busch aufgenommen zu werden, weil ich diesen kurzen Film später nie gesehen habe. Man sollte ihn suchen. Er war uns aber zu teuer, die wollten ja wieder einmal ihre Devisen holen. Wie ich immer erwähne, bekam Busch selber keinen Pfennig. Ich habe eben die Rechnung kontrolliert. Dass das DDR-Fernsehen bezahlt wurde, ist ja klar. Aber auch Runge und Lukowsky, die ja Buschs Leute waren, bekamen Honorare. Die stehen mit drauf auf der Rechnung. Beim dänischen Fernsehen hatte man die sehr dubiose Grundhaltung, so eine Sendung sei für einen Künstler gute PR. Busch hätte aber ein Honorar verlangen können, und das wäre natürlich verhandelt worden. Tat er aber nie. Darum: Sein ganzes Gerede über Geld während des ersten Besuchs 1966 war eine Mache. Man darf ihn wirklich nicht oberflächlich beurteilen. Sein Kern steckt viel tiefer. Er hatte eben Probleme mit der Freundlichkeit. Wie Brecht. Konnte sie schwer formulieren, konnte sie fabelhaft in Taten umsetzen. Sehen Sie die Liste der vielen Wohltätigkeitsveranstaltungen, wozu er im Exil beigetragen hat. Für jüdische Kinder und vieles mehr. So etwas muss man ihm hoch anrechnen.
Sie mussten also diesmal mit keinem Funktionär über die Bedingungen verhandeln?
Nein, das lief alles über Telex oder Fax oder was wir 1975 hatten. Völlig unproblematisch. Als wäre es Schweden gewesen. Die Archive des MfS waren in meinem Fall offensichtlich eben so ineffektiv wie die Archive beim Fernsehen der DDR. Die hätten sich doch informieren müssen und hätten konstatieren können, dass ich ein ganz Schlimmer war. Man hat ja später lesen können, was sonst alles lief. Ich hatte eben nochmals Glück.
„Diesmal hieß es nicht Reisebegleiter, da wir ja nicht unterwegs waren, sondern Betreuer.“
Fuhren Sie diesmal allein nach Ostberlin?
Ich brachte eine Assistentin mit, wie das üblich war. Wir bekamen auch einen Menschen, der wohl grundsätzlich dieselbe Funktion ausüben sollte wie früher Harry Kaufmann. Diesmal hieß es nicht Reisebegleiter, da wir ja nicht unterwegs waren, sondern Betreuer. Der war aber kein Aufpasser, Schnüffler, Verhinderer. Auch mit dem Kameramann kam ich schnell überein, dass er auch filmen sollte, wenn Busch nicht ganz genau davon wusste. So etwas wäre 1968 völlig undenkbar gewesen. Eigentlich war nur Irene Busch als kritische Instanz immer dabei, aber das war in jeder Hinsicht verständlich. Wenn er irgend etwas Peinliches sagen oder machen sollte, würde ich das am Schneidetisch weglassen. Ich habe mich keineswegs schriftlich dazu verpflichtet, das war ausschließlich eine Frage des gegenseitigen Vertrauens. Ich habe neulich den Block meiner Assistentin gefunden, worin sie die Reihenfolge der Aufnahmen notiert hat. Daraus geht einwandfrei hervor, dass wir am 10. März in der Brunnenstrasse angefangen haben und zwar mit „An die Nachgeborenen“ Teil 1, 2 und 3. Nach meinem Wunsch.
Wie kamen Sie auf dieses Brecht-Gedicht?
Das kennt fast jeder, der sich auch nur oberflächlich mit ihm beschäftigt hat. Mit Busch hatte ich Teil 3 auf einem Band bei ihm zu Hause gehört.
Gab es da schon die Plattenaufnahme?
Nein. Eisler hatte schon in den Dreißigerjahren drei Elegien daraus gemacht. Für klassisch geschulte Sänger. Nach dem Zwölftonsystem. Sehr schwierig. Busch erzählte gern, wie Irmgard Arnold ihm vor einem Auftritt damit fast weinend gesagt hatte: „Ach, Busch, wie soll ich das nur schaffen?“ Diese Elegien gibt es übrigens mit Fischer-Dieskau auf CD. Busch kam um 1959 auf die Idee, Eisler solle ausschließlich für ihn eine neue, einfachere Fassung komponieren. Es gab unter uns im Studio eine Diskussion, ob Eisler für Busch überhaupt den ersten Teil komponiert hatte. Hat er wohl nicht. Auf der späteren Platte wurde das Problem dadurch gelöst, dass der erste Teil von der historischen Aufnahme genommen wird, wo Brecht selber sein Gedicht liest. Bei mir hat Busch das gelesen: „Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!“ Im zweiten Teil wird er von Lukowsky auf dem Flügel begleitet. Da pendelt er ein bisschen unsicher zwischen Singen und Sprechen. Den dritten Teil, den berühmtesten, hat er, von Lukowsky am Cembalo begleitet, ohne Brille direkt in die Kamera gesungen: „Ihr, die ihr auftauchen werdet“. Ganze acht Mal, wovon fünf komplett sind. Der Vortrag ist sehr ernst, die Melodie sehr lustig. Haben später so unterschiedliche Leute wie Ekkehard Schall, Robyn Archer auf Englisch und Ute Lemper nach ihm gesungen.
War es schwierig, ihn dazu zu bringen? Dasselbe Lied achtmal zu singen?
Keineswegs. Wenn ich nicht zufrieden war, hat er ohne Kommentare wiederholt. Es gibt Schauspieler, die immer wissen wollen, was an einer Aufnahme nicht geklappt hat. Auf dem Theater früher war Busch sehr eigenwillig gewesen. Auch bei Brecht, da gibt es Geschichten. Es mag bei Gesangsaufnahmen anders gewesen sein. Er war ja auch sehr selbstkritisch. Er hat sich fast überfordert.
„Busch schaltete manchmal den Rundfunk ein, um zu erfahren, ‚ob irgendwo in der Welt Krieg ausgebrochen ist‘, wie er sagte.“
Haben Sie dann am nächsten Tag ebenso intensiv weitergemacht?
Nein. Am 11. haben wir bei ihm zu Hause Originalfotos, Theaterzettel und so weiter abgefilmt, weil es damals nur wenige gedruckte Quellen gab. Dann wurden meine Assistentin und ich in der Mittagspause zu Tisch geladen und aßen mit der Familie zusammen, alles sehr delikat, z.B. selbstgepflückte Pfifferlinge – aus Hiddensee, glaube ich. Auch Ulli war da, nicht länger ein Windelkind, ging damals zur Schule. Busch war bei Tisch immer entspannt, gut gelaunt und gesprächig. Er schaltete manchmal den Rundfunk ein, um zu erfahren, „ob irgendwo in der Welt Krieg ausgebrochen ist“, wie er sagte.
Welche Zwischenfälle gab es diesmal?
Es gab genau zwei. Eines Tages war der gewöhnliche, diskrete Betreuer krank und durch einen anderen ersetzt. Plötzlich war ich wie ins Jahr 1968 zurückversetzt. Ich weiß den Namen natürlich nicht von dem, aber er hatte eine frappierende äußere Ähnlichkeit mit Harry Kaufmann, fett, mit Glatze. Ich habe Fotos von den Beiden, man kann sie vergleichen. Er war aber noch schlimmer. Ein Vollidiot, hatte keine Ahnung von irgendetwas. Das ist eben das Problem in einer Diktatur, und die DDR war eine Diktatur. Man kann nicht „Scheren Sie sich zum Teufel“ sagen oder „Ich verlange, ihren Vorgesetzten zu sprechen“, man ist so einem völlig ausgeliefert. Er hat mein geplantes, vereinbartes Interview mit Busch sabotiert, indem er versucht hat, Busch misstrauisch zu machen. Busch reagierte auf Stimmungen sehr empfindlich, alles war plötzlich im Eimer. Stattdessen haben wir nach Lukowsky geschickt und eine reine Improvisation gemacht, und wie es so oft bei Improvisationen ist, wurde das wunderbar. Busch bereitete wohl damals eine Mappe vor mit Songs aus der „Dreigroschenoper“, die nie erschien. Lukowsky setzte sich an den Flügel, der Kameramann nahm die Kamera auf die Schulter, und keiner wusste, was jetzt passieren würde. Es gibt da eine volle, ununterbrochene Filmrolle, wo Busch sämtliche Temperamente durchläuft. Er ist munter, gekränkt, will nicht mehr, kann die Noten nicht finden, findet sie, freut sich darüber und so weiter. In der Sendung lief da später, wenn er nicht gerade singt, ein gesprochener Kommentar. Man soll sich das aber unbedingt nur mit dem Synchronton ansehen und anhören. Er kommuniziert wunderbar mit der Kamera. Er intoniert kurz den Anfang von „Santa Lucia“, um die Stimme zu üben. Die Tonassistentin mit dem Mikro kniete am Boden und musste dort herumgekrabbeln, um nicht ins Bild zu kommen. Ich wusste sofort, das wird bei uns in Dänemark gut ankommen. Nicht nur der Held, der im Kommentar ausgiebig, aber verdient gefeiert wird, sondern auch ein 76-jähriger mit seinen Launen und seiner unglaublichen Vitalität. Ich weiß nicht, ob so was damals im DDR-Fernsehen gegangen wäre. Als ich das beim Busch-Kolloqiuium im Mai 2000 gezeigt habe, hat das Publikum furchtbar gelacht. Darf man auch, muss nur solidarisch sein. Natürlich habe ich auch „Die Thälmann-Kolonne“ und ähnliches von Schallplatten gebracht, die mir Bernd Runge frisch überspielte. War ja sozusagen „Busch für Anfänger“.
Gab es sonst unerwartete Titel, die er unbedingt singen wollte?
Geplant war nicht „Die Krücken“, ursprünglich ein Gedicht von Brecht an meine Landsmännin Ruth Berlau von 1938. Ich glaube nicht, dass Busch diesen privaten Hintergrund wusste. Ich wusste ihn auch nicht 1976. Busch hat diesen Text gefunden, auch weil er darin komödiantische Möglichkeiten sah, und hat ihn irgendwann nach Brechts Tod Eisler zum Komponieren gegeben, wie er das auch mit den vielen Tucholsky-Texten tat. Dieses Lied zu singen bereitete ihm einen besonders großen Spaß. Und er freute sich riesig, fast kindlich darüber, dass nur er die Noten dazu in seinem Privatbesitz hatte. Auch das Lied war sozusagen sein Privateigentum.
Den zweiten Zwischenfall gab es wann und warum?
Das war am letzten Drehtag, am 16., diese peinliche Episode in der Brunnenstraße, die ich auch beim Kolloquium erzählt habe. Der gewöhnliche Betreuer war wieder zurück, und wir wurden uns alle einig, während des Kaffeetrinkens in der Kantine zu drehen, ohne dass Busch das genau mitbekam. An Stelle des missglückten Interviews. Nur: Was er da die ganze Zeit sprach, war wirklich „oral history“ für Kenner. Er erwähnte hundert Namen, mit denen er ohnehin Schwierigkeiten hatte, und ich sah vor meinem inneren Auge ebenso viele Fußnoten, die notwendig waren, um das nur einigermaßen begreifbar zu machen. Erfahrungsgemäß wusste ich, man kann in einem gesprochenen Kommentar nur mit sehr wenigen Personen arbeiten. Ich habe z.B. Paul Dessau trotz der „Thälmann-Kolonne“ nicht erwähnt, nicht nur weil Busch ihn nicht mochte, sondern weil das keinen Sinn, keine Funktion hatte. Sein Name kam natürlich in den Abspann, wie sich das gehört. Nur Eisler und Brecht wurden erwähnt, und das sehr häufig. Dann sprach er da in der Kantine plötzlich beiläufig von diesem Assistenten von Eisler in Berlin, Herbert Breth-Mildner, der später in der Sowjetunion gestorben sei.
Wussten Sie sofort, wer das ist?
Nein. Keine Ahnung. War ja auch nur eine Fußnote wie etwa Otto Stransky, über den ich bis heute auch nichts Genaueres weiß.
Aber heute wissen Sie, wer Herbert Breth-Mildner ist?
Natürlich. Abwechselnd mit Eisler war er bis 1933 sein Klavierbegleiter. Ob sie sich in der Sowjetunion überhaupt gesehen haben, ist zweifelhaft. Breth-Mildner war nicht länger musikalisch aktiv, sondern arbeitete dort als Agronom im Kaukasus. Ist nach 1938 hingerichtet worden. Aber Busch sagte keineswegs, dass er „ermordet“ oder „umgebracht“ worden war oder Ähnliches. Buschs Wortlaut nach könnte er an Keuchhusten, Masern oder einer anderen Krankheit gestorben sein.
Kannten Sie die gedruckte Widmung von Busch in der ersten Aurora-Mappe: „Meinen toten Freunden Maria Osten und Michail Kolzow“?
Natürlich. Und auch die Behauptung von Alfred Kantorowicz, nach dieser Widmung sei es in der DDR still um Busch geworden, was ein völliger Quatsch ist. Dabei ist es natürlich wichtig, dass Osten und Kolzow damals rehabilitiert worden waren. Dennoch hat man diese Widmung nicht gern gesehen, weil die Namen derart exponiert wurden. Aber Busch konnte so etwas durchsetzen.
Und im Fall von Breth-Mildner?
Ob man vergessen hatte, ihn zu rehabilitieren, weiß ich nicht. Es gab in Dänemark einen prominenten Kommunisten, der erst unter Gorbatschow rehabilitiert wurde, weil man bis dann nicht zugeben wollte, dass er überhaupt gestorben war. In Moskau im Gefängnis. Dass Irene Busch mit einer kompletten Liste von rehabilitierten und nicht-rehabilitierten Stalin-Opfern im Kopf herumlief, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. War vielleicht ein Kurzschluss. Aber ein fataler.
Was hat sie denn gemacht?
Beim nächsten Film- oder Bandwechsel hat sie die ganzen Aufnahmen unterbrochen und darauf bestanden, dass der Tonmeister diese Stelle auf dem Band finden und löschen musste. Plötzlich standen alle über dem Tonbandgerät, auch diesmal einer Nagra, gebückt. Es wurde hin- und hergespult, um die Stelle zu finden. Nur Busch saß in einer Ecke und wusste nicht, was da lief. Irene versuchte gar nicht, ihn irgendwie über das Problem zu informieren. Wie hätte sie das auch formulieren können: „Wir suchen die Stelle, wo du diesen Mann erwähnst, der…“ Peinlich, unmöglich, absurd. Stattdessen hätte sie mich nach Abschluss der ganzen Aufnahmen bei Seite nehmen können: „Bitte verwenden Sie nicht die Stelle, wo mein Mann…“ usw. Halbes Vertrauen gibt es nicht, entweder- oder. Hing ja sowieso von mir ab, weil ich den Film in Kopenhagen zusammenstellen sollte. Wenn ich ein Schwein gewesen wäre, hätte ich auch „Die Partei hat immer recht“, die wir im Archiv hatten, spielen oder Stalin erwähnen können. Busch saß also da wie ein unzurechnungsfähiger Greis, völlig ignoriert, und wurde langsam rasend. Wusste ja nicht, was er falschgemacht hatte. Dann explodierte er, und alles war vorbei. Glücklicherweise war es eben der letzte Drehtag. Diese Misstimmung war aber völlig fehl am Platze, wo es sonst im Großen und Ganzen so harmonisch gelaufen war.
„Ich war im Kommentar Busch und darum auch der DDR gegenüber völlig loyal.“
Waren Sie frustriert, als Sie nach Hause kamen?
Wochenlang. Ich wollte ursprünglich auch den Busch als Erzähler vermitteln. Seinen ganzen Witz, den ich durch die Jahre erlebt hatte. Der ist aber durch seine Ansagen und Kurzkommentare dennoch durchgekommen. Ich war im Kommentar Busch und darum auch der DDR gegenüber völlig loyal. Was ich alles an Konfliktstoff bewusst ausgelassen habe! Und auch keine Andeutungen davon. Das war ich ihm schuldig.
Betrachten Sie das heute als Schönfärberei?
Eine erlaubte Stilisierung, würde ich sagen.
Was meinten die Dänen, denen er bis dahin ja weitgehend unbekannt war?
Die Sendung kam sehr gut an. Im Westen war die Einstellung in den Medien damals durchgehend links. Zum „Lob des Revolutionärs“ konnte man ohne Schwierigkeiten Dokumentarfilmzitate mit Lenin zeigen. Aber auch konservative Zeitungen waren von diesem Busch positiv beeindruckt. Einer der übelsten Hetzer gegen Brecht 1936, ein Redakteur, lebte noch, schrieb jetzt Fernsehrezensionen und zollte Busch seinen vollen Respekt. Es gab keine einzige Gegenstimme. Die Sendung lief zum ersten Mal am 7. November 1976, und am 16. November wurde Biermann aus der DDR ausgebürgert, und bald danach bekam Robert Havemann in Grünheide Hausarrest für den Rest seines Lebens.
Hätten Sie die Busch-Sendung auch nach der Ausbürgerung von Biermann gemacht?
Nicht unmittelbar danach. Nein, auf keinen Fall. Das war ja eine durch und durch gemeine Verfügung. Die Stimmung unter Linken auch in Dänemark entlud sich in massiver Empörung gegenüber der DDR. Da gab es mit Recht keine Nuancen. Auch die dänische KP war in Erklärungsnöten.
Haben Sie Busch verübelt, dass er die DDR-Regierung dabei unterstützt hat?
Verübelt ist ein zu starkes Wort. Ich hatte aber keine Lust, wieder nach Ostberlin zu reisen und habe ihn auch nie wieder gesehen, obwohl seine Frau schrieb: „Kommen Sie mal vorbei“ und Ähnliches. Ich korrespondierte weiterhin mit ihnen und hielt sie auf dem Laufenden. Ich habe ja auch nicht versucht, die Busch-Sendung zu sperren. Ich stand dazu und wollte sie auch gern im Ausland verbreitet sehen. Irgendwie sind das zwei unterschiedliche Sachen.
Glauben Sie, dass Irene Busch auch die treibende Kraft war bei Buschs Stellungnahme zur Biermann-Ausbürgerung im Neuen Deutschland?
Mit meinem Breth-Mildner-Erlebnis im Gedächtnis würde ich das vermuten. Er hätte eine Stellungnahme verweigern können, das wäre würdiger gewesen. Angelica Domröse erzählt in ihrer Autobiographie, sie und Hilmar Thate hätten versucht, Buschs Unterschrift für die andere Seite zu kriegen und bei ihm an der Tür geklingelt. Irene habe die Tür aufgemacht und gesagt, ihr Mann sei nicht zu Hause …
… und hinterher die Partei angerufen. Ja, ich kenn die Stelle. Ich frage mich nur, woher Angelica Domröse weiß, was Frau Busch tut, nachdem sie die Tür zugemacht hat …
Zur Biermann-Ausbürgerung gibt es so viel Literatur und auch so viele Gerüchte darüber, was wer wann getan und gesagt hat. Lesen Sie das Buch von Eva-Maria Hagen, „Eva und der Wolf“, dann sind Sie stundenlang um ihre gute Laune gebracht, um es milde zu sagen. Die Protestierer sind ja heute vielfach untereinander verkracht. Ist ein ganzer Sumpf. Die Biermann-Ausbürgerung hat aber eine Menge verursacht. Zum Beispiel, dass Armin Mueller-Stahl heute in Hollywood sitzt und gut verdient. Ein Exodus, der Jahre anhielt. Was Buschs Stellungnahme betrifft: Auch Charlotte Wasser, mit der ich mich nach der Wende getroffen habe, um mit ihr über Busch zu sprechen, hat gesagt, dass Busch überrumpelt worden sei, als er sich gegen Biermann äußerte. Und ich weiß, dass auch Fritz Cremer manipuliert wurde. Cremer hatte zuerst bei den Protestierern unterschrieben und erst auf Druck von oben bei den Stützen der Regierung. Er konnte dadurch einen Schwiegersohn, der in Gefahr war, freikaufen. Das entspricht ja auch völlig meinem Eindruck von Cremer, dass er ursprünglich für Biermann war. – Lebt Charlotte Wasser noch?
„Charlotte Wasser hat sich sehr bemüht, junge Leute in der DDR für politische Kunst zu begeistern. So auch für Busch.“
Sie ist gestorben.
Das wusste ich nicht. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Im Dritten Reich war sie Verkäuferin in einem Schuhgeschäft gewesen und hatte sich dort defaitistisch geäußert, also sie hat gesagt, Deutschland werde den Krieg verlieren. Sie wurde verhaftet, was wohl dazu beitrug, dass sie sich später politisch und kulturell so stark engagierte. Man muss sich das vorstellen: Sie ist nach New York gereist, um Paul Robeson zu sprechen, was völlig außergewöhnlich ist. Dort angekommen hat man ihr mitgeteilt, dass Robeson nicht zu sprechen sei, weil er bereits zu krank sei. Ich weiß, er war nach Jahren der Verfolgung zuletzt völlig umnebelt. Charlotte Wasser hat sich sehr bemüht, junge Leute in der DDR für politische Kunst zu begeistern. So auch für Busch.
Glauben Sie, das ihr das gelungen ist?
Kaum. Den Beruf, den sie ausgeübt hat, wurde offiziell als „Literaturpropagandistin“ bezeichnet. Klingt ja sehr militant. Dabei hat sie sehr viel Zivilcourage bewiesen. Sie wird in verschiedenen Erinnerungsbüchern positiv erwähnt, u.a. bei Günter Kunert. In gewissen Versammlungen hat sie fast als Einzige gegen die Mehrheit gestimmt. Ist eine mutige, noble Frau gewesen. In der Kulturhierarchie gehörte sie zum Fußvolk, hat trotzdem ihre Integrität behauptet.
Busch hat Biermann in seiner Stellungnahme im ND sehr deutlich als „Klassenfeind „abgefertigt …
Dem Wortlaut nach, ja. Die Biermann-Ausbürgerung mit einem Busch-Boykott zu beantworten wäre aber töricht gewesen. Da gibt es schlimme Präzedenzfälle. Nach dem Bau der Mauer musste in Westdeutschland der tote Brecht herhalten. Busch war zwar nicht tot, aber auch Anna Seghers wurde nicht boykottiert, obwohl sie wie Busch, aber nicht so direkt wie er, in der Biermann-Affäre zur Regierung stand. Die vielen Ausstrahlungen meines Films in der ARD zeigen ja auch, dass man unterscheiden konnte. Am 22. Januar 1980, als Busch seinen runden Geburtstag beging, wurde mein Film in der ARD gesendet. Am nächsten Tag wurde ich vom ZDF angerufen. Die hatten die Sendung gesehen und wollten in ihrem deutsch-deutschen Magazin, „Kennzeichen D“, gern Teil 3 von „An die Nachgeborenen“ mit Busch bringen. Völlig unpolemisch, als Ehrung. Die ARD war bereit, ihnen das Zitat zu überlassen. Ich habe sofort Ja gesagt. Und am 24. hat dann das ZDF mit dem Zitat gratuliert. War doch ein imposanter Aufwand von westdeutscher Seite.
Haben Sie sich nach Buschs Tod nochmals mit ihm beschäftigt?
Fast. Ich machte 1999 eine Sendung zu einem Themenabend über den Mauerfall, das war ja genau zehn Jahre her. Da wollte ich ursprünglich parallel über meine zwei Fernseherfahrungen in der DDR berichten, wie ich es jetzt hier tue, also 1968 mit Biermann und Havemann, 1976 mit Busch. Ich nannte das ein TV-Essay, „Risse in der Mauer“, und berichtete selber in der ersten Person. Leider bekam ich nur 70 Minuten Sendezeit und musste Busch aussparen. Aber ehe es zu dieser Entscheidung kam, war ich in Berlin und zum ersten Mal seit 1968 in Grünheide. Ich traf mich dort mit der Witwe von Havemann, Katja Havemann, Bürgerrechtlerin und Mitbegründerin des Neuen Forums, die auch noch mit Biermann eng befreundet ist, was nicht für alle Havemänner gilt, z.B. nicht für die beiden Söhne. Sie überließ mir etwas völlig Unerwartetes und Ungewöhnliches: ein Video mit Ton und in Farbe, das 1982 in Grünheide gemacht worden war anlässlich des letzten Besuchs Biermanns bei dem todkranken Havemann. Dieser Besuch war von Honecker persönlich als humanitäre Geste bewilligt worden, wurde aber damals geheimgehalten. Das Video dauerte ungefähr eine Stunde, war aber schwierig in längeren Auszügen anzusehen, weil Havemann sehr schlecht aussah und auch Atembeschwerden hatte. Ich habe daraus hauptsächlich Biermanns Brief an Honecker gebracht, den er Havemann vorliest.
War auch Biermann in Ihrer Sendung von 1999?
Nein. Wollte ich nicht. Biermann hat sich auch zu sehr geändert. Er hätte mein ganzes Konzept zerschlagen. Ich stehe zu Biermann, wie er 1968 war, er selber nicht mehr. Er hat aber zum 100. Geburtstag von Brecht in der Akademie eine Doppel-CD gemacht, die die beste ist von den vielen, die aus diesem Anlass produziert wurden. Darauf feiert er auch Hanns Eisler, dessen Witwe, Stefanie Eisler, anwesend ist. Ernst Busch wird von ihm natürlich nicht gefeiert. Biermann hat ihn nach seiner Ausbürgerung mehrmals als SED-Barden abgefertigt. Wie er überhaupt jahrelang die Unterzeichner auf der Regierungsseite schlechtmachte, was in den meisten Fällen verständlich war. Es dauerte sehr lange, bis kurz vor dem Mauerfall, ehe er sich in einem Lied mit Fritz Cremer versöhnt hat. Wie das privat verlaufen ist, weiß ich nicht. Noch später, gerade um 1998, hat er dann doch in einem Gedicht Busch ebenbürtig mit Charles Laughton als Galilei erwähnt. – Wo war ich eben stehengeblieben?
Die Witwe von Havemann hat Ihnen das Video zur Verfügung gestellt …
Genau. Wegen dieser Großzügigkeit fühlte ich mich dazu verpflichtet, Katja Havemann über meinen damals noch geltenden Plan zu informieren. Also: ob sie etwas dagegen hätte, wenn Ernst Busch als dritte Hauptperson in der Sendung vorkäme. Nicht das geringste, war ja auch so ein Querkopf. Hat sie gesagt. Ich will nicht Busch entpolitisieren, das ließe sich auch nicht machen, aber fast alle, die in der DDR aufgewachsen sind, haben irgendwo eine Schwäche für Busch. Selbst der Frau Merkel, die ja, ehe sie Kanzlerin wurde, nicht selten Brecht zitierte, würde ich das zutrauen. In ihrem Fall könnte das sentimental sein, aber immerhin etwas Emotionales oder eine Abspaltung davon. Busch lässt sich nicht ohne weiteres ausgrenzen. Ich brauchte aber in diesem TV-Essay 1999 so viel Zeit für 1968 und wollte Busch nicht zur Nebensache reduzieren. Ärgerlich.
Worauf wäre es Ihnen denn in Ihrem TV-Essay hauptsächlich angekommen?
Ich hätte vor allem vermitteln wollen, dass die DDR weder „Goodbye Lenin“ noch „Das Leben der Anderen“ gewesen ist, zwei spätere Filme, die beide in Dänemark ein großes Publikum fanden und die ich beide unzureichend finde. Eine Komödie und eine Tragödie. Der Begriff „Ostalgie“ kotzt mich an, wie ich mich auch gegen die einseitige Dämonisierung durch Hernn Henckel von Donnersmarck wende.
Sie wollen neutral sein?
Keineswegs. In „Das Leben der Anderen“ wird dieser farblose Stasi-Mann ausgerechnet durch ein Jugendgedicht von Brecht bekehrt. „Erinnerung an die Marie A.“. Ein unpolitisches Liebesgedicht des späteren Kommunisten. Es wäre interessanter gewesen, wenn es durch „Lob des Revolutionärs“ mit Busch gewesen wäre. Dialektischer auch: „Wohin sie ihn jagen / Dorthin geht der Aufruhr / Und wo er verjagt ist / Bleibt die Unruhe doch.“ Das wäre ein Denkanstoß gewesen.
Der vor einiger Zeit verstorbene Filmemacher und ehemalige Leiter des Ernst Busch-Hauses Erwin Burkert sprach einmal davon, dass er Busch geliebt habe. Haben Sie eine ähnlich innige Beziehung zu Busch?
Diese Empfindung möchte ich gern mit ihm teilen. Ich habe Erwin Burkert erst nach der Wende kennengelernt und habe mehrmals, auch lange, mit ihm gesprochen. Wir duzten uns obendrein. Das ergab sich so. Aber wir blieben grundverschieden. Er hatte eine Wut auf Wolf Biermann, hat ihn tiefgründig gehasst. Und um mich zu provozieren hat er mir eine Episode aus dem Jahr 1956 berichtet, die unterstreichen sollte, dass Busch ganz anders als Biermann war. Busch teilte damals im Berliner Ensemble die Garderobe mit seinem Kollegen Wolf Kaiser. Der Aufstand in Ungarn war noch nicht niedergeschlagen, und Kaiser meinte, an den Forderungen der Aufständischen sei was dran und eigentlich solle man dasselbe Aufbegehren in der DDR vertreten. Busch sagte ihm klipp und klar, wenn es zu einer Konfrontation kommen sollte, würde er ohne Zögern für die Rote Armee auf die Barrikade gehen. Solche Berichte können mich nicht schockieren. Busch hat eben auch „Das Lied von der Partei“ gesungen, was ich ihm nicht groß anlaste. Furchtbar daran ist vielleicht nur, dass er es so überzeugend singt. Busch war kein politischer Denker oder Theoretiker. Er hielt zu seiner Partei, was er auch immer darunter verstand. „Seid euch bewusst der Macht!“ hat er der Partei zugesungen, „Dass ihr sie nie, nie mehr / Aus euren Händen gebt!“. Ich wusste nur, wäre Erwin Burkert 1968 unser Reisebegleiter gewesen, er hätte uns bei der ersten Gelegenheit glatt verpfiffen. Wir saßen aber jetzt 2001 in seiner Lieblingskneipe, die Wende war unblutig verlaufen und lag schon zehn Jahre zurück. – Gehörte er nicht ursprünglich zum Erich Weinert-Ensemble der NVA?
Weiß ich nicht.
Das Erich Weinert-Ensemble habe ich einmal erlebt. Am 1. Mai 1966 nachmittags, als es ein bisschen lustig zuging. In der Uniform der NVA haben die auf einer Tribüne „Schlag nach bei Shakespeare“ gesungen mit einem Riesenbuch aus Pappe in der Mitte. Ist ja aus dem Musical „Kiss Me Kate“ von Cole Porter. Hat mich verwundert. Wenn es „Kalinka“ gewesen wäre, dann schon …Vielleicht war der Erwin dabei.
Sie lieben ihn auch, den Busch?
Tue ich. Den Künstler sowieso. Den Menschen auch. Es ist ein Privileg, ihn gekannt zu haben. Ein furchtbar missbrauchtes Modewort dieser Tage ist die Bezeichnung „Legende“. Und besonders „legendär“. Alle sind heute „legendär“. Die „legendäre“ Gisela May, nicht wahr? Ist sie wohl kaum, hat nur ein Leben lang ihre Arbeit gemacht. Macht weiterhin „Adelheid und ihre Mörder“. Das Wort „Legende“ trifft ausnahmsweise auf Busch zu. Bei lebendigem Leibe schon totgeschwiegen, totgewünscht, totgeglaubt. Und dann immer wieder auferstanden. Ist wohl die Definition einer Legende, wenn es überhaupt eine gibt. Er war der letzte von den Großen, die ich besonders hoch verehre. Aber auch wenn ich zum Beispiel Brecht und Eisler gekannt hätte, wäre Busch etwas ganz besonderes gewesen. Dessen bin ich mir sicher. Mich mit dieser Legende zu beschäftigen finde ich nach wie vor schön. Den Menschen dahinter so eingehend gekannt zu haben, macht es noch schöner. Ist nicht unbedingt nötig, aber bereichert das Erlebnis um eine weitere Dimension.
Haben Sie ein Lieblingslied von ihm?
Wenn man eins wählt, bereut man im nächsten Augenblick und möchte ein anderes wählen. Weil es so viele gibt. „Das Solidaritätslied“ könnte man eventuell noch unter dem Galgen hören. Da hat Busch an der Endfassung mitgetextet ohne das Produkt zu beschädigen. Auch die ganzen Spanien-Lieder, die er 1937-1953 auf Platte gebracht hat, möchte ich nicht missen. Jürgen Elsner hat sie als sentimental bezeichnet, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist Gebrauchslyrik und Gebrauchsmusik, ist aber mit Recht auf der ganzen Welt berühmt. Merkwürdigkeiten wie „Peter, mein Kamerad“ gehören zum Nachtrag und sollten nicht mitgezählt werden. Wogegen ich „Jeder Traum“ von Fürnberg und Ernst Hermann Meyer, das so viele mögen, unerträglich finde. Die Melodie ist von einem verlogenem Pomp, Brecht hat einmal Meyers Musik als „Schmalz“ bezeichnet, und das trifft auch hier zu. Busch strengt sich an, kommt zu kurz und wird eben vor lauter Anstrengung – sentimental. Eisler und Meyer, die sind im Vergleich wie Himmel und Fegefeuer. Die Tucholsky-Lieder, die besten davon, sind unverwüstlich, obwohl Eisler sie ganz nebenbei komponiert hat – als fast food für den unersättlichen Busch. Hören Sie sich „Sehnsucht nach der Sehnsucht“ an, hat etwas ganz besonderes, obwohl es Busch geärgert hat, dass das im Westen besonders gut ankam. Ich glaube, weder Tucholsky, noch Eisler, noch Busch waren privat besonders glückliche Menschen. Das hätte zu unproduktiver Melancholie führen können, zur Resignation. Tucholsky hat sich das Leben genommen, Eisler war nicht selten deprimiert, wenn Busch aber singt: „Die Wirklichkeit hat es ja nie gekonnt, weil sie nichts hält“, ist das nicht Resignation, sondern Triumph über das Unvollkommene. Ein Loblied auf die Fantasie eben: „So süß ist keine Liebesmelodie, / so frisch kein Bad, / so freundlich keine kleine Brust wie die, / die man nicht hat.“ Busch als Erotiker noch dazu, hört man leider zu selten.
Hat Ihnen eigentlich die Tatsache, das Sie aus dem Norden stammen, bei Busch Kredit verschafft?
Könnte man schon sagen. Eher als der Gruß von Paul Dessau. Natürlich hatte ich schon beim ersten Besuch den dänischen Rundfunk erwähnt, aber beim zweiten, der mit dem Gruß von Dessau eingeleitet wurde, kamen wir irgendwie auf die Regionen zu sprechen und ich sagte, dass ich aus Nordschleswig bin. Dann wollte er das genauer wissen und ich nannte meinen Geburtsort. Es gibt deutsche und dänische Namen für diese Kleinstädte. Da sagte er: „Ah, Apenrade, Hadersleben, Tondern, kenne ich doch alles.“ Und er ging ins Nebenzimmer, er war ja immer sehr schnell, und kam nach weniger als einer Minute mit einem Foto zurück, das seinen Großvater mütterlicherseits aus Hadersleben zeigte. Und zwar in dänischer Uniform im Krieg der Dänen gegen die Preußen 1864. Düppeler Schanzen und so. Als er mir dann das Charlotte Wasser-Heft gab, schrieb er als Widmung darin: „Von einem alten beinah Dänen“. Er muss diese Ortschaften in seiner Kindheit und Jugend besucht haben. Also, es gab durchaus so etwas wie eine landsmannschaftliche Verbindung.
Interview: Jochen Voit
Foto: Tinne Vammen
(Interviewfassung autorisiert und sehr stark nachbearbeitet von Hans Christian Nørregaard im August 2007)

Karl-Heinz Ocasek
über seine Arbeit als Schallplattenproduzent in der DDR und seine aktuelle Aufgabe als Liederverwalter von Ernst Busch
„Ernst Busch war ein Jahrhundert-Mann!“
(Gespräch am 6. Januar 2000 in Kleinmachnow)
Karl Heinz Ocasek ist Jahrgang 1939. Er wächst im sächsischen Riesa auf und absolviert zunächst eine Lehre im dortigen Stahlwerk. Im betriebseigenen Chor ist er aktiv, lernt Gitarre- und Klavierspielen. In dieser Zeit hört er auch erstmals Lieder von Ernst Busch. Nach der Lehre studiert er Musik und wird Produzent beim staatseigenen Label VEB Deutsche Schallplatten. Der Betrieb geht zurück auf die 1946 von Ernst Busch gegründete Firma Lied der Zeit. Ocasek schließt sich der in den 60er Jahren entstehenden Singebewegung in Berlin an und wird Mitglied des Oktoberklubs. Als Produzent ist er 25 Jahre lang (bei dem Sublabel Amiga) für Unterhaltungsmusik zuständig. Nach der Wende und dem Aufkauf der wichtigsten Firmenbestandteile durch Bertelsmann wird er arbeitslos. Er beginnt, Material von früher zu sammeln und eine eigene Plattenfirma aufzubauen. So entsteht der Musikverlag Barbarossa. Herzstück des Verlagsprogramms ist das sängerische Werk Ernst Buschs.
Das Gespräch findet in Karl-Heinz Ocaseks Wohnhaus in Kleinmachnow bei Berlin statt. Es dient als Grundlage für meinen Artikel zu Buschs 100. Geburtstag in der Süddeutschen Zeitung (22./23. Januar 2000).
JV: Sie sind seit einiger Zeit im Besitz der Rechte an den Busch-Liedern. Wie ist es dazu gekommen?
Karl-Heinz Ocasek: Es war so: Die gesamten Aufnahmen von Ernst Busch sind ja in der DDR beim VEB Deutsche Schallplatten erschienen, diesem Staatslabel, das es gab. Und nach der Wende wurde dann alles verkauft. Ich habe da seit 1969 gearbeitet, als Redakteur und Produzent, habe also auch sehr viele Sachen dort selber produziert und betreut, also von Puhdys (eine der bekanntesten Rockgruppen der DDR, JV) angefangen über sonstwas alles, und habe noch bis ’94 da gearbeitet. Als einer der letzten habe ich dann diesen Betrieb verlassen und mich gefragt: Was passiert denn eigentlich hier? Da ging ein Stück nach dem andern, von dem, was wir mal selber gemacht hatten, den Bach runter: Der gesamte Eterna-Katalog wurde an die Edel-Company verkauft in Hamburg, die haben dann also diese Klassik-Sachen rausgebracht. Und alles andere, was so Amiga, Neues Lied, Busch und so wat alles war, wurde dann an die Ariola verkauft, an Bertelsmann – zu einem Preis, wo ich heute sagen würde: Das würde ich auch schultern, sozusagen…
Das war praktisch ein Scherz …
Ja, ja, das war es. Da wurden Altlasten übernommen…
Wie hoch war er denn, der Preis?
Es ging um acht Millionen. Aber wenn man bedenkt, was da rauszuholen ist, und was da möglich ist, das hat sich also bis heute schon mindestens zehnmal amortisiert durch die gesamte Herausgabe dieser Sachen. So, und dann habe ich also angefangen, ’94 meine erste CD zu veröffentlichen. Aber das hing einfach damit zusammen, dass ich damals arbeitslos war und dachte: Wie geht denn das nun eigentlich weiter? Nun bin ich auch in ’nem Alter, wo man nun auch nicht allzu viel Chancen hat, auf diesem Sektor noch irgendwas zu werden. In meinem Alter ist man dort entweder Chef oder ist schon längst weg.
Was heißt in Ihrem Alter? Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
Ich bin jetzt 60. […] Ich habe dann also meine erste CD veröffentlicht, das war der „Canto General“ von Mikis Theodorakis…
…dieses berühmte Konzert…
…ja, und das funktionierte insofern ganz gut, als mir nämlich Zweitausendeins auf einen Schlag 3000 Stück abgenommen hat, natürlich zu ’nem fairen Preis und so. Aber plötzlich merkte ich: Es funktioniert.
Für Sie stand nie was anderes zur Debatte, als etwas im Musikbereich zu machen…
Eigentlich wollte ich nichts mehr in diesem Bereich machen… Nein, ich hätte irgendwas anderes gemacht. […] Ich war ein halbes Jahr arbeitslos, dann war ich in einem Kulturverein, habe dort Konzerte organisiert und Veranstaltungen, Lesungen und so. Das war ’ne sehr schöne, angenehme Arbeit. Man war wieder mit Leuten zusammen und konnte was bewegen. Und nebenher habe ich also dann mein Label aufgebaut, habe eine Produktion nach der andern selber gemacht oder übernommen oder gesucht: Wo gibt es noch Rechte und so. Das funktionierte dann so, dass ich mich ’96 selbstständig gemacht habe […]. Das ist natürlich immer so ein Balance-Akt, das kann man eigentlich nur machen, wenn man genau abwägt: Kann man das machen, oder kann man’s nicht machen? Und dann kommt es auch drauf an, ob man Lust dazu hat oder nicht. Und dann macht man eben auch manchmal Sachen wie den Heiner Müller, wo ich von vornherein weiß: Das bringt die Kosten nicht wieder rein. Aber wenn man dann eben einen guten Katalog hat, dann kann man sagen: Das schmückt, und das will ich gerne machen. Das gehört zu meinem Wissen, zu meiner Kultur, zu dem, was ich mal gemacht habe. Und dann macht man eben so was.[…] So ergibt sich eins nach dem andern.
Was waren denn Ihre Stationen bei der VEB Deutsche Schallplatten? Sie haben gesagt, Sie haben die Puhdys produziert… Haben Sie mehr im Rockbereich gemacht oder mehr Chanson oder Liedermacher?
Ich habe fünf Jahre Musik studiert in Dresden, Klavier und Gesang, und war dann zwei Jahre freischaffend nach meinem Diplom und habe dann 1966 beim Rundfunk angefangen als Musikredakteur und habe ’69 bei der Schallplatte angefangen. […] Durch diese gesamte Ausbildung waren wir Allrounder: Ich habe also mit der Staatskapelle Dresden Operetten produziert, habe Liedermacher gemacht, habe Volksmusik produziert – das gehörte dann quasi zur Allgemeinbildung. Wobei mir natürlich sehr viel auch die Arbeit beim Rundfunk geholfen hat. Ich war da in so einer Abteilung, die nannte sich „Volkskünstlerisches Schaffen“, und da fiel alles darunter: Amateur-Tanzmusik, die normale Volksmusik, Liedermacher und die Singebewegung, eine Jugendbewegung, die damals im Entstehen war. […]
Für welche Art von Musik konnten Sie sich persönlich am ehesten erwärmen?
[…] Am meisten haben mich natürlich Sachen interessiert, die so in die klassischen Bereiche gingen, weil ich selber auch privat eigentlich fast nur Klassik höre. Auch meine Kinder machen Musik: Geige, Flöte. Meine Frau spielt Geige, wir machen Hausmusik und so…
Dann wären Sie bei Eterna doch eigentlich besser aufgehoben gewesen…
Nee, die waren mir schon wieder zu steril. Nee, nee, das war schon okay so, auch vom Arbeitsklima her. Und vor allem: Bei dem, was ich gemacht habe, war man viel näher dran am Leben. […] Und ich habe auch viele Liedermacher produziert: Hans-Eckardt Wenzel, Kurt Demmler, Gerhard Schöne und so wat. Das war so ’ne Welt, wo ich merkte: Da is wenigstens noch ’n bissl was zu bewegen. Bei den Sachen, die man mit den Rockgruppen gemacht hat, da ging’s immer um Textdiskussionen und so. Also, viel war da nicht zu bewegen. Da hat man sich immer irgendwann auf so ’nem Nenner gefunden, wo man über verschiedene Wege rausgekriegt hat, ob man das noch machen kann oder nicht mehr. Und dann wurde immer so’n Kompromiss geschlossen, dann wurde gesagt: na gut, okay. Deswegen sollen die Rockgruppen heute nie sagen, sie seien zensiert worden oder so, das war ’ne gegenseitige Zensur!
Was heißt „gegenseitig“?
Na ja, man hat sich dann irgendwo getroffen und hat gesagt: „Pass mal auf, also das Wort Intershop oder irgend so ’n blödes Ding, das muss raus!“ Dann ham’se gesagt: „Na gut,
okay, dann nehmen wa halt was anderes“.
Gehörte das auch zu Ihrer Aufgabe, auf die Inhalte zu achten?
Sicher, das gehörte schon dazu. Wobei: Ich hab mich da nie als Zensor verstanden. […] Zu ’nem Produzenten gehört natürlich, dass er für das Produkt rundum zuständig ist. Das hing mit Produktionsabläufen und allem zusammen und Texten und Musik und so.
Es durfte eben nichts dabei rauskommen, wo es am Ende hätte Schwierigkeiten geben können…
Ja, sicher, sicher. Aber das wusste jeder. […] Es gibt bestimmte Sachen, die man sich anhören kann, wo heute selbst Leute, die damals in der Szene standen, sagen: „Wat? Und das is damals produziert worden?“ Das sind so Sternstunden, wo mal einer nich richtig aufgepasst hat. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass wir bei der Schallplatte relative Freiheiten hatten. Also zum Beispiel Fernsehen und Rundfunk waren irgendwie dem Zentralkommitee unterstellt, auf so ’ner Ebene, gehörten zum Ministerrat oder so wat. Und die Schallplatte gehörte zum Ministerium für Kultur, und die musste immer am Jahresanfang ’n Programm vorlegen, was veröffentlicht werden sollte. Und da hat irgendeener da mal drübergeguckt und hat gesagt: „Is ja in Ordnung“. Und dann hat er vielleicht gesagt: „Ja, aber Vera Oelschlegel is doch da gar nich drinne“. Das war die Frau von, weiß der Teufel, von irgend ’nem Bezirkssekretär von Berlin oder so wat. Dann wurde gesagt: „Ach Gott ja, Vera!“. Und dann wurde irgend so ’ne Alibi-Platte mit reingeschoben. Also, irgendwo hat man sich getroffen. Und die Texte wurden, wie gesagt, also die Inhalte wurden dann in der Redaktion abgestimmt und mit den Gruppen. Und dann wurde eben halt so hin und her diskutiert.
Aber man musste sozusagen schon auf Parteilinie sein, um da arbeiten zu können, oder? Das war ja ein großer Betrieb, der Sachen produziert hat, die irgendwo auch für das Bild der DDR standen. Hat man drauf geachtet, dass Sie alle in der SED waren, war das wichtig?
Nee, das war nicht wichtig.
Oder war es eher umgekehrt? War das eher eine Zelle, wo man sich noch was rausnehmen konnte?
Das war’s auf alle Fälle! Verglichen mit der Zensur und den Produktionsbedingungen beim Rundfunk: Da wurde wesentlich mehr reingeredet als bei uns. Bei uns gab’s doch relative Freiheiten. Und das haben wir immer eigentlich damit begründet, weil wir gesagt haben: Okay, so’ne Platte, wenn wir die produzieren, dann is das so’n Gesamtbild, die hat 12 Titel. Und da gibt’s mal einen, der ’n bissl bekennender is und dann natürlich auch ’n bissl Kritik und so. Also, das war schon relativ ausgewogen. Nein, nein, das wär ja unsinnig, wenn da lauter so stramme Leute gesessen hätten – dann hätte man das gleich zumachen können. Wir waren ja alle interessiert, ’n bisschen wat einzubringen oder zu verändern. Natürlich nicht gewaltig, das konnte man sich damals gar nicht so vorstellen.
Wie war das dann mit Ernst Busch? Hat der in Ihrer Arbeit schon eine Rolle gespielt? Kannten Sie ihn vielleicht sogar?
Jaja, ich kannte ihn. Hier in diesem Buch gibt es auch ein Bild. Mal sehen, ob ich es finde […]. Ich blättere es mal durch, dann werde ich’s irgendwann finden (Bildband von Hoffmann/Siebig enthält auf S. 348 Foto von Buschs 70. Geburtstag, bei dem ihm Mitglieder des Berliner Oktoberklubs, darunter Karl Heinz Ocasek, ein Ständchen darbringen, JV). Ja, ich kannte ihn. Außerdem hat er ja auch im Reichstagsufer bei uns produziert, wo unser Sitz war. […] Das war direkt am Reichstag, die ehemalige Reichskanzlervilla war der Sitz der Deutschen Schallplatte. […] Dort habe ich ihn öfter getroffen, er war da schon sehr alt, also ich kannte ihn schon.
Haben Sie ihn auch mal bei Aufnahmen erlebt?
Jaja, habe ich auch. Aber immer nur so mal im Hintergrund. Und dann musste man möglichst wieder verschwinden, weil er war da sehr eigenartig…
Was heißt eigenartig?
Als er dann produzierte – so ab 1970 – war er auch nicht mehr so ganz gut, und das hat er dann selber schon gemerkt. Und das ist immer ’n Problem: Wenn man dann im Studio steht, kriegt man schon mit, dass die Stimme nicht mehr so ganz modulationsfähig ist. Deswegen hatte er da natürlich was dagegen. […] Man wird immer mal an ’ner falschen Stelle erwischt oder an ’ner schlechten Stelle. Und außerdem war er da auch schon, ja doch ziemlich…
Er war nicht mehr fit?
Nee, er war nicht mehr fit.
Aber Sie selbst haben damals keine Songs mit ihm produziert, oder?
Nee, das nicht.
Aber Sie mochten ihn und seine Lieder…
Ja, ja, sicher, sicher!
Sonst kommt man ja auch nicht auf die Idee, all die Lieder neu herauszugeben. Sie machen das ja nicht aus finanziellem Interesse, all die Platten und Bänder im Keller einzulagern. Um also nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen: Wie hat sich das denn abgespielt mit den Rechten an den Busch-Liedern?
Also, es hat eigentlich damit angefangen, dass ich natürlich auch suchen musste: Wo krieg ich denn billig Material her, um etwas zu veröffentlichen? Da hab ich also damals zwei CDs veröffentlicht: „Der Rote Orpheus“ und „Der Barrikaden-Tauber“. Das ist Material, was frei ist, nach 50 Jahren ist die Schutzfrist für künstlerische Leistungen abgelaufen. Und diese Lieder hat er alle in den 30er Jahren produziert. Und da habe ich also überall die alten Schellacks zusammengesucht, denn die sind ja eigentlich nur auf alten Schellacks erhalten geblieben, habe also in Archiven überall gesucht, bei Sammlern und so – bis ich seine gesamten Sachen aus dieser Zeit zusammen hatte. Und die habe ich dann veröffentlicht…
… von den Schellacks …
…von den Schellacks, jaja.
Da gibt es wahrscheinlich keine Matritzen mehr…
Nein, nein, nein, das ist alles weg!
Die Klang-Qualität ist erstaunlich gut.
Ja, das ist natürlich auch sehr aufwändig bearbeitet. Kostet auch sehr viel Geld, das wird dann über Computer gemacht. […] Und dann war es aber plötzlich mit dem Busch-Material alle, und es ging nicht mehr weiter. Und dann habe ich im Rundfunk-Archiv gesucht und bin darauf gestoßen, dass er dort 1959 mal ’ne ganze Masse von Tucholsky-Songs produziert hat, damals noch mit Hanns Eisler zusammen. Und dann hab ich die mal verglichen und habe mitgekriegt, dass die ja gar nicht identisch sind mit denen, die er später produziert hat. Und daraufhin habe ich mir die dort (beim Deutschen Musikarchiv-Ost, JV) gekauft und habe die veröffentlicht. […] Das waren 24 Titel, da fehlten mir aber noch sechs, dann hätte ich zwei CDs machen können. Ich habe also bei den Leuten von Ariola, also Amiga, angefragt, ob sie mir nicht aus dem alten Busch-Bestand, den sie ja haben, ob sie mir da nicht sechs Stück geben können, damit ich zwei CDs machen kann. Da ham die gesagt: Nee, das geben ’se nicht raus, weil sie wollen das selber machen. Das hat mich doch irgendwie sehr geärgert und gewurmt, und daraufhin habe ich mich mal in die Akademie der Künste begeben. Er war ja Mitglied der Akademie der Künste früher, und dort gibt es auch das Ernst-Busch-Archiv. Und ich habe dort mal in dem gesamten Aktenbestand recherchiert und bin dann darauf gestoßen, dass also diese Aufnahmen, die später veröffentlicht wurden, alle in Zusammenarbeit zwischen der Akademie der Künste und Ernst Busch produziert wurden; und dass Eigentümer Ernst Busch und die Akademie der Künste sind, und dass die lediglich immer nur der Deutschen Schallplatte zur Auswertung übergeben wurden. Es gab ja auch ’n eigenes Label, Aurora, auf dem nur diese Busch-Sachen veröffentlicht wurden.
Aurora war praktisch der Nachfolger von Lied der Zeit…
Ja. Da hab ich erst mal rausgekriegt, dass die Rechtslage gar nicht so ist, wie die Leute von Ariola gesagt hatten…
Ariola hatte gar nicht die Rechte…
Nee, sie hatten nicht die Rechte. Sie dachten nur, sie hätten die Rechte. Und daraufhin habe ich ungefähr ein Jahr im Stillen recherchiert. Man darf mit so was ja nicht laut werden. […] Ich habe also lange versucht, das aufzudröseln, damit das auch hieb- und stichfest ist; und bin dann zu dem Rechtsanwalt gegangen, der die Busch-Erben vertritt. Das ist seine Frau, die ist aber in der Klinik, die hat schweren Alzheimer und ist überhaupt nicht ansprechbar, und wird durch diesen Rechtsanwalt vertreten, in Pflegschaft oder so. Mit dem ging es also ein halbes Jahr hin und her…
Irene Busch war doch eine Zeit lang noch Verwalterin und hat sich um das zum Museum ausgebaute Ernst Busch-Haus gekümmert…
Ja, das Ernst-Busch-Haus in Pankow. […] Nach der Wende ging das eigentlich los, da war sie einfach nicht mehr geschäftsfähig. […] Ich habe dann also dem Rechtsanwalt genau erklärt, was ich leisten muss, um das zu veröffentlichen, dass kein Mensch sich eigentlich interessiert, dass ich diese Sachen sonst woher holen muss und aufbereiten muss. Er hatte erst Riesen-Vorstellungen von Geld, bis er es dann begriffen hat. Es gingen also dann zu ’nem ziemlich fairen Preis die Rechte an mich – mit der Option natürlich: Immer wenn ich was veröffentliche, kriegt er pro CD soundsoviel Prozent.
Und die Akademie hat das an Sie abgetreten…
Nein, nein. Die Akademie hatte irgendwann gesagt: „Nee, wir haben keene Rechte daran, wir wollen gar nichts damit zu tun haben. Das liegt alles bei Herrn Busch und den Busch-Erben.“
Dann war das doch recht günstig für Sie…
Naja, ich meine, hat schon Geld gekostet. Aber das ist unter heutigen Gesichtspunkten schon toll, dass man den Katalog von so ’nem wichtigen Menschen hat.
Sie haben das jetzt so gut wie komplett. Wenn man mal von den 30er Jahren absieht, da fehlt wahrscheinlich einiges, oder?
Ja. Und es geht natürlich nur darum, dass ich lediglich diesen musikalischen Nachlass verwalte. Es geht nicht um die Autografen und seine Briefe und so was. […] Nachdem also der Vertrag wasserdicht war, habe ich den Leuten von Ariola mitgeteilt: Ich veröffentliche jetzt das und das. Und falls von ihrer Seite aus berechtigte Ansprüche bestehen, sollen sie mir das bitte mitteilen. Und dann haben die mir geschrieben: „Ja, das geht ja überhaupt nicht, die Rechte liegen ja bei uns!“. Da hab ich gesagt: Bitteschön schauen Sie doch mal in Ihre Verträge! Und dann ham’se gesagt: „Hm, aha…“. Und dann hat sich eine Rechtsanwältin von Ariola aus München gemeldet. Die hat gesagt: „Ja, aber wir haben das doch gekauft“, ich hab dann gesagt: Wissen Sie, da hätte doch Ihre Rechtsabteilung, die diesen Kauf abgewickelt hat, mal in die Verträge reinschauen müssen. Dann hätte sie gesehen, dass die Schallplatte gar nicht berechtigt ist, diese Bänder zu verkaufen. Ja, und dann wollten sie also nun von mir noch Geld haben – dafür, dass ’se die Bänder nun also doch umsonst… Ich sage: Dann wenden Sie sich mal an die, die Ihnen die Bänder verkauft haben. Naja, und dann ging das noch ’n Vierteljahr hin und her, und dann ham’se irgendwie gesagt: „Gut, okay, dann schicken wir Ihnen jetzt das ganze Zeugs zu.“ Und jetzt habe ich die ganzen Bänder, und die liegen bei mir im Keller und werden nun langsam aufgearbeitet. Aber das war schon… Ich meine, sie haben’s Gott sei Dank kapiert, aber ich hätte nicht ’nen dreijährigen Rechtsstreit mit denen durchgehalten.
Sie sind also mit BMG/Ariola nicht im Streit auseinander gegangen?
Nein, nein, nein. […] Ich hab natürlich mit den Leuten, die den alten Amiga-Nachlass verwalten, ’n gutes Verhältnis. Erstmal sind das Leute von früher, die ich kenne, mit denen ich also zusammen gearbeitet habe und so. Und zweitens breche ich natürlich ab und zu in etwas ein, wo sie denken, das sei ihr Metier – zum Beispiel habe ich die Pionierlieder vor ihnen veröffentlicht. Aber dass sie selber auf so ’ne Idee gar nich kommen, det is was Anderes. […] Aber es hängt natürlich auch damit zusammen: Wenn die mit so ’ner Idee ankommen würden, dann müssten die das in irgendwelchen großen Repertoire-Sitzungen vorstellen und so… Wenn ich heute sage: Ich mache so wat, dann setze ich mich ans Telefon, und dann ist das morgen gemacht. Nur bei denen wird ’n Plan gemacht, und dann heißt es „Ja, was ist denn das?“. Und dann sagen die so und so. Dann heißt es: „Kennen wa überhaupt nicht! Wieviel wollen Sie denn da verkaufen?“ Und dann sagen die: „Naja, hm, 3000 Stück“, dann heißt es: „Kommen Se, lassen Se doch mal!“. Was sind 3000 Stück für einen Konzern wie Ariola? Ich meine, bei ’nem Newcomer sagen die noch:“Na gut, okay, 3000, da wird’s vielleicht mal irgendwann“, aber bei so ’nem Material sagen se: „Was is denn det?“.
Wer heute irgendwelche Lieder von Busch auf Tonträger rausbringen will, muss sich also an Sie wenden?
Richtig, ja. […]
Nur der Musikverlag Pläne in Dortmund darf nach wie vor seine drei Busch-Platten anbieten…
Die haben da noch alte DDR-Verträge. […] Das stört meine Kreise nicht.
[Ende der ersten Kassettenseite]
Das Aktivierende bei Busch
Nun zu den Busch Liedern selbst: Was bedeuten die Ihnen persönlich?
Das hängt natürlich auch mit meiner persönlichen Entwicklung zusammen. Ich kenne Busch-Lieder seit Mitte der 50er Jahre. Und das war schon jemand, der zu meinem Horizont gehört hat, ohne dass ich ihn kannte oder so wat. Aber das war eben so’n Sänger, der mir angenehm war. Es gab ja damals nicht allzuviel: Es gab Schlager, es gab Volkslieder und dann gab’s so wat, politische Lieder. […] Das hat mich angesprochen.
Was hat Sie da genau angesprochen, lässt sich das in Worte fassen?
Naja, vor allen Dingen war es seine Stimme und dann natürlich auch seine Biografie. Also, für mich war das natürlich wahnsinnig, dass jemand im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat.
Hat er denn da richtig gekämpft?
Na ja, nicht mit der Waffe in der Hand gekämpft. Er war da eben anderthalb Jahre und war natürlich immer involviert in diese ganze Geschichte, hat da Liederbücher rausgegeben, hat da produziert…
Haben Sie diese Biografie im Hinterkopf sozusagen gehabt? Gehörte das allgemein zum Wissen, dass das jemand war, der in Spanien war als Antifaschist?
Ja. Ich meine, es wurde nicht in der Schule gelehrt oder so wat. Aber das war etwas, was man so wusste, oder wo man irgendwo hingeführt wurde.
Ging das nur Ihnen so oder auch Altersgenossen, Freunden und Bekannten?
Na ja, ich stamme aus ’ner kleinen Stadt in Sachsen, und da gab’s also ein Stahlwerk, das Stahlwerk Riesa. Und das is wie im Ruhrgebiet oder so: Da gibt’s irgendein Werk, und dann müssen eben alle da hingehen als Schlosser oder dieses oder jenes. Ich habe da gelernt als SM-Stahlwerker, also am Ofen mit Kelle, ’n richtig schwerer Beruf…
Was heißt SM?
Siemens-Martin. Und dort hatten die so’n Ensemble, da hab ich im Chor gesungen und habe nebenbei dort Klavier- und Gitarrenunterricht gehabt. Ich war in so’m Malzirkel, dabei konnte ich gar nicht malen… Ich war immer sehr interessiert, irgendwas künstlerisch zu machen, weil in so ’ner Kleinstadt gab’s ja damals nichts. Es gab kein Fernsehen, es gab irgendwie ein Flohkino und nichts anderes. Es gab keine Veranstaltungen. In den 50er Jahren war es ein schwieriges Leben. Und durch meine Arbeit im Chor, wo man Volkslieder gesungen hat und eben auch diese ersten Lieder aus den 50er Jahren, die Aufbaulieder, gesungen hat, da spielte natürlich Busch auch ’ne Rolle. Weil der mit seiner Firma Lied der Zeit damals diese ersten Sachen veröffentlicht hat – so Ende der 40er Jahre. Und da war das schon für mich etwas völlig Normales. Es gab schon auch Gleichgesinnte, aber die große Masse hat das eigentlich nicht so interessiert.
War er nicht so populär?
Nee, war er nicht.
Denn da war ja schon ein Ziel: die Jugendlichen anzusprechen. Das ist dann eigentlich nicht so ganz gelungen, oder?
Nein, natürlich ist das nicht gelungen.
Das ist wahrscheinlich eher gelungen damals, als er selber noch jung war, als er mit Eisler in irgendwelchen Kneipen den Leuten was vorgetragen hat. Da gab’s dann Aufruhr und die Leute sind mitgegangen. Das ließ sich kaum wiederholen…
Nee, natürlich nicht. Da war ja auch ’ne andere Atmosphäre und so. In den 50er Jahren war das doch ’ne ziemlich bleierne Geschichte, und es gab auch wenig, wo man anfassen konnte. Und nachdem man Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre noch versucht hat zu gestalten oder Aufbau zu machen, wurde dann versucht, möglichst alles bissl runterzufahren. Und da spielte er dann überhaupt keine Rolle mehr. Das war natürlich sehr schade. […]
Busch hat sich ja selbst gar nicht unbedingt als Musiker verstanden. Wird er eigentlich von klassischen Musikern ernst genommen – sozusagen als seriöser Sänger?
Ja doch, ich glaub schon. Ich meine, sie können sicher nichts damit anfangen, was er singt und so. Aber wenn er Goethe-Lieder singt oder Beethoven-Lieder, dann ist das natürlich überwältigend. Also es ist natürlich nicht im Sinne des Kunstliedes […]. Aber das ist mir eine sehr angenehme Art, ein Beethoven-Lied zu rezipieren…
Was ist denn das Angenehme?
Das Angenehme ist, dass er so natürlich ist. Dass er ’ne Stimme hat, die das alles bewältigt, was da an Schwierigkeiten drin ist, an Koloraturen und Höhen und so wat alles. Und dass er das aber mit einer völlig normalen Stimme machen kann, also nicht so überhöht und exaltiert und ganz ohne diesen komischen Pseudo-Schein. Das ist eben eine ganz ehrliche Geschichte, die er macht.
Ist es nicht so, dass es ihm vor allem darauf ankam, den Text rüberzubringen, weil er auch so unglaublich artikulierte?
Das ja, aber Sie müssen sich mal diese Beethoven-Lieder anhören. Also, er ist ein sehr musikalischer Mensch, der spürt diesen Sachen nach, das ist fantastisch. Das ist ein richtiger Liedersänger gewesen. Ich bedaure außerordentlich, dass er zum Beispiel nie die „Winterreise“ oder so wat gesungen hat, also ’n richtiges klassisches romantisches Werk.
Hat ihn wohl nicht so interessiert…
Er hatte dafür wahrscheinlich keine Zeit. Aber ich glaube, wenn man ihn irgendwann mal darauf gebracht hätte, hätte er das vielleicht begriffen. Wobei das damals für ihn in seiner ganzen Arbeit, die er zu tun hatte, nicht so wichtig gewesen wäre. Aber wenn man mal Zeit gehabt hätte, ihn darauf anzusprechen – ich glaube, er hätte es wunderbar gemacht. Denn er hatte den Schmelz, den man dazu braucht.
Neben diesem musikalischen Aspekt: Was glauben Sie, da Sie die CDs ja auch herausgeben, welche Bedeutung haben diese Lieder heute noch? Kann Busch uns, Ossis und Wessis, überhaupt noch etwas sagen?
Es ist so, dass er ein Jahrhundert-Mann war. Er bezeichnet sich selber so. Er ist 1900 geboren […]. Und das mit den Jahreszahlen war für ihn selber faszinierend, dass ihn das immer so begleitet hat. […] Das waren also auch immer seine Lebensjahre. Er hat das 20. Jahrhundert quasi so mitverfolgt. Und er hat in dieser Zeit gelebt, und er hat auch relativ eingegriffen in diese Zeit: Also Weimarer Republik, Hitler, Emigration, Spanien, die Zeit nach ’45 – er hat da immer Lieder dazu geschaffen. Er war ja auch befreundet mit Walter Mehring, mit Kästner, mit Piscator, mit Brecht, Eisler. Er war ja wirklich in diesem Kreis einer, der dazu gehörte, einer der Großen. Und er ist ja auch von ihnen allen akzeptiert worden. Und er hat sie ja auch, Tucholsky oder so, die also immer was zum Tagesgeschehen gesagt haben, die hat er ja auch immer gesungen. Das heißt, er hat „Das 20. Jahrhundert in Liedern und Kantaten“, wie er es ja eigentlich wollte, fast vollendet. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was auch sein Anliegen war. […] So nannte er seine gesamte Entwicklung. Er hat es nicht ganz zu Ende gebracht.
Das war jetzt ein Plädoyer dafür, dass er der Zeitzeuge ist.
Ja. Nun ist es natürlich schwierig zu sagen, was er heute noch bewegen kann. Er ist heute, wie alle Leute, die Zeitzeugen waren, ’n bisschen ’n Museum – leider, möchte ich sagen. Weil es sind natürlich auch viele Sachen, die haben über diese tagesaktuellen oder über bestimmte historische Dinge hinaus auch heute noch Bedeutung. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man erst, wie aktivierend das eigentlich ist, auch für die heutige Zeit: so wat nochmal zu hören oder so wat einfach herauszustellen und anderen Leuten irgendwie nahe zu bringen. […] Ich glaube, es wird eine Zeit geben, wo die Leute so etwas wieder begreifen und wo sie so etwas auch annehmen werden. […] Weil es gibt ja im Moment niemand, der irgendwie sich als Sänger oder als Schauspieler in so einer Richtung richtig betätigt und herausstellt. Es gibt ja nur so Dinge, die irgendwo mittendrin liegen. […]
Bei der Beschäftigung mit seinen Liedern und seinem Leben ist mir aufgefallen, dass Busch sehr wenig Kritik empfunden zu haben scheint am SED-Staat. […] Glauben Sie, dass er wirklich so bedingungslos hinter der Partei gestanden hat, wie es den Anschein hat? Es gibt ja auch diese Lieder wie „Die Partei hat immer recht“, das sind Texte, die sich heute fast wie eine Satire anhören, aber es war ja sehr ernst gemeint…
Also kurz zu „Die Partei hat immer recht“: Das ist ein Lied von Louis Fürnberg. Louis Fürnberg war ein Tscheche, war in der Emigration, war Jude, ist nach ’45 auch nach Deutschland gekommen. Seine Frau lebt heute noch in Weimar, mit der habe ich telefoniert, weil ich das Lied von der Partei auf die CD nehmen wollte. Und sie hat gesagt: „Tun Sie mir den Gefallen, machen Sie’s nicht!“. Sie hat gesagt: „Wissen Sie, Louis Fürnberg hat so schöne Sachen geschrieben: Goethe auf der Reise nach Prag, und er hat wunderschöne Gedichte geschrieben, er hat Romane geschrieben.“ Und sie hat gesagt, sie wird angefeindet in Weimar wegen diesem Lied. […] Das kann nur aus der Zeit heraus verstanden werden: ’45, ’46 hat er das geschrieben. […]
Andere hat das nicht gekümmert. Auf der Compilation-CD vom Deutschlandfunk mit dem Titel „Die Partei hat immer recht“ ist das Lied enthalten – ohne Rücksicht auf die Witwe.
Ja, is mir völlig klar! Na sicher is mir das klar.
Sie haben das Lied deswegen nicht mit drauf genommen, weil die Witwe Louis Fürnbergs Sie darum gebeten hat?
Ja. Ich meine: Es gibt keinen rechtlichen Grund, der mich gehindert hätte, es drauf zu nehmen. Ich hätte es auch gerne drauf gehabt, weil verschiedene Leute mich angeschrieben haben und gefragt haben: „Warum ist denn das Lied von der Partei nicht drauf?“ […] Und es gehört ja auch zur historischen Vollständigkeit. Die haben gedacht, ich will das irgendwie aus der Biografie ausklammern oder so wat. Ich meine: Da die CD vom Deutschlandfunk ’ne eindeutige Stoßrichtung hat, ist mir das klar, dass die das drauf genommen haben. […] Gut: Der Staat, den es dann nach ’45 hier gab, das war ja der Staat, […] in dem er dann gelebt hat, und das war der Staat, ob in dieser Form oder nicht, der seit dem Anfang seiner politischen Interessen für ihn dann am Ende stehen sollte. Da gab es also ’ne ganze Masse von Gleichgesinnten: von Brecht über Eisler bis Heinrich Mann… Sie können also da die ganze Garde dieser linken Leute nehmen, die damals hierher gekommen sind, mit denen er da in einer Gemeinschaft war. Und dann haben die irgendwann gemerkt: Oh Gott, das geht ja völlig gegen den Baum hier. Also das geht in eine andere Richtung, als sie eigentlich wollten. Das war Anfang der 50er Jahre, wo die dann merkten: Jetzt entsteht hier etwas, was wir kennen und was wir eigentlich nicht wollen. Das kennen wir erstens aus dem Dritten Reich, sie haben es nicht so laut gesagt, aber ’n paar Strukturen waren ja irgendwo da […]. Ich weiß das aus vielen Gesprächen mit alten Leuten, die in dieser Zeit bewusst Einfluss gehabt haben, also jetzt keine Staatsfunktionäre oder so, aber alte Leute von der Weltbühne und so. […] Die haben sich in eine sogenannte „Innere Emigration“ zurückgezogen, haben nur in ihren eigenen Zirkeln ihre Sachen, ihr Unverständnis geäußert und haben natürlich nach außen hin immer versucht, irgendwo ’n bisschen noch die Fahne hoch zu halten. Aber eigentlich waren sie da schon zum größten Teil enttäuscht. Zum Beispiel: Wie Busch 1953 enteignet wurde, ging ja voraus die gesamte Zeit 1950/51/52, als er von der Kunstkommission irgendwie reglementiert wurde, die also in seine Produktionspläne reingeredet haben, die gesagt haben: „Also, das machen Sie bitte nicht!“, und so wat alles. Das ist ja auch dokumentiert, wo Eisler dann geschrieben hat: „Lieber Ernst, lass Dir das doch nicht gefallen!“…
Ist das denn richtig, die Formulierung „enteignet“? War es denn wirklich so, wollte das Busch nicht sowieso abgeben?
Nö, nö, das kann man schon sagen.
War es nicht in seinem Sinne?
Es war so: Er hat ’46 von der sowjetischen Militäradministration die Lizenz gekriegt, und er war Geschäftsführer […], er hatte, weiß ich nicht, 100 Prozent Anteile, war ja ’ne GmbH. […] Er war natürlich kein Geschäftsmann, und irgendwann wurde ihm das schon zu viel. Ich meine, er hätte es schon gerne abgegeben, aber er hätte es natürlich als Besitzer weiter geführt, das hätte er schon gerne gemacht. Denn aufs Geld hat er auch immer ’n bisschen geguckt.
Als wir am Telefon gesprochen haben, haben Sie Carola Neher erwähnt, mit der Ernst Busch ja befreundet war. Sie sagten, selbst da sei ihm nichts aufgegangen, und das fänden Sie heute auch schwierig, und das könnte man schwer nachvollziehen… Es war doch Carola Neher, die unter Stalin…
…irgendwo verschwunden ist in Arbeitslagern, ja. Er war sehr mit ihr befreundet. Ja, das ist eben etwas, wo man ihn nicht mehr befragen kann, wo ich eben auch so meine Zweifel habe: Wieso hat er nicht irgendwie selbst begriffen, was da läuft? Oder wie stark war sein Glaube an diese kommunistische Idee, dass er so wat weggesteckt hat und gesagt hat: „Okay, das sind eben so Opfer auf’m Weg“, oder so. Oder wieso hat er 1949 noch Lieder über Stalin gesungen? Er hat ja so ’ne ganze Serie gemacht, mindestens zehn Lieder oder so…
Bringen Sie die auch raus?
Da ist nur noch ein Teil erhalten, die anderen sind weg.
Wieviele haben Sie?
Ungefähr vier oder so.
Bringen Sie die raus?
Ja, klar.
Mit Kommentar?
Mit normalem Kommentar, mit Text.
[…]
[…] Man kann ihn nicht mehr befragen, und man weiß nicht, was in diesen Leuten vorging. Ich meine, Sie können ja heute noch alte Leute fragen, die damals schon in der Weimarer Republik gelebt haben und die jetzt vielleicht noch übrig geblieben sind, und die immer noch zu diesem Staat (der DDR, JV) gehalten haben, was die für ’n Verhältnis dazu haben. Ich glaube schon, dass die DDR für die immer noch der Staat ist.
Sie meinen die Leute, die drei verschiedene deutsche Systeme, oder jetzt sogar vier, erlebt haben?
Ja. Es sind so viele Sachen, die passiert sind… Wobei, man hat ja selber so viele Dinge erlebt, wo man sagt: Meine Güte, eigentlich hätte man da irgendwann auch mal eingreifen müssen. Ich meine, Sie sind vielleicht noch nie in so ’ne Verlegenheit gekommen…
Nee.
Aber das sind so Sachen, die passieren einem auf ‚m Weg durchs Leben. Er hat ja zum Beispiel seinen Zoff mit der Partei auch gehabt, weil er gesagt hat „Ich will jetzt endlich mal wissen, warum mir 1941 nicht ein Visum für die Sowjetunion erteilt worden ist, als ich in Paris darum gebeten habe!“ Dann wär ihm nämlich das alles nicht passiert. Aber ihm wurde das damals abgelehnt von der sowjetischen Botschaft. Und sie haben ihn ja dann ’41 in Frankreich verhaftet, und daraufhin ist er ja erst ins Zuchthaus gekommen.
[…]
[…] Ich glaube es waren auch sehr viele persönliche Dinge, die damals ’ne Rolle spielten.
[…]
Foto: Ilona Reuner
Interview: Jochen Voit

Ronald Paris
über Kunst und Politik in der DDR und sein Skandal umwittertes Porträt von Ernst Busch
„Es ist ein rücksichtsloses Bild, das gebe ich zu.“
(Gespräch am 15. Februar 2006 in Rangsdorf bei Berlin)
Ronald Paris ist Jahrgang 1933 und stammt aus Sondershausen / Thüringen. Der Vater ist Theaterschauspieler und Sänger, die Mutter Weißnäherin und Hausfrau. Paris besucht die Volksschule in Weimar und kommt 1944 zum Deutschen Jungvolk („Pimpfe“), obgleich die Eltern dem Nationalsozialismus skeptisch gegenüber stehen. Die Familie des Vaters, den Paris als Freidenker bezeichnet, wird wegen ihrer hugenottischen Abstammung durch das Regime diskriminiert. Das Kriegsende erlebt der 12jährige unter dramatischen Umständen: Gemeinsam mit anderen Familien werden seine Mutter und er aus der brennenden Bürgerschule Sondershausen durch amerikanische Soldaten gerettet. 1948 lassen sich die Eltern scheiden. Im selben Jahr beendet Ronald Paris, der mittlerweile Mitglied der FDJ ist, die Volksschule und beginnt eine Ausbildung zum Glasmaler in Weimar. Nach der Lehre steht für ihn fest, dass er Malerei studieren will. Die Hochschulreife erlangt er an der Arbeiter- und Bauern-Fakultät (ABF) der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Hier tritt er 1952 in die SED ein. Ein Jahr später zieht er nach Berlin, wo er Wandmalerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee studiert. Ab 1959 ist er freischaffender Maler in Berlin, er wohnt in Prenzlauer Berg und Weißensee („Ich bin in Berlin achtmal umgezogen“). 1961 wird er Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR und beteiligt sich ein Jahr später an der IV. Deutschen Kunstausstellung in Dresden. Er wird Meisterschüler bei Otto Nagel an der Akademie der Künste und ist 1967 Mitbegründer der Grafik-Triennale „Intergrafik“, deren Vorsitz er später übernimmt. 1969 porträtiert er erstmals Ernst Busch; innerhalb von drei Jahren entstehen zahlreiche Zeichnungen und zwei Gemälde, die den Sänger und Schauspieler nicht wie gewohnt in heroischer Pose zeigen, sondern als abgekämpften alten Mann. Im Herbst 1972 wird das Ölbild „Ernst Busch II“ auf der VII. Kunstausstellung der DDR in Dresden gezeigt, was zu einer Kontroverse zwischen Maler und Modell führt, die im Verschwinden des Gemäldes gipfelt. Ernst Busch ist noch Jahre später so erbost über die Darstellung, dass er dem Maler 1977 bei einer Preisverleihung in Rostock den Handschlag verweigert. Das umstrittene Bild gilt bis heute als verschollen. Ronald Paris erhält über die Jahre für sein umfangreiches und vielseitiges künstlerisches Werk zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Von 1985 bis 1991 ist er Vorsitzender (einstimmig gewählt, wie er betont) des Verbandes Bildender Künstler der DDR im Bezirk Berlin. In dieser Funktion beteiligt er sich 1989 an politischen Kundgebungen und ist Mitorganisator der großen Demonstration am 4. November auf dem Alexanderplatz. Seine Haltung zur DDR beschreibt er rückblickend als „kritische Position zu den bestehenden Verhältnissen“. Von 1993 bis 1999 ist er Professor für Malerei an der Hochschule für Kunst und Design „Burg Giebichenstein“ Halle/Saale. Ronald Paris hat vier Kinder und lebt mit seiner zweiten Ehefrau Isolde Hanke in Rangsdorf bei Berlin.
Erst wenige Wochen vor meinem Besuch ist Ronald Paris aus Indien zurückgekehrt, wo er seinen Sohn besucht hat. Er zeigt mir sein prall gefülltes Skizzenbuch und spricht von der Freundlichkeit, Offenheit und Neugier der Menschen, die er kennengelernt hat. Unser Gespräch findet zunächst im Wohnzimmer statt; als es dunkel wird, setzen wir es im Atelier des Malers fort. Paris ist ein guter Erzähler und liebt Aphorismen. Mit ihm über Kunst zu sprechen, heißt auch, über Politik zu diskutieren. Paris mahnt humanistische Grundwerte in der Gesellschaft an, und am Ende gelingt ihm sogar der Brückenschlag von Busch zu Bush. Die hier wiedergegebene Textfassung dokumentiert Ausschnitte des vierstündigen Gesprächs.
________________
Literatur zum Werk:
RONALD PARIS: Malerei. Wirklichkeit und Annäherung. Leipzig 2004 (hier enthalten auch der Aufsatz von Günter Meier: Ein Gemälde in Haft, S. 101-104).
HERMANN RAUM: Kassandarufe und Schwanengesänge. Kritische Bilder und Skulpturen aus der späten DDR. Unna 2001.
Die Busch-Bilder, über die gesprochen wird, finden sich unter Bildende Kunst.
________________
Jochen Voit: Wie ist es gekommen, dass Sie 1969 erstmals Ernst Busch porträtiert haben?
Ronald Paris: Ausgangspunkt war die Graphikmappe „Künstler sehen Künstler“. Die hat damals der Kunsthistoriker Lothar Lang beim Institut für Lehrerbildung herausgegeben. Und Liz Bertram, die Witwe des Malers Heinrich Ehmsen, die bei Busch in Pankow um die Ecke wohnte und mit ihm befreundet war, hat die Vermittlung gemacht zwischen Lang, Busch und mir. […] Für diese Mappe sind dann eine ganze Reihe Zeichnungen prominenter Künstler aus der DDR angefertigt worden. Manfred Böttcher porträtierte zum Beispiel den Schriftsteller Franz Fühmann, und ich eben den Busch. […]
Dabei ist es aber nicht geblieben, Sie haben sich noch darüber hinaus mit Busch beschäftigt …
Ja, das war lediglich die Ursache, warum ich mich erst mal zeichnerisch dem Busch genähert habe. Später ist noch ein Blatt entstanden: „Vier mal Busch“ – eine Lithografie mit vier Darstellungen, die damals im Rahmen der Dresdner Kunstausstellung verkauft worden ist. Davon habe ich nur noch ein Belegblatt. Die anderen Zeichnungen aus den Jahren 1971/72, die ich noch habe, waren sozusagen die Vorarbeit für das erste Porträt. Und dann hab ich noch ein zweites Porträt gemalt. Das erste ist noch existent, es hängt in Rostock in der Kunsthalle, das zweite ist verschollen, und das ist nun diese unleidige Geschichte …
… worüber Günter Meier den Aufsatz „Ein Gemälde in Haft“ geschrieben hat … Welches der beiden Gemälde mochten Sie denn damals lieber?
Ach Gott, das ist schwer zu sagen. Man schwankt zwischen dem Bekanntheitsgrad des Mannes und dem Eindruck des Privatmannes. Bekannt ist: Barrikaden-Tauber, Kommissar im „Sturm“, Galilei und was nicht alles. Das sind alles einprägsame Figuren, die Busch geschaffen hat, und gleichzeitig hat er sich selbst erschaffen: als großer Schauspieler und Sänger. Und für die Älteren wie Bruno Apitz und Alexander Abusch, die mich für mein Busch-Bild kritisiert haben, wie auch Werner Klemke, der das Bild taktlos fand, für diese Generation war Busch vor allem der Spanienkämpfer, nicht wahr. Der sein Leben riskiert hatte für die große Sache, der interniert und inhaftiert gewesen war. Der in deutscher Gefangenschaft zusammen mit Erich Honecker im Zuchthaus Brandenburg gesessen hatte, wo ihm durch einen Bombenangriff ein Balken auf den Kopf gefallen war. Durch diese Kopfverletzung war er wohl linksseitig gelähmt, was ihn sehr beeinträchtigt hat. Das ging so weit, und das wusste man auch, dass er auf eigene Gefahr spielte. Er wurde bei Langhoff und auch bei Brecht unter dieser Voraussetzung engagiert: Dass er sich den Strapazen einer Theatervorstellung von zwei, drei Stunden auf eigene Verantwortung aussetzt. Das war bekannt. Er hat aber wohl gesagt: „Das interessiert mich nicht!“ Solange er denken und spielen und handeln konnte, hat er das verdrängt und sich einfach auf die Bühne gestellt.
„Ich hab im BE mehr über Dialektik gelernt als im GeWi-Unterricht“
Woher wussten Sie das?
Ich wusste das schon früh aus Theaterkreisen. Von wem genau ich das erfahren habe, weiß ich nicht mehr genau. Ich hatte sehr viele Freunde unter Schauspielern und Theaterleuten. Während der Studienzeit hockten wir ja lieber mehr im Berliner Ensemble als im GeWi-Unterricht der Hochschule. Was darin gipfelte, dass ich mal in ’ner Versammlung gesagt habe: „Ich habe über dialektischen Materialismus am Berliner Ensemble mehr gelernt als in jeder Vorlesung.“ Daraufhin kriegte ich zum Fasching in der Hochschule Weißensee Hausverbot, weil man fand, dass ich ein Nestbeschmutzer wäre …
Sie durften nicht zur Faschingsfeier kommen?
Doch, ich durfte kommen. Weil der Direktor, der das ausgesprochen hatte, nicht da war, sagte der Studiendirektor zu mir; „Bis zwölf kannste ja bleiben.“ Ich sagte: „Ich wollte sowieso gerade gehen.“ […] Der Professor war Gustav Urbschat, ein Widerstandsmann, der auch im Zuchthaus gesessen hatte, also eigentlich ’ne Respektsperson. Aber da wir als Studenten natürlich ganz gemeine Hunde waren, kriegten wir raus, dass er über Dürer hatte promovieren wollen und zweimal durchgefallen war. Der hatte also immer so ’n schlechtes Gewissen, und wir grinsten immer und nahmen ihn nicht ganz ernst. Das ist natürlich, wenn ’s dann ums Politische geht, ’ne gefährliche Kiste …
War es von Seiten der Schulleitung nicht so gern gesehen, wenn man ins BE ging?
Naja, da müssen Sie mal die ganzen biografischen Parallelgeschichten dieser 50er Jahre lesen. Brecht war suspekt. Man konnte aber schlecht was sagen, denn der Staat hatte ihm ’n Theater zur Verfügung gestellt, und man wollte ihn hier halten. Aber bequem war er nicht, auf keinen Fall.
War er mehr so ’n Aushängeschild für draußen?
Ja, aber das ist er vor allem durch die Auslandserfolge geworden, die später einsetzten. Das gab wieder ’ne Rückkoppelung für die Popularität im Lande, und die Zuschauerräume waren immer ausverkauft. Wir Studenten saßen bei Premieren dicht gedrängt auf‘ m Topp oben, also auf ‚m dritten Rang. Wir waren ja die Claqueure, wir waren das Probepublikum bei Voraufführungen, mit denen Brecht die Reaktion auf seine „Versuche“ testen wollte. So nannte Brecht ja seine ganzen Stücke, er war ja bescheiden. Diese öffentlichen Voraufführungen waren berühmt bei Brecht, davon gab es bis zu 15 Stück, ehe die Premiere erfolgte. […]
Tischtennis, Singen, Saufen: Kontakte zwischen Kunst und Schauspiel in den 50ern
Wenn Sie „wir“ sagen, meinen Sie Ihre Mitstudenten in Weißensee?
Ja, aber auch Schauspielstudenten und alles, was damals neugierig war. Es gab rege Kontakte vor allem zu den Schauspielschülern, die alle meines Alters sind. Wir haben Tischtennis zusammen gespielt oder sind in der „Möwe“ saufen gewesen oder sind in den Höfen singen gegangen, und das Geld, das wir beim Singen verdienten, haben wir auch wieder gemeinsam in die Kneipe getragen und so weiter …
Was für Lieder haben Sie denn in den Höfen gesungen?
Ach, das waren so Spaßsachen, damals gab ’s ja noch die Drehorgelspieler, die Berliner Lieder drauf hatten. Und mitunter haben wir uns auch ’ne Drehorgel ausgeliehen bei Bacigalupo, einem Italiener in der Schönhauser Allee. Damit sind wir dann zu Geburtstagen gezogen, nicht wahr. Einmal, als Fritz Cremer Geburtstag hatte, standen wir mit dem Ding bei ihm vor der Tür – früh morgens um neune, der schlief noch. Also, das war alles immer sehr heiter …
Da haben Sie dann vor allem Berliner Liedgut zum Besten gegeben?
Ja, soweit wir es kannten, die Schauspieler waren natürlich textsicherer. Aber wir grölten eben mit, das war einfach ’ne Gaudi!
„Ah, heute geht ’s wieder ins Theater!“ – Frühe Kulturerfahrungen
Wenn wir schon dabei sind: Erinnern Sie sich an frühe Musikerfahrungen? Gab es bei Ihnen zu Hause zum Beispiel ein Grammofon?
Ja, bei uns war überhaupt das Musische sehr gegenwärtig. Mein Vater war Schauspieler, mein einer Onkel war Kunsthistoriker und Archivar, der andere Onkel war Bildhauer, sodass bei uns zu Hause Plastiken rumstanden. Also, ich hatte Verbindung zu den Künsten von früh an, das gehörte zum Alltäglichen. Als Kind freute ich mich immer, wenn meine Mutter ’nen guten Anzug rausholte, den sie selbst geschneidert hatte, und an den Schrank hängte. Das war immer ’n untrügliches Zeichen und ich wusste: „Ah, heute geht ’s ins Theater!“ In Weimar wurde nichts versäumt, was gespielt wurde. Bei jeder neuen Inszenierung war man da. Meine Mutter war natürlich auch durch ihren Mann theaterfreundlich eingestellt.
War Ihre Mutter auch künstlerisch tätig?
Naja, wenn man Weißnähen als Kunst bezeichnet, war sie auch ’ne Künstlerin. Später war sie dann aber vor allem Hausfrau.
Als Sie dann so 16, 17 waren und anfingen, sich auch politisch zu interessieren …
… ja, da kam dann bald auch Ernst Busch ins Spiel. Zum ersten Mal gehört hab ich seine Stimme in Weimar. Ich lernte dort ab ’48 Glasmaler, obwohl meine Mutter gesagt hatte: „Werd‘ bloß nicht Maler! Da muss ich dreckige Kittel waschen, und darauf hab ich keine Lust!“ Mein Onkel hatte Beziehungen zu der alten und sehr angesehenen Glasmalerei Kraus in Weimar, und die Notwendigkeit, die ganzen zerstörten Kirchenfenster zu restaurieren, war groß. Für einen Glasmaler war also genug zu tun – bis heute ist noch genug zu tun. Überhaupt müssen diese Glasfenster ständig betreut werden, weil Blei ein Metall ist, das angreifbar ist, das oxidiert. Die Felder müssen hin und wieder neu verbleit werden. Naja, so fing das an. Ich hatte das Vergnügen, als Jüngster und Leichtester, auf die Gerüste hoch zu können, das Maßwerk mit Schablonen raus zu nehmen und die Windeisenlöcher im Sandstein zu schlagen. Und ich sah natürlich auch diese frühen Scheiben und war begeistert von der Nähe, die man ja sonst nie hat, nicht wahr. Die Felder haben wir dann auseinander genommen und wieder zusammengesetzt. Dabei, beim Windeisenschlagen, ist mir ein Eisensplitter ins Auge geraten, und dadurch hatte ich ’ne Augenverletzung und bald nur noch 30 Prozent Sehfähigkeit auf dem Auge. Bis in die 80er Jahre hatte ich Operationen deswegen, und jetzt hab ich ’ne neue Linse drin und kann wieder lesen damit, was ich nie geglaubt hätte. […]
(Exkurs zur Funktion von Windeisenlöchern, wobei Ronald Paris Stift und Papier zur Hilfe nimmt)
„Die Bevölkerung wurde mit Busch agitiert über Stadtlautsprecher.“
In Ihrer Lehrzeit sind Sie offenbar auch erstmals mit Busch-Liedern in Berührung gekommen …
Ja, und zwar hatte ich immer den Weg durch diese Straßen zu gehen, die nach Admirälen der Kaiserlichen Flotte benannt waren oder irgendwas mit dem Ersten Weltkrieg zu tun hatten. Die wurden dann alle umgetauft: Die Sedan-Straße wurde zur Bruckner-Straße und so weiter. Ich wanderte also immer von der Graf-Kühn-Straße, die jetzt Thomas-Mann-Straße hieß, hoch zum Bahnhof. Und bei Wahlen und politischen Veranstaltungen, also ziemlich häufig, wurde die Bevölkerung sozusagen agitiert über Stadtlautsprecher. Diese Lautsprecher hingen in der ganzen Stadt an Masten und Mauern. Und zwischendurch sang immer Ernst Busch, offenbar waren es Schallplatten, das Moorsoldatenlied und „Spaniens Himmel“. Das hat mich interessiert! Diese merkwürdige blecherne Stimme, so was hatte man noch nicht gehört. Man kannte dieses Timbre nicht. Das war faszinierend, und das hab ich nie vergessen. […] Wir haben diese Lieder dann natürlich auch bei der FDJ gesungen, aber es war doch etwas anderes, wenn er sie sang.
Und Sie glauben, das war gedacht, um auf Wahlen einzustimmen?
Das weiß ich nicht genau. Aber Sie müssen wissen, dass Weimar in der Nähe zu Buchenwald liegt. Und die Weimarer behaupteten, nichts davon gewusst zu haben. Weimar war, wenn man so will, Thüringens Landeshauptstadt – hier war Sauckel Gauleiter gewesen, und Hitler hatte Thüringen als seinen Lieblingsgau bezeichnet. Da können Sie sich vielleicht vorstellen, was das nach 1945 für ein Bewusstsein in der Stadt herrschte. Die Leute mussten einfach, grob gesagt, eine Gehirnwäsche ertragen. […]
Wie haben Sie als junger Mann die neue Kultur in dieser Zeit erlebt?
Nehmen Sie Brecht und seine Art, Theater zu machen! Das war ja kein Unterhaltungstheater. Vorher war es unüblich gewesen, dass Theater zum politischen Denken anregen sollte. Man hatte im Grunde sein Gehirn an der Garderobe abgeben können. Und bei Brecht gab es nun auf einmal ’n episches, auf Erkenntnis ausgerichtetes Spiel. Auch die Lieder waren nun andere. Mitunter waren sie durch die Nazis umfunktioniert und missbraucht worden, vorrevolutionäre Lieder bis hin zu Liedern aus der Zeit der frühbürgerlichen Revolution. Die kamen jetzt wieder mit den alten Texten und waren dadurch für uns wie neu. Das hatte natürlich eine enorme Anziehungskraft. Auch in der Schule und der Ausbildung liefen die Dinge jetzt völlig anders. Mein Lehrer in der Berufsschule war ein Widerstandsmann, der früher Seemann gewesen und dann Malermeister geworden war. Herr Martin lief sommers wie winters mit unverhüllter, behaarter Brust durch die Stadt. (lacht) Der konnte mit seiner lebendigen Art der Geschichtsreflexion junge Leute unglaublich faszinieren. Und ich bin nicht traurig, durch Begegnungen mit solchen Leuten, etwas erfahren zu haben von den Widrigkeiten in der Nazizeit, die ich ja in erster Linie als Luftschutzkellerkind erlebt habe. […]
„Da kommt der quer über den Platz und haut mir eine runter.“
(Exkurs über die Bombardierungen der Alliierten, die Ronald Paris in Weimar und Sondershausen erlebt hat; er berichtet von der Taktik des „Bomber-Harris‘ aus London“, Feuerstürme zu entfachen, und von der „Schizophrenie“ seiner Kindheitserfahrungen: „Nach den Angriffen stürmten wir los, nicht wahr, und suchten Bombensplitter und sammelten die in Schuhkartons. Und wer die meisten und schönsten hatte, der war der König in der Klasse. So was Bescheuertes! Man hat ja überhaupt das Ganze von Anfang an abenteuerhaft erlebt, es wurde erst dann prekär, als der Krieg hautnah wurde“)
Sie sind 1944 noch zu den Pimpfen gekommen …
Ja, aber ich habe keinen Sinn für diese Raufereien gehabt und bin dann oft nicht zum Dienst gegangen. Das hatte zur Folge, dass ich eines Tages auf dem Platz vor der katholischen Kirche in Weimar eine absurde Begegnung hatte: Ich kam mit meiner Mutter vom Arzt und da ging gerade mein Fähnleinführer über den Platz. Das war einer der Söhne vom Gauleiter Sauckel, der hatte ja neun Kinder. Und der lief da zackig mit seiner Schildmütze vorbei und sah mich, und ich sah ihn. Ich dachte „Großer Gott!“ und riss meinen Arm hoch. Es gehörte sich, dass man den so grüßte. Da kommt der quer über den Platz und haut mir eine runter. Meine Mutter war entsetzt: „Was fällt ihnen ein!“ – Er darauf: „Die Pflicht ihres Sohnes wäre gewesen, Sie aufzufordern, den Gruß ebenfalls zu erwidern!“ – Dieses Arschloch, der war vielleicht 16!
Waren es die Männlichkeitsrituale, die Sie abgestoßen haben, bei den Pimpfen?
Ja, aber auch andere Dinge. Es war ja ’44, und es war Pflicht, in Dienstkleidung zu erscheinen. Nun gab es aber längst nicht mehr alles, was man so brauchte. Ich hatte zwar Koppel und Schulterriemen und das braune Hemd, aber mir fehlte ’ne Hose. Und im Winter musste man Lumberjack und Skihose haben, auch in Schwarz, und ’ne schwarze Mütze. Das hatte ich auch nicht. Immer in Ermangelung dieser Kleidung bin ich nicht zum Dienst gegangen, weil ich mich geschämt habe. Man wurde dann ja auch von den Mitpimpfen gehänselt. Also, das rückte mir alles zu sehr auf die Pelle … […]
(Exkurs zur hugenottischen Abstammung der Familie Paris und der Diffamierung der Hugenotten als „läppische Französlinge“ durch Hitler; die Brüder des Vaters seinen anfangs als „wehrunwürdig“ eingestuft worden; Bemerkungen zur Biografie des Vaters, der 1954 verstorben ist)
„Wenn Busch sang, dann ging einem das nah, das berührte einfach.“
Lassen Sie uns noch mal zu Busch und Ihrem Lautsprecher-Erlebnis zurückkommen. Das war offenbar Ihre erste Begegnung mit dem Sänger …
Das war meine erste akustische Berührung. Im Radio konnte man ihn dann natürlich öfter hören. Busch gehörte einfach zum Alltag dieser Zeit, man hörte ihn auch gern, das kam noch hinzu. Zuerst waren das die Lieder aus dem Widerstandskampf. Wenn Busch die sang, dann ging einem das nah, das berührte einfach. Das war der Vorzug dieser Kunst. Später erweiterte sich das dann mit Wedekind, Tucholsky und anderen. […] Eine Schallplatte von ihm hätte ich mir damals aber nicht leisten können. Ich hatte 45 Mark Lehrgeld im Monat, und das hab ich zu Hause abgeliefert. Meine größte Sehnsucht, ’n Fahrrad, hab ich mir erst kurz vor Ende meines Studiums erfüllt. […] Jedenfalls war mir Busch kein Unbekannter mehr, als ich ’53 nach Berlin kam.
Halten Sie ’s für möglich, dass Busch zur Politisierung bei Ihnen beitrug? Dass er überhaupt zur Politisierung Ihrer Generation stark beigetragen hat?
Das ist mit Sicherheit so. Es spielte natürlich bei jedem das Umfeld eine entscheidende Rolle. Ob man verstand, worüber da gesungen wurde. Diese Dinge verdichteten sich erst über Personen, wenn man ’n politisches Bewusstsein suchte oder bekam – man hat das ja nicht bewusst betrieben, sondern das unterwanderte einen.
Ab wann, würden Sie sagen, hatten Sie so etwas wie ein politisches Bewusstsein?
Seit ’48. Die Gründung der FDJ war ’47, glaube ich, mit dem Parlament in Leipzig. Wir traten da ein und hatten ’ne sehr schöne Grundorganisation, West 3 hieß die in Weimar. Und ich war der Mann, der den Schaukasten betreute, weil ich zeichnen konnte. Wir machten sehr viele Wanderungen und hatten auch dieses erste Liederbuch der FDJ, da waren ja auch Sachen von Busch drin. Sodass man sehr wohl zu unterscheiden wusste zwischen den Pimpf-Liedern, die ich auch gesungen hatte bis ’45, und dem, was inhaltlich dann eine völlig andere Welt eröffnete. […]
„Ich war verliebt in Moritz von Schwindt und kopierte die Sieben Raben.“
Im Jahr 1953 sind Sie dann nach Berlin gegangen. Wollten Sie da immer schon hin?
Seit der Lehre stand für mich fest, dass ich Maler werden wollte. Nur der Weg dahin war nicht gerade widerstandsfrei. […] Es gab ja drei Kunstschulen im Lande: in Dresden, Leipzig und Berlin. Das heißt, eigentlich waren es vier, denn in Weimar gab ’s auch eine, und da hab ich zuerst Anlauf genommen. Ich nahm teil am Freihandzeichen-Grundkurs bei Hans Tombrock. Damals wusste ich nicht, dass Tombrock zusammen mit Brecht in der Emigration unterm finnischen Strohdach gewesen war. Brecht schätzte ihn wegen seiner dem Proletarier zugewandten Zeichnungen. Tombrock war ’n Tippelbruder, also ’n Vagabund im besten Sinne. Jedenfalls wurde er dann Dozent an der Bauhochschule Weimar, und bei dem bin ich natürlich bei der Aufnahmeprüfung erst mal durchgefallen – aus welchen Gründen, das weiß ich heute nicht mehr. So, das war der erste Anlauf, um Hochschulreife zu erwerben. Ich war ja nur Lehrjunge und hatte die Gesellenprüfung. Und dann sagte mein Lehrer an der Berufsschule: „Dich delegieren wir nach Jena oder überhaupt zur ABF, und dann wirst Du weitersehen!“ Naja, das hat man dann gemacht. Man fragte nicht groß, wenn einem was geboten wurde, ist ja klar.
Ihr Talent war da schon sichtbar …
Es war vorhanden, aber noch nicht ausgeprägt. Man dilettierte noch … In Weimar war ich verliebt in Moritz von Schwindt und kopierte die Sieben Raben („Von den sieben Raben und der treuen Schwester“, Folge von Aquarellen, 1857-1858; J.V.). Da können Sie sich ungefähr vorstellen, was ich im Kopp hatte. Die Dimension des Künstlerisch-tätig-Seins wurde einem erst allmählich bewusst und deutlich. Ich erinnere mich noch an einen Kurs an der Bauhochschule Weimar bei Schäfer-Ast, der ein großartiger Zeichner und Karikaturist war. Der hatte immer, wenn wir mit ihm über die Wiesen zogen, die Taschen voller kleiner Skizzenbücher, und wir Anfänger kamen mit riesigen Kladden an. Das war schon mal typisch, nicht wahr: Wenn man die Welt erobern will, macht man s mit dem großen Brett. Der aber hatte kleine Büchlein. Und er saß dann in der Wiese und guckte: „Ja, Kinders, man soll nich immer Bum-Bum machen, manchmal darf ’s auch Bim-Bim sein!“ Da kriegte man erst mal so ’ne Maßeinteilung mit, wir dachten „Oh-Gott-oh-Gott!“ und machten uns dann wieder vier Wochen Gedanken über diesen Satz … (lacht) Das waren so kleine Erschütterungen, die allmählich zur Reife führten, das summierte sich. All diese Witze, die ich damals erfahren habe, diese Lebenswitze, die hab ich später meinen Studenten auch wieder erzählt. Da gab es das gleiche Gelächter und die gleichen Denkauslösungen, die es damals bei mir selbst gegeben hatte. Und dazu zählte natürlich auch alles, was einen politisch tangierte und einem wichtig war. Zum Beispiel kriegte ich 1950 meine ersten Lederschuhe auf Bezugsschein von der FDJ, das waren solche Bundschuhe, die denen aus dem Bauernkrieg nachempfunden waren. Damit fuhr man dann zum Deutschlandtreffen nach Berlin, und das war schon mal ’n großes Glückserlebnis – bis dahin kannte ich nur Holz-Klappern.
„Die Klassifizierung ‚Arbeiter/Bauern’ war ziemlich zweifelhaft.“
Sie meinen, diese Schuhe waren bewusst so gestaltet wie die historischen Schuhe aus dem 16. Jahrhundert, um sich in diese Tradition zu stellen?
Ja, das war so ein Halbschuh, der oben rundherum noch mal ’ne Lederschlaufe durch die Öffnung hatte und vorne gebunden wurde. Und der hieß „Bundschuh“, genau wie im Bauernkrieg. Das hatte ’n Touch von Vermächtnis. Dagegen gab ’s auch nichts einzuwenden, das waren ja ’n Paar schöne Lederschuhe.
Haben Sie sich in der FDJ engagiert? Sie haben gesagt, Sie haben da den Schaukasten betreut …
Ja, sicher. Vor allem fand man hier rasch Freunde auch aus anderen Stadtteilen, zum Beispiel aus dem Nordviertel in Weimar, wo das Proletariat wohnte. Ich kannte ja hauptsächlich Kinder aus bürgerlichen Familien, weil ich mit meinen Eltern in einem recht bürgerlichen Viertel lebte.
Wie kamen Sie dann eigentlich nach Jena auf die Arbeiter- und Bauern-Fakultät? Sie waren ja weder Arbeiter noch Bauer …
Richtig, das war die Hürde, die noch zu nehmen war. Das gelang durch die Fürsprache meines Berufsschullehrers, der gesagt hat: „Der ist talentiert, der muss studieren!“ Überhaupt war diese Klassifizierung „Arbeiter und Bauern“ ziemlich zweifelhaft. Wo gehört denn da der Schauspieler hin? Cremer sagte immer, aber das war Jahre später: „Es gibt keine Künstler, es gibt nur Arbeiter in Sachen Kunst.“ (lacht) Also, man hatte da irgendwie ’ne Terminologie vergessen. Als ich den Fragebogen für die ABF ausfüllte und an die Stelle kam, wo es hieß „Beruf des Vaters“, dachte ich mir: „Mensch, da haste bestimmt keine Chance, wenn du ‚Schauspieler’ hinschreibst.“ Aber es hat ja dann doch geklappt. […]
(Wir unterbrechen das Gespräch im Wohnzimmer und ziehen um ins Maler-Atelier)
„Das Bürgerliche, war als verfault und absterbend deklassiert.“
Ich sehe, Sie haben da einen Plattenspieler stehen …
Mit diesem Geschenk hat mich neulich meine Tochter überrascht, weil ich noch so viele Platten habe. Drüben stehen sie immer im Schrank, und hier, wo ich arbeite, ist die Musik eigentlich besser aufgehoben. […]
Gibt’s ’ne bestimmte Musik, die Sie zur Arbeit besonders gern hören? Oder wechselt das?
Ich bin in der Beziehung nicht festgelegt, überhaupt nicht. Ich hab natürlich während der Arbeit sehr gern Bach und Händel und die Frühklassiker. Dagegen würde ich beim Arbeiten nicht Beethoven auflegen, eher Haydn oder Mozart. Solche Differenzierungen mache ich. […] Busch-Platten sind auch dabei, die höre ich hin und wieder.
Wissen Sie noch, was Sie um 1953, als Sie nach Berlin gegangen sind, für musikalische Vorlieben hatten? Gab es da bestimmte Helden?
Natürlich blickte man schon damals auf, wenn es um Prominente ging. Ich bin heute noch dankbar für den Auftrag, den ich eines Tages bekam: „Du gehst jetzt mal in die Villa vom Abendroth, da sind bei zwei Flügeltüren die Felder rauszunehmen und neu zu verbleien!“ Ich dachte: „Wie bittet? Hermann Abendroth, das ist doch der Chefdirigent des Weimarer Symphonieorchesters!“ Seit ’48 gingen wir in die Weimarhalle zu den Konzerten, nicht wahr. Wir hatten ’ne Untermieterin aus Posen gehabt, die ’ne leidenschaftliche Konzertgängerin war, und die hatte mich immer mitgenommen. Und jetzt konnte ich dem Mann vis-à-vis stehen in seiner eigenen Wohnung. So was ist alles prägend. […]
(Exkurs über das kulturelle Leben in Weimar nach 1945; Bemerkungen zur dortigen „Faust“-Inszenierung und zu Schauspielern wie Walter Jupé, Christa Gottschalk und Willy A. Kleinau, die Ronald Paris z.T. später beim Künstlerfasching in Berlin wieder begegnet sind)
Ihr Studium im Berlin der 50er Jahre war, das haben Sie vorhin angedeutet, nicht nur durch politische Diskussionen, sondern auch durch Studentenspäße geprägt, wir haben über Faschingsfeiern an den Berliner Kunstschulen gesprochen …
… die einen legendären Ruf genossen, der Fasching bei uns in Weißensee genauso wie der in der Kunstschule in West-Berlin, der „Zinnober“ hieß. Es gab ja noch keine Mauer, da sind wir natürlich hin. Künstlerfasching ist immer ’ne unglaubliche Tollerei. Dazu kommt diese Magie der stummen Masken, die viel Suggestivkraft hat. Überhaupt orientierte man sich in allen Dingen immer an dem, was verboten war, denn das machte die Sache gerade scharf. Ich erwähne das nur als Umschreibung des Unüblichen, denn solche Festivitäten fielen aus dem Rahmen dessen, was den Osten ausmachte. Vieles war ja proletarisiert worden. Das hatte zum Teil seine Berechtigung, aber zum andern war’s halt doch eine erhebliche Einschränkung. Das Bürgerliche war nun immer als verfault und absterbend deklassiert. Wir entdeckten aber als junge Leute, dass uns da was entgeht. Das war übrigens der Hauptwiderspruch auch zu dem, was man in GeWi lernte, nicht wahr. Denn Lenin hat gesagt: Wenn man den Staat zerstört, darf man nicht gleichzeitig seinen Überbau, seine kulturellen Werte, zerstören. Das war eine grundsätzliche Überlegung, dass die eine Kultur immer auf der andern aufbaut und sie nicht negiert. Das wurde leider in der Denkweise und der Propaganda nicht beherzigt. Eine Folge war zum Beispiel die Sprengung des Berliner Stadtschlosses, an der witzigerweise nicht Ulbricht Schuld hatte, sondern der Professor Strauss von der Humboldt-Universität. Der wurde nämlich vom ZK gebeten, ein Gutachten zu erstellen. Und der verhielt sich devot gegenüber der Regierung und dachte sich: „Wenn ich jetzt nicht schreibe, das Schloss ist ein Symbol des preußischen Militarismus und der Monarchie und überhaupt, dann verliere ich vielleicht meine Professur.“ Das ist aber nur ’ne Mutmaßung gewesen. Der hätte ruhig sagen können, er war ja ’n angesehener Mann, das Schloss ist von kulturellem Wert, dann hätte Ulbricht vielleicht anders darüber gedacht. Das ist die Verrücktheit, die diese Zeit auch noch hatte! Es hätte die Möglichkeit gegeben, das Bauwerk zu retten. Es hätte Aussage gegen Aussage gestanden.
Haben Sie das damals reflektiert?
Ja, sicher wurde das reflektiert und diskutiert. Aber da war es schon zu spät. Genau wie bei der Sprengung der Universitätskirche in Leipzig, die Platz machen musste für den Neubau der Uni. […]
Teil der Aufbaugeneration: „Es war ein Gefühl des Aufbruchs!“
Wie weit haben Sie sich identifiziert mit dem neuen Staat? Sind Sie in die SED eingetreten?
Ja, das war noch in Jena. Das muss kurz vor dieser prekären politischen Situation gewesen sein … Wie war das gleich wieder? Im Westen stand die Militarisierung an, und von uns wurde erwartet, darauf entsprechend zu reagieren. Also meldete sich die ABF geschlossen zur Kasernierten Volkspolizei, bis auf ’n paar Ausnahmen meldeten wir uns alle freiwillig. Aber dann kam Fred Oelsner, der Mitglied des ZK war, und sagte: „Nein, ihr seid die Zukunft der Nation, ihr habt zu studieren, daran ändert sich nichts!“ So ging also der Wehrdienst und all das an mir vorüber. Dafür bin ich sehr dankbar, denn sonst wäre ich irgendwann zur NVA gezogen worden. Und ich war absolut ungeeignet für derartige Disziplin. (lacht)
Haben Sie das auch gemacht, in die SED einzutreten, um ihren Traum, Maler zu werden, besser verwirklichen zu können?
Nee, das kann ich nicht sagen. Es ging einfach darum, dass man gebraucht wurde, und das Gefühl hatte, mitwirken zu können – für ein anderes Deutschland. Das ist die grundsätzliche Überlegung gewesen. Und dieses parteipolitische Detail, das ist nur ’ne Formsache gewesen. Das traf schon ein relativ gefestigtes Bewusstsein, wahrscheinlich hätte ich das sonst auch gar nicht gemacht. Denn später offenbarten sich mir natürlich all die Widersprüche – auch durch meine 15jährige Freundschaft mit Robert Havemann und Wolf Biermann. Das hatte dann zur Folge, dass man vieles überdachte und zwar sehr schmerzlich überdachte, aber es hat bei mir nicht zum Austritt geführt.
Sie sind bis zur Wiedervereinigung und auch darüber hinaus dabei geblieben?
Ich bleibe weiter ein Linker, ja. […] Solange mich diese Demokratie, in der ich jetzt lebe, nicht davon überzeugt, dass eine andere Politik gemacht werden kann, weil sie gemacht werden muss, kann ich nicht anders, als so zu denken.
„Es gibt Leute, die sind 28 Jahre alt und haben 30 davon gelitten.“
Haben Sie sich damals auch als Teil der viel zitierten Aufbaugeneration empfunden? Gab es dieses Gefühl von Zugehörigkeit?
Ja, man kam von Null zu etwas. Es war ein Gefühl des Aufbruchs, und das betraf nicht nur mich als Einzelnen, sondern das war bei vielen der Fall. Wie weit das nachher ein tangierendes oder nur passives Mitlaufen war, das differenzierte sich erst später. Man kann aber heute nicht sagen, dass die DDR-Bürger nicht ihren Staat bewusst mitgebaut und geformt hätten. Das wäre einfach historisch falsch.
Sondern?
Es geht einfach darum, dass man ihnen das nicht streitig macht: beteiligt gewesen zu sein. Es gibt ja auch solche, die es sich selbst absprechen, die sagen: „Wir hatten mit diesem Staat von Anfang an nichts zu tun!“ Es gibt so Leute, die sind 28 Jahre alt und haben 30 Jahre davon gelitten. […] Es gab für uns gar keine andere Möglichkeit, als mitzumachen beim Aufbau, das war doch selbstverständlich! Und die Mauer kam erst viel später, das muss man auch bedenken. Erst als die Probleme größer wurden und die Erpressung zunahm nach dem Motto „Im Westen ist alles besser“ wurde langsam klar, dass es vier Hauptwidersprüche im Sozialismus gab: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. (Lachen) Kennen Sie das nicht? Immer, wenn etwas nicht klappte, nicht wahr, wurde ein Schuldiger gesucht. Und weil das so vielschichtig war, haben sich die Witzbolde auf die Jahreszeiten geeinigt. […] Eines möchte ich auch sagen: Für die Festigung der eigenen Überzeugung haben schon auch bestimmte Personen, man könnte auch sagen: Leitfiguren, eine Rolle gespielt. Die trugen dazu bei, dass man nicht schwankte, wie es immer so schön hieß: „Du schwankst so! Du liegst politisch schief!“, und was es da für originelle Termini gab. Mag sein, dass man manchmal zu viel Respekt vor den Biografien dieser Leute hatte. Aber diese Personen haben mit ihrer politischen Bildung einen enormen Einfluss auf einen ausgeübt. Es wurde ja alles diskutiert, es gab keine Tabus, und das kollidierte mitunter mit der Tagespolitik, ist ja ganz klar. Wir haben das immer als einen dialektischen Prozess angesehen, bis heute. Umschlagung von einer Qualität in eine neue, das war immer unsere Hoffnung.
„Diese Lieder waren der Kitt, mit dem sich Widersprüche im Sozialismus zukleistern ließen.“
Busch war ja auch eine dieser Personen, an denen man sich orientieren konnte. Haben Sie und Ihre Altersgenossen seine Lieder tatsächlich oft gesungen?
Ja, sicher. Es war ja so, dass immer dann, wenn Beschlüsse gefasst wurden, wenn Versammlungen und Parteitage waren und neue Richtlinien besprochen wurden – ähnlich wie das heute bei der WASG und der PDS ist, wenn die sich über Grundsätzlichkeiten nicht einigen können – dass immer dann die Kardinalwidersprüche zwischen den alten Kämpfern und verdienten Genossen und den neuen Funktionären, den jungen Ökonomisten, aufbrachen. Das ging ja im Grunde bis zur Spaltung. Deutlich zu sehen nach dem Sturz von Chruschtschow, als die ursprünglichen revolutionären Ideen weit gehend zu Gunsten einer zweiten NÖP (Neuen Ökonomischen Politik) aufgegeben wurden, weil man ja immer im Wettstreit stand mit den kapitalistischen Ländern vor allem auch in Bezug auf die Militarisierung bis hin zur Hochrüstung. Und genau da kommt Busch mit seinen Liedern ins Spiel. Diese Lieder waren der Kitt, mit dem sich all die Widersprüche im Sozialismus zukleistern ließen. Die Widersprüche zwischen jung und alt, zwischen revolutionär und ökonomistisch und so weiter. Auf die Busch-Lieder konnten sich immer alle einigen. […] Gleichzeitig gab es aber Widersprüche auch bei Busch selbst. Er lag ja im Clinch mit Ulbricht, was letztlich zur Folge hatte, dass er ’53 seinen Verlag los wurde. En detail weiß ich da nicht so gut Bescheid, aber ich weiß, dass er durch seine revolutionäre Haltung mit vielen in der Partei nicht einverstanden war und davon natürlich auch Kenntnis gab. Das führte zu unglaublichen Diskussionen und Querelen, und das ging diagonal durch die 50er und 60er Jahre.
Sie sagen „er gab Kenntnis davon“, das würde ja heißen, dass Sie davon was mitbekommen haben. Bekam man wirklich etwas mit davon?
Natürlich kriegte man das mit. Zum Beispiel erzählte man sich im Theater, als Busch seinen 60. oder 65. Geburtstag hatte: „Stellt euch mal vor, was sich der Busch wieder geleistet hat. Der Ulbricht kam mit ’nem großen Blumenkorb und wollte gratulieren, da hat ihm der Busch die Haustür vor der Nase zugemacht.“ Das fand man schon aufregend und kühn. Aber, wie gesagt, dem Mann mit seiner Biografie konnte man nichts anhaben.
Hatte er was Rebellisches?
Ja, er war ’n sehr Energischer. Und es gab ja so einige Gerüchte über seine Kontroversen, die er übrigens auch mit Brecht hatte. […]
„Ich bin kein Autogrammjäger mit Prominententick.“
Sie haben neben Busch noch andere linke Intellektuelle und Künstler porträtiert, zum Beispiel Hanns Eisler oder Heiner Müller. Und man hat den Eindruck, dass das Personen sind, die Ihnen viel bedeuten. Kam es Ihnen auch darauf an, dass die Zuneigung zu diesen Künstlern, diese Wertschätzung, im Bild zu spüren ist?
Ich hoffe, dass diese Wertschätzung zu spüren ist. Ich kannte diese Personen gut.
Hat das auch was mit Verehrung zu tun?
Mit Respekt. Die Kategorie der Verehrung ist mir suspekt. Man war schon glücklich, Zeitgenosse gewesen zu sein. Aber ich bin kein Autogrammjäger mit Prominententick. So weit geht es dann doch nicht, das wäre unsinnig. […]
Sie haben vorhin über Busch gesagt, dass er, indem er Rollen gespielt hat, auch an seiner eigenen Berühmtheit gebastelt hat. Das gilt ja in gewissem Sinn auch für bildende Künstler. Sie selbst sind durch Ihre Bilder auch zu einem prominenten Maler geworden …
Das sagen Sie.
Ist das falsch?
Wenn ich so was höre, fällt mir der Ausspruch von Otto Dix ein: „Ich lebte gefährlich. Ich wollte berühmt werden oder berüchtigt. Am Ende hatte ich Glück, ich wurde beides!“ Das fand ich wunderbar … (lacht)
Wollten Sie auch berühmt werden?
Ach, darüber hab ich mir nie Gedanken gemacht. Ich habe nur registriert, dass man ’ne gute oder ’ne schlechte Kritik hatte. Dann hat man sich weiter bemüht. Außerdem war unsere Erziehung durch unsere Vorbilder und Künstlerlehrer dahingehend geprägt, dass die immer sagten, ein guter Künstler tritt hinter sein Werk zurück. Heute ist es ja umgekehrt. Heute kann jeder über alles Mögliche reden, über seine Absichten und seine Profilneurosen – und wenn Sie die Resultate dann sehen, handelt es sich häufig um heiße Luft. So etwas war mir und vielen Malerfeunden und –kollegen verdächtig, uns kam es auf das Substanzielle an. Ich war Mitbegründer und Jahre lang Vorsitzender der Intergrafik, da hatten wir einen Leitspruch von Käthe Kollwitz: „Ich will wirken in dieser Zeit, oder ich möchte, dass meine Kunst Zwecke hat.“ Das ist doch ’n Credo!
Sozialistischer Realismus: „Na gut, es ist nur eine Methode!“
Ja, das ist ’n Credo. War Käthe Kollwitz auch ’ne Leitfigur in der Kunst der DDR?
Sicher. Vor allen Dingen als Beispiel dafür, dass das Proletarische aus der Gosse zu holen und in den hehren Kunsttempel aufzunehmen sei. Was später für mich dazu führte, diese Geschichte von Apollo und dem Satyr Marsyas, wie sie Franz Fühmann geschildert hat, so zu interpretieren, dass es sich hier auch um den Streit zwischen apollinischer Kunst und Volkskunst handelt. Die Volkskunst dringt in Bereiche ein, nicht wahr, die ihr bislang verwehrt gewesen sind. Als Käthe Kollwitz von der Preußischen Akademie als erstes weibliches Akademiemitglied zugelassen wurde, war das in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Denn diese Institution war ja weit gehend bürgerlich und vom männlichen Vorurteil geprägt.
Als die Kunst in der DDR anfing reglementiert zu werden, bildeten sich verschiedene Schulen. Wie würden Sie sich da im Nachhinein positionieren? Der Sozialistische Realismus, wie er vielleicht verkörpert wurde durch …
Nein, nein, da kommen Sie in Teufels Küche, wenn Sie jetzt weitermachen. Im Grunde genommen war das eine Fiktion. Dieser Terminus „Sozialistischer Realismus“ bezeichnete eine Doktrin innerhalb der Sowjetunion durch Stalin und wie die Apologeten damals alle hießen. Das Modell wurde kritiklos als vorbildhaft hingestellt. Dazu hat sich aber die Künstler- und Kollegenschaft kritisch verhalten. Sodass zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt wurde: „Na gut, es ist nur eine Methode!“ So, nun hinkte das ganze Ding aber, weil es den bereits erwähnten Satz von Lenin außer Acht ließ, dass man auf eine bestehende Kulturstufe aufbauen soll. Es konnte nicht funktionieren, solange man alles, was angeblich nicht nützlich war für die sozialistische Gesellschaft, als verfault und bürgerlich diffamierte. Mit diesem Generalwiderspruch haben wir leben müssen und leben wir bis heute. Denn alles, was sich dann herausbildete an Schulstrukturen und Auffassungen, waren immer Folgeerscheinungen dieser unsäglichen Diskussion. […] Und die Regierungspolitik verhielt sich dazu lediglich reformierend, Honecker redete zwischendurch von „Weite und Vielfalt“ und so weiter, aber von dem Begriff selbst hat man eigentlich offiziell nie Abschied genommen, weil man geglaubt hat, er gehöre zur sozialistischen Gesellschaft. Ich meine, es ist ja auch kein Schimpfwort. Es geht ja nur um die Indoktrination und den Dogmatismus dabei, der das künstlerische Schaffen blockiert und nicht inspiriert.
Wenn von Kunst die Rede ist, geht es immer auch um die Frage von Aufträgen, von Mäzenatentum, um die Frage der Finanzierung. Zum Beispiel können Staatsaufträge …
Das ist ein Grundproblem, vor dem wir heute stehen. Ob man sich kommerziell versteht als Hersteller von Kunstware, oder ob man die Freiheit der Kunst so weit in Anspruch nimmt, dass man sagt: Kunst und Kommerz schließen sich aus.
Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt. Schon immer spielten Gönner oder Auftraggeber eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Kunst …
Das ist schon richtig. Aber wir hatten zu DDR-Zeiten eine andere Zielgruppe, um mal diesen albernen Begriff zu gebrauchen. Man sagte damals: Wir sind Teil der Gesellschaft und arbeiten für die Gesellschaft in ihrer ganzen Differenziertheit. Wir wollten, zumindest ursprünglich, all diese Probleme in irgendeiner Weise nach Didaktik und Gefühl sichtbar werden lassen – nicht zuletzt als ein Mittel zum Zweck, aber ohne jegliche Beschränkung, ohne Beeinträchtigung der schöpferischen Freiheit. In dem Moment, wo dann der Markt bestimmt, was von Interesse ist, kommt es logischerweise zur Kollision. […]
„Der hat unsern revolutionären Ernst vom Sockel gestoßen!“
Lassen Sie uns über Ihre Busch-Gemälde sprechen, die Ihnen ja viel Ärger eingebracht haben. Erinnern Sie sich noch an die erste Begegnung mit Ihrem Modell?
Die ging schon viel versprechend los. Busch tönte gleich: „Also, ich hab nur ’ne halbe Stunde Zeit! Irene, Du sagst dann Bescheid und bringst mir meine Suppe!“ Er hatte irgendwas am Magen und musste immer so ’n Mehlsüppchen essen. Es dauerte, ehe ich den zur Ruhe gebracht hatte. Der gestikulierte und schimpfte und brüllte und machte und erzählte mir alle möglichen Dinge, die gar nicht zu dieser Stunde gehörten. Währenddessen liefen seine Platten laut im Raum. Ich sage: „Herr Busch, tun Sie mir bitte den Gefallen und bleiben Sie einen Moment sitzen!“ – „Wer hat Ihnen denn gesagt, dass Sie mich von dieser Seite malen sollen?“ Ich sage: „Mir hat gar keiner was gesagt, ich weiß, dass Sie eine Verletzung hatten …“ – „Woher wissen Sie das?“ So ungefähr verliefen unsere Gespräche, und so kam eins zum andern … Später erfuhr ich dann durch den Prozess, der angestrengt wurde, dass Busch geäußert haben soll, in seinen Differenzen mit Ulbricht wäre ich das Pünktchen auf dem i gewesen. Er glaubte tatsächlich, dass ich von der Ulbricht-Clique beauftragt worden wäre, ihn so darzustellen. (lacht) Verrückt, oder?
Er hat Ihnen nicht getraut?
Anfangs schon, glaube ich. Das kam alles erst, als ich mir erlaubt habe, das zweite Porträt 1972 zur Dresdner Kunstausstellung zu schicken. Da kam es dann zu diesen deutlichen Kritiken: „Der hat unsern revolutionären Ernst vom Sockel gestoßen!“ oder „Wir kennen ihn anders!“ – es wurden sogar Brigaden bemüht, die entsprechende Äußerungen machen sollten. Und von Joachim Uhlitzsch, dem Direktor der Galerie Neue Meister, gibt es Briefe an Busch, wo drinsteht, er würde dafür sorgen, dass dieser Mann, also ich, nie wieder eine sozialistische Persönlichkeit porträtieren darf. Ich wusste von dieser ganzen Aufregung erst gar nichts. Der Uhlitzsch war zu mir immer scheißfreundlich.
Hatten Sie das mit Busch abgesprochen, dass Sie das Bild in Dresden zeigen wollten?
Nee, dazu hatte ich auch gar keine Veranlassung.
Wie erklären Sie sich die heftigen Reaktionen insgesamt? Immerhin war Ihr Bild offiziell ausgewählt worden für diese repräsentative Kunstausstellung …
Ja, klar. Aber Sie müssen das verstehen: Das hat vielen genutzt, nicht wahr, Partei zu ergreifen für eine Imagination, die da im Raum schwebte. Man unterstellte mir, den Busch durch das Bild zu diffamieren. Und dann sollte es auf einmal zur Halbzeit der Ausstellung abgehängt werden. Dann hat Hans-Joachim Hoffmann, der Minister für Kultur war, gesagt: „Moment mal, wir können nicht einen Jurybeschluss rückgängig machen. Es gibt einen künstlerischen Befund, der besagt, dass dieses Bild in die Ausstellung gehört, das bleibt hängen.“ Dann ging der ganze Rummel noch mal los. Ich war gerade an der Ostsee und kriegte die Nachricht, ich sollte mich zu einem Gespräch im Rechtsanwaltsbüro Gentz, das war der Anwalt von Brecht und Busch, einfinden. Vorher wurde mir noch gesagt, ich habe die Zeichnungen alle abholbereit zu hinterlegen. Die würden im Zentralvorstand des Verbandes Bildender Künstler noch mal geprüft. Die kriegte ich dann nach einiger Zeit alle kommentarlos wieder. Während ich an der Ostsee war, gab es eine Verfügung des Rechtsanwalts, die besagte, ich hätte alles unter Verschluss zu halten und dürfe die Bilder niemandem und nirgends zeigen. Keine Arbeit über Busch dürfe mehr an die Öffentlichkeit kommen. Das war offenbar das Ergebnis, auf das Busch hinaus wollte. Und seitdem war es aus. Seitdem kriegte ich keinen Handschlag mehr. Wir bekamen 1977 beide den Kunstpreis des FDGB in Rostock und standen da alle aufgereiht und beglückwünschten uns. Busch ging an mir vorbei, ich reichte ihm die Hand, und er negierte das. Das war meine letzte Begegnung mit Busch.
Waren Sie gekränkt?
Nö, gekränkt nicht, ich war nur berührt von dieser Blödsinnigkeit – aber wissend um die Tatsache, dass Busch kein Verhältnis zur bildenden Kunst hatte.
„Busch hat nicht einen einzigen Blick auf die Zeichnungen gerichtet.“
Hatte er nicht?
Nee, den Eindruck hatte ich nicht. Er war eitel mit sich und seiner Wirkung, sehr narzisstisch. Aber in keiner Weise hat er irgendwelche Fragen zur bildenden Kunst verlauten lassen.
Wieviele Sitzungen hatten Sie?
Drei oder vier.
War das ergiebig für Sie?
Ich hatte jeweils ’ne knappe Stunde Zeit und musste sehr gerafft arbeiten, dann flog man raus.
Wie haben Sie gearbeitet? Mit Bleistift?
Ja, ich hab die Zeichnungen hier, die zeige ich Ihnen gleich. Busch hat nicht einen einzigen Blick darauf gerichtet.
Hat ihn nicht interessiert?
Hat ihn überhaupt nicht interessiert! Und die ganze Zeit hat er mich bombardiert mit seinen Liedern. „Na, wie finden Sie das?“ Ich sage: „Herr Busch, großartig!“ Er war darüber mehr zufrieden, wenn man sich freute über das, was er machte, als dass er reflektierte, dass ich ihn zeichnete, also etwas über ihn machte.
Hat ihm die ganze Aktion nicht auch ein wenig geschmeichelt?
Ich glaube, das war ihm eigentlich wurscht. Es war ihm unbequem. Er mochte nicht, dass man ihn mit dem Blick seziert. Und das ist ja das, was beim Zeichnen wichtig ist, nicht wahr. Man möchte ja nicht etwas abbilden, sondern man möchte die Psychologie auch ’n bisschen begreifen, die Tiefe des Menschen, seine Wesenheit.
Und Sie haben nie ’nen Kommentar von Busch selbst zu einem der Bilder bekommen?
Nein. […] Achso, dazwischen kam noch ein Artikel von Lothar Lang in der Weltbühne. Darin erwähnte er das Ölbild, das in Dresden zu sehen war, und bezeichnete es als „großen Wurf“ -innerhalb meines Oeuvres wohlgemerkt. Daraufhin ist Bruno Apitz, der wohl mit Busch befreundet war, zu ihm rübergelaufen und hat gesagt: „Ernst, haste das gelesen? Deine Deformation da von diesem Paris soll ’n großer Wurf sein!“ Und Busch ist mit dem Artikel losgerannt zu Fritz Cremer, der ein paar Häuser weiter wohnte: „Fritz, lies das mal! Weißte, was ’n großer Wurf ist? Hier, der Balken, den ich ’43 auf die Fresse bekommen habe!“ Also, es herrschte große Aufregung. Und ich glaube, das war letztlich auch der Auslöser für diese ganze Geschichte, die dann zu diesem Prozess führte. Ich bringe jetzt wahrscheinlich die Reihenfolge nicht ganz richtig zum Ausdruck, aber Günter Meier hat das ja recherchiert.
Günter Meier schreibt, es sei Ihnen „eine persönliche Ehrenpflicht“ gewesen, den Busch zu porträtieren. Ist das richtig?
Das is ’n bisschen stilisiert und gedrechselt ausgedrückt, aber der Kern ist richtig.
Also, Sie konnten mit Busch und seinem Werk etwas anfangen …
Ja, sicher. Nach wie vor!
Sie scheinen Busch, seine cholerisch-humorlose Reaktion auch nicht übel zu nehmen …
Nee, derartige Dinge gibt es in der bildenden Kunst häufig. Fehlbarkeit ist ja ’n menschlicher Zug … (lacht) Und das ist wie gesagt nicht das erste Mal, dass solche Querelen entstanden sind, nicht wahr. Kunst ist nicht immer bequem.
Glauben Sie, dass sich die Wahrnehmung Ihrer Person und Ihrer Kunst durch die ganze Sache verändert hat? Haben Sie durch dieses umstrittene Bild einen bestimmten Ruf erlangt?
Ja, bestimmt. Die Reaktionen der Leute, die das Bild kannten, waren gespalten. Ein Teil war strikt dagegen, ein anderer Teil sagte: „Jawoll, das ist unser Busch!“ Auch die damalige Presse war gespalten, wobei natürlich mehr negative Kritiken veröffentlicht wurden.
Waren Sie auch ’n bisschen stolz auf die Reaktionen? Ich meine, es ist ja ’n gutes Zeichen, wenn Kunst kontrovers diskutiert wird …
Mit diesem Tatbestand lebt man und arbeitet man. Es wäre langweilig, wenn alles nur Larifari wäre und flott konsumiert werden würde. Dass man provoziert mit so einer Sache, ist klar. Und zwar das differenzierteste Feingefühl im Menschen. Sonst wäre niemand davon betroffen, und dann würde Kunst ihre Bedeutung verlieren. […]
(längerer Exkurs zu Wolf Biermann, zu dessen „Drahtharfe“ er in den 60er Jahren die Frontispizzeichnung beigesteuert hat; Ronald Paris legt Wert darauf, dem von Biermann geäußerten Verdacht mangelnder Solidarisierung im Fall der Ausbürgerung entgegen zu treten; Paris berichtet von einem Brief, den er nach Bekanntwerden der Ausbürgerung an Kurt Hager geschrieben hat, worin er das Vorgehen der Regierung missbilligt habe)
„Widersprüchlicher und komplizierter und selbstverliebter Mensch“
Wie muss man sich das vorstellen, als Sie 1971 bei Ernst Busch vor der Tür standen, um die ersten Skizzen von ihm anzufertigen? Hatten Sie damals schon eine konkrete Idee, wie Sie ihn malen wollten?
Nein, das hätte mich eher belastet. Wobei genau das später kritisch wirksam wurde, als es hieß: „Der hat unsern Busch vom Sockel gestoßen!“ Aber ich wollte nicht „unsern Busch“ malen, ich wollte den Busch malen. Denn jeder hatte ja „seinen Busch“.
Was war für Sie, nachdem Sie Busch persönlich kennengelernt hatten, das Entscheidende, das Sie herausarbeiten wollten?
Dass da ’n komplizierter Mensch sitzt, ’n widersprüchlicher und komplizierter und auch ein selbstverliebter Mensch.
Es muss schwer gewesen sein oder sogar unmöglich, das alles, was über Busch bekannt war, auszublenden und sich völlig neu auf ihn einzustellen …
Das war auch nicht unbedingt das Ziel, wobei das ganz automatisch passierte. Denn meine Erfahrungen mit Busch davor waren ja viel mehr konservenhaft als unmittelbar, sie waren didaktischer, intellektueller.
Dass da jemand sitzt, der im Spanischen Bürgerkrieg gewesen war und bei den Nationalsozialisten im Gefängnis, das ist …
… das ist natürlich ’n wesentliches Kriterium seiner Kunst. Es bedeutet Risikobereitschaft, und die kommt auch in seinem Werk zum Ausdruck.
Hat man das Biografische und diese Risikobereitschaft bei Busch immer mitgedacht?
Davor hatte man grundsätzlich Respekt. Ich jedenfalls.
„Man kann Bilder unglaublich zweckbedingt deuten.“
Wenn wir uns jetzt mal die zwei Ölbilder anschauen, dann sind das sozusagen zwei verschiedene …
… zwei verschiedene Sichten, ja. Das erste Bild basiert auf der Erfahrung, dass er zunächst reserviert war und nach hinten gelehnt ist. Während er in der zweiten Fassung agiert, die Faust erhebt; im Hintergrund sitzt ein Zuhörender, und ich sitze außen vor und vertrete den Betrachter.
Wer ist denn der Zuhörende?
Die Figur im Hintergrund.
Sein Kind?
Nö, das ist einfach eine Figur …
… die aber nicht real im Raum dabei war?
Ab und an war Irene dabei.
Ist Irene die Figur?
Nein, nageln Sie mich doch nicht fest! Ich habe keine Absicht gehabt, da noch ein Porträt hinzuzufügen. Das ist ein gegenwärtiger Zuhörer, ein Beobachter der Szene: Maler und Modell.
Sitzt Busch in einem Schaukelstuhl?
Nein, das ist ein roter Sessel gewesen. Es gab bei ihm nur diese feuerroten Sessel, da drin sitzt er auch beim ersten Porträt.
Im ersten Porträt hat er die Hände vor dem Bauch gefaltet. Ist Ihnen diese Darstellung auch übel angekreidet worden?
Für das erste Bild gab es keine Kritik in dieser Hinsicht. Es ging immer um das zweite Bild. Es wurde zu einem Politikum durch diese erhobene Faust und weil man mir unterstellte, er wäre besoffen, nicht wahr. Es wurde bei diesen Sitzungen immer so ’n Wagen reingeschoben, wo Schnaps und Wein draufstand und Tassen und Gläser. Ich hätte also einen Drink nehmen können. Aber das war für einige Leute ein klares Indiz, Bruno Apitz hat wohl zu Busch gesagt: „Na klar, du bist besoffen, du hast ja sogar noch die Flaschen neben dir stehen!“ – Man kann Bilder unglaublich zweckbedingt deuten.
Dabei war Busch gar kein Alkoholiker.
Nein, war er nicht. Er war im Alter gesundheitlich angeschlagen, aber das hatte nichts mit Alkohol zu tun. […] Die Flaschen und Gläser waren für Besucher gedacht. Ich bin ja nicht der einzige Besucher gewesen. Da kamen öfter alte Freunde vorbei, sogar bis aus Moskau und was-weiß-ich-woher.
„Ich nehme an, dass Busch das ZK wegen des Bildes erpresst hat.“
Grigori Schneerson kam ab und an aus Moskau.
Der hat das Bild auch gesehen – wo, weiß ich nicht – und hat sich auch nicht gerade positiv geäußert. Jedenfalls dauerte es nicht lange, da war das Bild verschwunden. Ich habe Jahre lang, nachdem ich gehört hatte, das Bild sei durch das Büro Kurt Hager aus der Nationalgalerie abgeholt worden, immer wieder gefragt „Wo ist mein Busch-Bild?“ Und ich nehme an, dass Busch das ZK erpresst hat, und gesagt hat: Wenn ich das Bild nicht kriege, dann passiert das und das!“ Und das hat man beim ZK nicht riskieren wollen. Der einzige Hinweis den es bis heute gibt, ist eine Unterschrift von demjenigen, der beauftragt worden war, das Bild abzuholen. Diese Unterschrift belegt, dass sich mein Bild nicht mehr in der Nationalgalerie befindet. Ab da verliert sich jede Spur. Zu befürchten ist, dass es Buschs Sohn haben könnte, aber darüber gibt es keinerlei Auskünfte. Jedenfalls wurde ich dann in den 80er Jahren, als in Buschs ehemaligem Wohnhaus ein Museum eingerichtet wurde, von dem Leiter Erwin Burkert angerufen und gefragt: „Sag mal, kannst du uns nicht dein Busch-Bild zur Verfügung stellen?“ Der war völlig ahnungslos. Ich sagte: „Das hab ich nicht!“ Er darauf: „Ach, mach keinen Quatsch, du willst es bloß nicht rausrücken.“ – „Nein, ich hab es nicht! Ich hab ’s bei euch hinter der Heizung vermutet! Hast du es nirgendwo entdeckt?“ – Er darauf: „Im Haus is nüscht.“ Also, ich musste annehmen: Das Bild wurde vernichtet.
Vernichtet? Glauben Sie das wirklich?
Das ist durchaus denkbar, nachdem sich Busch so darüber erregt hatte. Er muss grün und blau geworden sein, als er sich so erblickte. […] Es ist ein rücksichtsloses Bild, das gebe ich zu, aber es hat dadurch nicht weniger Wahrhaftigkeit. Das Bild ist lebensgroß (Ronald Paris zeigt die Größe mit den Händen), leider habe ich nicht mal ein gutes Foto davon. Es gibt überhaupt nur eine einzige Farbaufnahme, ein Dia, das aber leider viel zu dunkel ist. […] Heute ärgere ich mich natürlich, dass ich damals kein ordentliches Foto gemacht habe. Das Bild ist ja zuerst auf der Dresdner Kunstausstellung gezeigt worden, da kam die Verfügung von Buschs Rechtsanwalt, auf die ich aber nicht groß Rücksicht genommen habe. Das Bild ist dann angekauft worden auf Anweisung des Kulturministers Hans Joachim Hoffmann und hing kurze Zeit in dessen Zimmer. Dort ist es von einigen Leuten gesehen worden, ich selbst war nie dort. Und dann wurde es der Nationalgalerie übereignet und war dort unter Verschluss, im Giftschrank, wie man damals zu sagen pflegte, im Tresor. Ich habe ein paar Mal zum Fritz Donner, dem Abteilungsleiter der Bildenden Kunst im Kulturministerium, gesagt: „Fritz, wo ist das Bild? Ich muss endlich mal ’ne ordentliche Farbaufnahme davon machen!“ – „Beruhige dich, das Bild ist ja da, nur keine Angst!“ Bei diesem stupiden Satz ist es immer geblieben, und ich war beruhigt. Dummerweise! Ich hatte ja keine Ahnung, was inzwischen passiert war, das kam alles erst nach der Wende zu Tage … […] Hier, das war eine Ausstellung in Schloss Kappenberg … […]
(Ronald Paris zeigt mir Lithographien von Busch; die Drucke basieren zum Teil auf Zeichnungen, die bei Busch zu Hause entstanden sind, zum Teil auf Fotovorlagen, die Busch am Deutschen Theater im „Sturm“ zeigen; Paris macht mir Buschs bevorzugte Körperhaltungen vor)
Er stand immer so da (stützt die Hände in die Seiten), die Jacke nach hinten, oder so (nimmt die Hände vor die Brust, als ob sich an Hosenträgern festhalte). Wie Lenin! Er imitierte gerne Lenin. Das war auch häufig seine Haltung auf der Bühne. Taucht immer wieder auf. Das war sein Markenzeichen. Er hat auch den Galileo so gespielt, als würde Lenin auf dem Allrussischen Kongress sprechen. Es waren sogar dieselben Gesten. Na ja, so findet jeder irgendwann seine bevorzugte Körpersprache …
„Die Begegnungen waren reserviert, fast distanziert.“
Ich möchte noch mal auf Ihre drei oder vier Sitzungen mit Busch zurückkommen. Sie haben ihn dabei ja sozusagen als privaten Menschen kennengelernt …
Ach Gott, ich bin gar nicht dazu gekommen, so etwas wie private Nähe zu spüren. Die Begegnungen waren reserviert, fast distanziert. Für mich war es immer eine große, große Anspannung, weil er einfach nicht zur Ruhe kam. Er war immer bewegt, immer unruhig. Das ist auch der Ausdruck dieser Haltung, die ich gemalt habe: Dieses ewige Deklamieren und Gestikulieren – das ist ja wahrscheinlich das, was Apitz als „besoffen“ denunziert hat. […]
Man hat ihnen vorgeworfen, Sie hätten ihn „vergreist, zynisch und alleingelassen“ dargestellt …
Das ist alles Interpretation.
Hatten Sie den Eindruck, dass es ihm gesundheitlich nicht gut ging?
Das kann ich so nicht sagen. Aber es ist ja bekannt, dass er oft krank gewesen ist. Das hatte wohl mit seiner Gesichtslähmung zu tun, jedenfalls hieß es im Theater oft: „Wegen Erkrankung Buschs entfällt die Vorstellung – Sie kriegen Ihr Geld wieder.“
Als Sie ihn kennenlernten, wirkte er aber offenbar ganz vital …
Ja, nervös, eitel und unruhig oder besser: beunruhigt – wahrscheinlich durch mein Unternehmen. Ich weiß noch, dass bei der ersten Begegnung auch der Sohn dabei war, den hab ich sogar gezeichnet, das müsste ich mal raussuchen … […]
Sie waren ja nicht der erste Künstler, der Busch dargestellt hat. Hatten Sie sich eigentlich vor Ihren Besuchen bei Busch andere künstlerische Darstellungen angesehen?
Ich kannte die Büste von Theo Balden. Busch hat die, glaube ich, bei sich auch stehen gehabt. Dann war sie in der Nationalgalerie, und Theo Balden hat die bei sich stehen gehabt, er hatte ja auch das Original in Gips.
Wie fanden Sie die?
Ja, wie fand ich die? (Pause) Weiß ich nicht mehr. Bisschen fremd vielleicht.
„Ich wollte die Sache ohne Pathos angehen.“
Sie wollten sich offenbar von den Darstellungen, die es schon gab, …
… nicht beeinflussen lassen. Das ist wahrscheinlich der Grund gewesen, warum ich dazu nie ’ne Meinung entwickelt habe. Ich hab das zur Kenntnis genommen – ohne eine Wertung. (Pause) Dahinter steckt ’ne andere psychologische Auffassung beider, nicht wahr. Von Busch und von Balden. Ich würde sagen, die hat etwas Stilisiertes hin zu einem Idol. Und das war nicht meine Absicht, ich wollte die Sache ohne Pathos angehen. Dass mir dies dann sozusagen als negatives Pathos ausgelegt wurde, dafür kann ich nüscht. Das war eben meine Auffassung von Nähe …
… die er doch, wie Sie vorhin gesagt haben, gar nicht zugelassen hat …
Das stimmt, aber auch wenn er keine Nähe zulassen wollte, ist im Bild doch ’ne gewisse Nähe entstanden. Im Rahmen der Verschlossenheit, die sich darbot, bin ich doch ziemlich nah rangekommen, das würde ich für mich in Anspruch nehmen.
War Ihnen von Anfang an klar, dass anhand der Zeichnungen ein Gemälde entstehen würde?
Nein.
Das heißt, Sie haben Busch auch nicht erzählt, dass ein Gemälde aus den Skizzen wird …
Nee, ich habe nie über ungelegte Eier gesprochen.
Sie haben das also erst später zu Hause entschieden …
Ja, ich hatte dann einfach das Bedürfnis, weiter zu machen. Es lag einfach in der Luft … Genau wie ich das große Glück hatte, noch Hanns Eisler zu zeichnen. Das Bild ist dann nach Eislers Tod entstanden – zur Freude von Steffi, die zwei große Zeichnungen bekam. Das erste Original ist in Leipzig, und das zweite hängt in der Musikhochschule „Hanns Eisler“. […] Steffi hatte nur eine kritische Bemerkung gehabt zu einem Porträt, da ist Eisler beim Dirigieren zu sehen mit ganz wachem Blick. […] Da meinte sie: „Rrroonald“, sie war ja Wienerin, „der Hanns hot gaanz klaane Patscherln ghabt, und du host so große Hände gmalt!“ Ich sage: „Steffi, der dirigiert, die sind weit vor ihm, die Hände.“ Und sie noch: „Der Hanns hot am Klavier käne Oktavn greifn können, die san über die Tastn ghüpft, die Händ.“ – Daraus hatte Eisler ja beim Klavierspielen eine Tugend gemacht: (singt) „Am Grunde der Moldau, da wandern die Steine …“ – da sprang die Hand immer hin und her. Er hat mir auch hin und wieder etwas vorgespielt, das war ein wunderbarer Mann. Ein völlig anderer Charakter als Busch, sehr heiter, sehr ironisch. Auch bissig, aber nie rechthaberisch wie Busch, der geradezu militant sein konnte.
„Das war einfach ’ne Person von Interesse – in jeder Beziehung.“
Eisler hat Busch „das singende Herz der Arbeiterklasse“ genannt. Das war bestimmt nicht ironisch gemeint …
Das stimmt, aber das ist eben eine Ergebenheitsadresse gewesen aus der Verehrung heraus gegenüber dieser doch großen, potenten Figur. Busch hatte großes Talent, er war auf der Bühne glänzend, er faszinierte. Und er war natürlich ein zupackender Interpret, was Autoren wie Eisler und Brecht sehr wichtig war, weil ihnen ja die Sicht auf die Klasse wichtig war, auf das Unterprivilegierte. Nun ist Busch natürlich ein sehr selbständiger Künstler gewesen, und Brecht, der ja das Nebeneinander unterschiedlicher Mentalitäten und Charaktere geradezu förderte, hat sich öfter wahnsinnig geärgert über den Eigensinn von Busch. Gerade bei der Galilei-Geschichte, da gab ’s viel Knatsch! Man munkelte damals, Busch sei nicht ganz unschuldig daran, dass Brecht ins Gras beißen musste. Ob das stimmt, weiß ich nicht, ich war damals nicht dabei. Ich habe das von Schauspielern und Assistenten gehört, die damals am BE waren, aber mittlerweile nicht mehr leben, wie Elsa Grube-Deister.
Die haben über Busch und seine Sturheit berichtet?
Ja, man sprach über sein schwieriges Verhalten, das war ja ein Gesichtspunkt, der wichtig war unter Künstlern. Und Busch war ja nicht irgendwer. Das war einfach ’ne Person von Interesse – in jeder Beziehung. […]
(Exkurs über die Akademie der Künste und das Gebäude am Pariser Platz, in dem die Ateliers der Meisterschüler, die Litho-Werkstatt sowie das Literatur- und das Musikarchiv untergebracht waren; Ronald Paris ist als Meisterschüler in den 60er Jahren dort ein- und ausgegangen; er berichtet von Hugo Fetting und dessen Lebensgefährtin Edith Krull, von Inge Lammel und seiner Begegnung mit einem Schäferhund der Grenztruppen, die glimpflich ausgegangen sei, obgleich diese Hunde „scharf wie Schifferscheiße“ gewesen seien; er erinnert sich auch an gelegentlich laut durch das Gebäude tönende Busch-Lieder)
Wie würden Sie Buschs gesellschaftliche Rolle in der DDR beschreiben? War er ein Staatskünstler?
Das Merkwürdige an Busch war: Auf der einen Seite hatte er eine unglaubliche Verbundenheit zum Staat, auf der anderen Seite gab es diese unglaublichen Enttäuschungen für ihn und Widersprüche, die dazu angetan gewesen wären, dass er mit allen und mit dem ZK sowieso im Clinch gelegen haben müsste. Das war, wenn ich mir das richtig überlege, das grundsätzliche Problem. […] „Die Bande“, hat er immer gesagt …
Damit meinte er das ZK?
Ja. (Pause) Wo hätte er denn sonst hingesollt? Es gab ja kein Ausweichen für diese Generation. […]
(Exkurs über die Frage, ob Busch in der DDR irgendwann zum Auslaufmodell geworden sei, was Ronald Paris verneint; Bemerkungen zur Situation nach der Wende; Bemerkungen zu Malerszene in der DDR, zu Willi Sitte, Bernhard Heisig, Werner Tübke und Heinz Zander; letzteren habe er in einem Gespräch mit Tübke mal als dessen Schüler bezeichnet, worauf Tübke geantwortet habe: „Um Gottes willen! Ich male schon offene Wunden, aber der stochert noch darin herum!“; Bemerkungen zur Neuen Leipziger Schule)
Es ist eine hypothetische Frage, aber ich stell sie trotzdem: Hatte die DDR, das politische System der DDR, eine große Bedeutung für Ihre Kunst? Oder würden Sie sagen, Sie hätten Ihr Werk auch in jedem anderen System schaffen können?
Den Nachteil oder den Vorteil, woanders gelebt zu haben, hatte ich nicht. Punkt. (Pause) Nein, ich möchte es auch nicht missen. Es sind ja unglaubliche Erfahrungen, die andere nicht gemacht haben – zu ihrem Nachteil. […] Wir haben uns selbst gefördert, wir haben entweder überzeugt mit unseren Arbeiten oder nicht. Und das hatte zur Folge, dass man hin und wieder Glück hatte, auch gefragt zu werden. Aber was uns im Grunde weiter gebracht hat, war nichts als reine Arbeit. Und natürlich gab es, vielleicht wollen Sie darauf hinaus, auch Opportunisten, die gerne das Geld genommen und unwahre Dinge gemacht haben. Das fällt durchs Sieb in der Geschichte, das ist klar. […] Was die Förderung durch unsere Lehrer betraf, die war hervorragend. Die Besonderheit war, dass sie fast alle diametrale Biografien hatten. Es gab solche, die schon, allerdings mit Auflagen, in der Nazizeit tätig gewesen waren, und es gab welche, die in der Emigration gewesen waren und zwar an ganz verschiedenen Orten. Dann gab es diejenigen, die ab ’49 als Formalisten verschrien waren wie mein maßgeblicher Lehrer Kurt Robbel. Er hat dann später seine Anerkennung gekriegt, die Qualität seiner Arbeit hat sich letztlich durchgesetzt. Aber er ist nicht unbeschädigt aus diesen Auseinandersetzungen hervorgegangen. Sehr dankbar war ich auch Otto Nagel, der mich eines Tages anrufen ließ, weil ihm irgendetwas von mir aufgefallen war, und mich einlud, Meisterschüler bei ihm zu werden – nach dem Motto „Dem Manne muss geholfen werden“. Das bedeutete drei Jahre unbeschwertes Arbeiten mit Stipendium, was gut passte, denn ich hatte gerade ’ne Familie gegründet. Dazu kam der Austausch mit der Akademie in Leninburg oder Petersgrad oder wie man das nun nennen möchte, was mir auch wichtig war. Die russischen Meisterschüler kamen zu uns, und wir zu ihnen. Ich war damals im Atelier des Malers Andrej Mylnikow, der unter Stalin zu leiden gehabt hatte – genau wie Deineka und Samochwalow (Alexander Alexandrowitsch Deineka und Alexander Nikolajewitsch Samochwalow; J.V.). In Erinnerung habe ich einen Besuch bei Samochwalow, der mal berühmt und zugleich berüchtigt geworden war durch ein großes Bild, auf dem Stalin zu sehen war, wie er zu Arbeitern spricht. Und Samochwalow war gerade dabei, den Stalin aus dem Bild raus zu malen … (lacht) Ich dachte bloß „Oh-Gott-oh-Gott“. Meine Mit-Meisterschüler habe ich natürlich auch in ihren Ateliers besucht. Wir haben uns dann ausgetauscht, so weit das möglich war, denn mein Russisch hat sich dort erst langsam wieder gefestigt. Die hatten immer zweierlei Bilder: (spricht mit russischem Akzent) „Das ist privat!“ – „Und das hier, aaah, Djengi, djla Djengi, das ist für Geld.“ Das waren dann Riesenschinken mit Lenin auf ‚m Panzer vor ‚m Smolny. Aber die Privatsachen waren mitunter wunderschöne Stilleben, die sie am Wochenende gemalt hatten, als sie in Sibirien beim Angeln waren …
Das scheinen die interessanteren Bilder gewesen zu sein …
Sicher.
Diese Unterscheidung haben Sie selbst nie gemacht.
Ich nicht, nein. Ich weiß auch nicht, inwieweit die russischen Kollegen dazu genötigt waren. Die haben sich da einfach keen großen Kopp gemacht. Das war eine Art entspannter Opportunismus. Dass zwei Seelen in der Brust gewohnt haben, schien denen nicht allzu viel auszumachen. […] In welchem Umfang so etwas in der DDR der Fall war, kann ich schwer sagen. Prinzipiell finde ich die Haltung nicht achtenswert, denn es ist unehrlich, es ist Selbstbetrug. Ansonsten gilt auch für diese Zeit der schöne Grundsatz: Es gibt nur schlechte und gute Bilder. […]
Interview: Jochen Voit
Foto: Jochen Voit
Textfassung autorisiert von Ronald Paris am 18. November 2007

Eberhard Rebling
über sein Leben und über seine Frau Lin Jaldati und seine Begegnungen mit Ernst Busch
„Er hat ein neues Genre der Gesangsmusik geschaffen: den deutschen politischen Song“
(Gespräch am 23. Februar 2006 in Ziegenhals bei Berlin)
Eberhard Rebling ist Jahrgang 1911. Geboren ist er in Berlin, wo er gemeinsam mit seinen zwei älteren Brüdern aufwächst. Der Vater ist preußischer Offizier, die Mutter Hausfrau. Die Erziehung wird bestimmt durch die Frömmigkeit der evangelischen Mutter und die nationale Gesinnung des Vaters („Er war kaisertreu bis ins Mark“). Eberhard Rebling besucht die Goethe-Schule, ein Realgymnasium in Wilmersdorf (heute: Michael-Grzimek-Schule). Frühzeitig erhält er Klavierunterricht und beschließt, Musiker zu werden. Nach dem Abitur studiert er Klavier und Musikwissenschaft und im Nebenfach Philosophie, in seiner Freizeit geht er in klassische Konzerte und ist regelmäßiger Besucher der Berliner Opernhäuser. Zwei Erlebnisse im Jahr 1932 sorgen dafür, dass sich Reblings bislang eher diffuse politische Anschauungen konkretisieren: Nachdem er Ernst Busch und Hanns Eisler live auf der Bühne erlebt hat und kurz darauf während einer Zugfahrt von Leo Balet über Karl Marx aufgeklärt worden ist, beginnt er, sich mit dem Marxismus zu beschäftigen, allerdings ohne der KPD beizutreten. Am 27. Februar 1933 sieht er den Reichstag brennen, bei den letzten freien Wahlen im März 1933 wählt er KPD. Sein Entschluss, Deutschland möglichst bald zu verlassen, steht fest. Zunächst promoviert er jedoch bei Arnold Schering über „Die soziologischen Grundlagen der Stilwandlung der Musik in Deutschland um die Mitte des 18. Jahrhunderts“. Kurz vor seinem 23. Geburtstag besteht er sein Examen, und im April 1935 lässt er die erforderlichen 300 Exemplare seiner Dissertation drucken. Im selben Jahr erscheint seine gemeinsam mit Leo Balet verfasste Untersuchung: „Die Verbürgerlichung der deutschen Kunst, Literatur und Musik im 18. Jahrhundert“. Im Oktober 1936 emigriert er in die Niederlande, wo er sich als Pianist, Kritiker und Musikwissenschaftler einen Namen macht. Hier lernt er die Tänzerin und Sängerin Lin Jaldati kennen und lieben – eine Heirat ist jedoch wegen der Nürnberger Rassegesetze, die für Deutsche auch in Holland gelten, nicht möglich. Nach dem Einmarsch der Deutschen beginnt für Eberhard Rebling und seine Frau ein Leben im Widerstand in verschiedenen Verstecken. Im Juli 1944 werden sie verhaftet und eingesperrt, Eberhard Rebling gelingt die Flucht, Lin Jaldati überlebt wie durch ein Wunder die Konzentrationslager Westerbork, Auschwitz und Bergen-Belsen. Am 27. Mai 1945 sehen sich die beiden wieder.
Der berufliche Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg gestaltet sich, nachdem das Paar zunächst erfolgreiche Konzerttourneen in Europa absolviert, zunehmend schwierig. Lin Jaldati, die bereits 1936 in die Kommunistische Partei der Niederlande (CPN) eingetreten ist, und Eberhard Rebling, seit 1946 Mitglied, bekommen den wachsenden Antikommunismus in den Niederlanden zu spüren. Zusammen mit ihren beiden Töchtern Kathinka (*1941) und Jalda (*1951) siedeln sie 1952 über in die DDR, wo Rebling Chefredakteur der Zeitschrift Musik und Gesellschaft wird. 1959 werden die holländischen Pässe der Familie nicht mehr verlängert, was vor allem für Lin Jaldati ein Schock ist. Rebling und seine Frau werden DDR-Bürger, beide treten der SED bei. Von 1959 bis 1972 ist Rebling Rektor der Ost-Berliner Musikhochschule, die 1964 auf seine Initiative hin den Namen „Hanns Eisler“ erhält. Nebenbei konzertiert er als Solopianist bis zu seinem 63. Lebensjahr, zu seinen Favoriten gehören neben neueren Werken Mozarts Krönungskonzert, Beethovens Es-Dur-Konzert und das D-Moll-Konzert von Brahms. Ein Schwächeanfall während eines Klavierabends in Schwerin und die darauf folgende Warnung seines Arztes beenden seine Pianisten-Karriere. Darüber hinaus begleitet er Jahre lang seine Frau auf dem Klavier, die mit ihren jiddischen Liedern Pionierarbeit in Deutschland und im Ausland leistet. „Ich hing immer an ihrem Munde,“ sagt Rebling. „Sie hätte gar keinen anderen Begleiter haben können, sie sang nie dasselbe, sie sang es immer ein bisschen anders.“ Bei einem Konzert im Jahr 1959 begleitet Rebling auch den amerikanischen Sänger Paul Robeson am Klavier, mit dem er und seine Frau bereits seit den 40er Jahren bekannt sind. Ein Jahr später gehören Rebling und Jaldati zusammen mit Perry Friedman zu den Mitbegründern der DDR-Singebewegung (zunächst „Hootenanny“ genannt). Beide treten auch in West-Deutschland mit Agitprop-Gruppen auf in „bunt gemischten Konzerten von Bremerhaven bis Lörrach – das waren Soljanka-Programme, wie man in der Sowjetunion zu sagen pflegte.“ In den 50er Jahren gastieren sie bei den bundesrepublikanischen Falken, in den 60er Jahren geben sie „Konzerte für die Frauen- und Friedensbewegung“.
Seit dem Tod seiner Frau 1988 lebt Eberhard Rebling zurückgezogen; die gemeinsam in der DDR geschriebenen Memoiren hat er „im selben Sinne weiter geschrieben“ und 1995 neu veröffentlicht. Das Buch hat über 750 Seiten. Im Oktober 2007 wird Eberhard Rebling von der israelischen Shoa-Gedenkstätte Yad va Shem als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet. Am 2. August 2008 stirbt Eberhard Rebling.
________________________________________________________________________
Bücher meines Gesprächspartners (Auswahl), die alle in mehreren Auflagen erschienen sind:
– Eberhard Rebling: Ballett gestern und heute. (Ost-) Berlin 1957.
– Eberhard Rebling: Die Tanzkunst Indiens. (Ost-) Berlin 1981.
– Eberhard Rebling: Die Tanzkunst Indonesiens. (Ost-) Berlin 1989.
– Lin Jaladati / Eberhard Rebling (Hrsg.): Es brennt, Brüder, es brennt. (’s brent, briderlech, ’s brent) Jiddische Lieder. Deutsche Nachdichtungen von Heinz Kahlau. (Ost-) Berlin 1966.
– Lin Jaladati / Eberhard Rebling: Sag nie, du gehst den letzten Weg. Lebenserinnerungen 1911 bis 1988. Marburg 1995 (erste Fassung der gemeinsamen Erinnerungen unter demselben Titel 1986 in der DDR erschienen).
______________________________________________________________________
JV: Können Sie bitte zunächst von Ihrer Kindheit erzählen?
Prof. Dr. Eberhard Rebling: Meine ersten Erinnerungen hängen mit dem Kriegsausbruch im August 1914 zusammen.
Da waren Sie gerade mal drei Jahre alt …
Noch nicht ganz. Aber das ist eine solche Aufregung gewesen! Meine Brüder waren 1905 und 1908 geboren worden, und die sind bei Kriegsausbruch – wie die ganze Bevölkerung – in Jubel ausgebrochen. Sie haben den ganzen Krieg als Spiel mitgemacht und jeden Tag die Kriegsberichte studiert. Dann haben sie das im Sommer in einem Wäldchen nachgespielt und im Winter mit Zinnsoldaten in der Stube. (…) Wir wohnten damals für einige Jahre in Oppeln, in Opole, im jetzigen Polen, zwischen Breslau und Kattowitz. Mein Vater war Hauptmann im Infanterieregiment Nummer 63, das in Oppeln stationiert war. Als der Krieg anfing, wurde er gleich einberufen und kam nach Belgien. Und weil bei uns anscheinend ein Angriff der Russen erwartet wurde, ist meine Mutter mit uns drei Kindern nach Breslau zu ihrem Vater gezogen. Aber der Angriff gegen Oberschlesien kam nicht, er richtete sich stattdessen gegen Tannenberg, wo der berühmte Hindenburg seine große Schlacht geschlagen hat … Na ja, mein Vater war ja bis zu seinem Tode ein Hindenburg-Fan durch und durch. Wir kehrten bald wieder nach Oppeln zurück, wo meine Brüder in die Schule gingen und ihre Kriegsspiele machten. Und ich habe nur die Ängste meiner Mutter miterlebt, sie weinte immerzu. So hab ich den Krieg von Anfang an als einen Schrecken erlebt. Sie weinte immer, weil sie fürchtete, dass mein Vater fallen könnte. Es kamen Nachrichten von allen möglichen anderen Offiziersfrauen, deren Männer gestorben waren. Da musste sie sich schwarz anziehen und Trauerbesuche machen, ich seh‘ das alles noch vor mir. Und dann ist mein Vater in ein Granatloch gestürzt und hat sich den linken Fuß verstaucht. Darüber hat sich meine Mutter gefreut, weil er dadurch nicht mehr an die Front kam, sondern jetzt im Generalgouvernement Belgien in Brüssel stationiert war. Und dann kam ein Kindheitserlebnis von mir, was ich nie vergessen werde: Mein Vater kam einmal, das muss ungefähr 1915 gewesen sein, für ein paar Tage auf Urlaub. Er brauchte zwei Tage mit dem Zug über Berlin und Breslau nach Oppeln und hatte nur wenig Zeit zur Verfügung. Und ich hatte irgendwas ausgefressen und eine flapsige Bemerkung gemacht. Er war furchtbar jähzornig, hat mir die Hosen runtergezogen und mir mit diesem Stock, der da in der Ecke steht, den ich immer noch benutze, den Hintern versohlt. Aber wie!
Mit dem Spazierstock?
Mit dem Spazierstock. Aber wie! Ich hab rote Striemen gekriegt, und meine Mutter hat geschrien: „Hör auf! Hör auf! Hör auf!“ Das hab ich nie vergessen, und so wurde ich Antimilitarist, schon als kleines Kind. Dann kam 1918 der Hungerwinter und dazu die Grippewelle, die Influenza, und da hab ich Mittelohrentzündung bekommen. (…) Es gab wenig zu essen, wir haben immer nur Kohlrüben gegessen, Kartoffeln gab ’s nicht mehr. Wenn ich nur an Kohlrüben denke, an diesen süßlich-weichlichen Geruch, dann wird mir jetzt noch übel. Nun hatte ich die Mittelohrentzündung, und es gab damals noch kein Penicillin. Und der Ohrenarzt in Oppeln war irgendwo im Felde. Also ist meine Mutter mit mir zu meinem Großvater nach Breslau gegangen, wo mich Dr. Hinze, der am selben Tag Geburtstag hatte wie ich, wir haben zusammen am 4. Dezember 1918 gefeiert, operiert hat. Der hat das anscheinend gut gemacht. Und dann, im Jahr 1919, nachdem mein Vater abdanken musste …
„Mein Vater hat immer gesagt: ‚Wir waren im Felde ungeschlagen!’“
Abdanken?
Na ja, auf einmal war Friede! Und für meinen Vater war eine Welt zusammengebrochen. Der Kaiser war nach Holland geflüchtet, und die Sozialdemokraten hatte man als Schuldige ausgemacht, es gab ja damals die Dolchstoßlegende. Mein Vater hat immer gesagt: „Wir waren im Felde ungeschlagen!“ Für ihn waren es sozusagen die bösen Hintermänner, die den Krieg beendet hatten. Aber mein Vater hat eine recht gute Abfindung bekommen und wollte nun, dass seine drei Söhne gute Akademiker werden. Er hat eine Wohnung in Berlin-Wilmersdorf in der Brandenburgischen Straße 19 gemietet, acht Zimmer. Für 320 Mark Miete. Da bin ich groß geworden. Ich bekam sofort Klavierunterricht, wie das so üblich war. Ich liebte die Musik und ging mit meiner Mutter gerne in die Kirche – nicht um der Predigten willen, die waren mir viel zu langweilig, aber wegen des Orgelspiels. Ich machte schnell Fortschritte auf dem Klavier, obwohl ich eine schreckliche Lehrerin hatte: Fräulein Elisabeth von Lengyel, sie war ungarischer Abkunft. Und sie wollte aus mir ein Wunderkind machen. Ich habe noch Walzer und Mazurkas von ihr mit Widmung: „Meinem lieben Schüler Eberhard zum achten Geburtstag 1919“. Sie hat mich viel zu schwere Stücke spielen lassen, und ich musste auf die ganz altmodische Weise mit einem Groschen auf dem Handrücken die Tonleitern rauf- und runterrasseln. Schrecklich! Ich wurde ganz steif in den Armen.
Hat Ihnen das die Musik nicht verleidet?
Nee, es hat mir die Lehrerin verleidet. Als ich elf Jahre alt war, bin ich endlich zu einer anderen gekommen, zu Frau Professor Lydia Lenz. Die wohnte in Berlin-Friedenau, und da bin ich dann zweimal in der Woche hingefahren.
Woher kommt Ihre Liebe zur Musik? Waren Ihre Eltern musikalisch?
Meine Mutter ja, mein Vater überhaupt nicht. Als ich in den ersten Jahren noch Unterricht bei diesem ewig trauernden Fräulein hatte, sie trug ständig einen Trauerschleier, warum weiß ich nicht, da ging meine Mutter am Sonntagvormittag immer in die Kirche. Und mein Vater hatte ein Heft besorgt mit dem Titel „Alte Kameraden – Preußische Militärmärsche“ und sagte dann: „Eberhard, spiel mir die Märsche!“ Na ja, die musste ich dann spielen. (…)
Erster Preis beim Musikwettbewerb 1929 in kurzen Hosen
Haben Sie Sich später als Jugendlicher auch für leichtere, populäre Musik interessiert?
Nein, es ging mir um klassische Musik. Ich habe alles von Bach bis Reger, der noch als modern galt, gespielt. Vor allem habe ich mich für Neue Musik interessiert. Meine Lehrerin war Mitglied des Tonkünstlerverbandes, und als dort 1929 ein Wettbewerb ausgeschrieben wurde, hat man mich als Pianisten zugelassen. Ich habe mir dann, weil die Bedingung war, dass man Neue Musik spielte, Stücke von Sergej Prokofjew und Ernst Toch ausgesucht, also Musik von damals noch lebenden Persönlichkeiten. Ich habe also gespielt, und dann hieß es beim Schlussentscheid: „Der erste Preis für Klavier geht an Eberhard Rebling!“ Oh, war ich stolz! Das war 1929, da bin ich noch in kurzen Hosen erschienen. Ich war der einzige, der noch Schüler war, die anderen waren alle schon älter.
Waren Sie auf einem musischen Gymnasium?
Nein, überhaupt nicht. Ich war in der Goethe-Schule, einem Realgymnasium, das war auch wieder so eine Fehlentscheidung meines Vaters.
Inwiefern?
Meine beiden älteren Brüder sind ins humanistische Gymnasium gegangen. Und mein ältester Bruder ist dann Ingenieur geworden, konnte also Latein und Griechisch überhaupt nicht gebrauchen. Aber er hat dadurch natürlich sein Denken gefördert. Und mein zweiter Bruder war ein Versager, er ist einmal sitzen geblieben und hat mit Mühe das Einjährige geschafft, das war der Abschluss der Untersekunda, der zehnten Klasse.
Was ist aus ihm geworden?
Weil er ein Versager war, ist er SA-Mann geworden. (…)
Stand für Sie schon in der Schulzeit fest, dass Sie die Musik zum Beruf machen würden?
Ja, und ich habe meinen Willen durchgesetzt. Mein Vater und alle meine Tanten haben gesagt: „Musik ist eine brotlose Kunst, das lass mal sein!“ Ich hatte mich aber schon bei Arnold Schering im Musikhistorischen Seminar an der Friedrich-Wilhelm-Universität, der heutigen Humboldt-Universität, angemeldet. Und da kam mein Vater immer noch an und wollte, dass ich Wirtschaftswissenschaft studiere. Es war ja die Zeit der großen Arbeitslosigkeit und der Weltwirtschaftskrise. Mein Vater war mittlerweile Geschäftsmann geworden, zeitweise arbeitete er als Vertreter für die Firma Katzenstein in Hamburg, die Import und Export machte. Und der Herr Katzenstein kam auch mal an und stellte sich uns vor: „Katzenstein, kein Jude!“ Mein Vater war natürlich, um Gottes willen, kein Antisemit – nein, nein, nein, wir haben ja immerhin einen jüdischen Hausarzt gehabt, den Dr. Schlesinger, der musste als Alibi genügen … Nun hatte es nach dem Ersten Weltkrieg einen großen Sog von Juden aus Russland und Polen gegeben, und die Juden ließen sich in Berlin nieder: die Reichen am Kurfürstendamm und in Dahlem und Zehlendorf, die Mittelklasse in Wilmersdorf und Charlottenburg, und die Armen im Scheunenviertel. In meiner Klasse waren die Hälfte der Jungs Juden. Mit einem, Gerhard Fuchs, habe ich mich schon in der Quarta angefreundet, und wir haben den Rest der Schulzeit immer auf einer Schulbank gesessen. Er ist jetzt erst vor drei Jahren gestorben, es ist eine lebenslange Freundschaft gewesen. Damals hat er mich etwas in das Judentum eingeführt, was eine völlig neue Welt für mich war. Ich bin ja ganz christlich erzogen worden. Meine Mutter hat noch bis zu ihrem Tod die Bibel gelesen, sie war sehr bibelfest – mein Vater gar nicht.
Ist Ihr Vater eigentlich, nachdem er nun Geschäftsmann war, in irgendeine Partei eingetreten?
Nein, aber er hat immer Deutschnationale Volkspartei (DNVP) gewählt, also Hindenburg. Hindenburg und Stresemann, das waren seine Leute. Und er war eigentlich gegen Hitler, aber nicht aus politischen Gründen, sondern weil der es im Ersten Weltkrieg nur bis zum Feldwebel gebracht hatte.
Ernst Busch-Konzert: „Ich war neugierig, was das für Musik sein mochte.“
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie schon als Kind während des Krieges antimilitaristisch geprägt worden sind …
Ja, und mein politisches Bewusstsein begann im Winter 1931/32, das war die Zeit der Weltwirtschaftskrise. Damals habe ich zum ersten Mal Ernst Busch gehört.
Wie kam das?
Ich bin sehr viel in Konzerte gegangen. Was das Musikleben Ende der 20er Jahre bis ’33 betraf, war Berlin der Mittelpunkt der Welt! Ich habe alle großen Dirigenten erlebt: Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Erich Kleiber, Leo Blech, Otto Klemperer; 1929 kam Arturo Toscanini mit der ganzen Mailänder Scala nach Berlin. Ich habe mir ständig Opern angesehen, es gab ja damals drei Opernhäuser, und bin bestimmt dreimal in der Woche ins Konzert gerannt. Mein ganzes Taschengeld habe ich dafür ausgegeben!
Wie kamen Sie dann zu Ernst Busch? Das ist ja nicht gerade ein Sänger im klassischen Sinne …
Ich war gegen meinen Vater eingestellt. Und diese Veranstaltung versprach, in eine ganz andere Richtung zu gehen. Es wurde damals viel über Ernst Busch gesprochen, und ich dachte: Ach, ich geh auch mal in sein Konzert. Ich war einfach neugierig, was das für eine Musik sein mochte. Und ich muss sagen: Mich interessierte eigentlich Hanns Eisler mehr als Busch. Hanns Eisler wohnte ganz in der Nähe, am Olivaer Platz, das wusste ich damals aber noch nicht. Es gab auch eine marxistische Musikschule oder so etwas, wo er Vorlesungen gehalten hat, auch davon habe ich leider erst später gehört. Jedenfalls bin ich im Frühjahr 1932, als ich gerade anfing, politisch bewusster zu werden, ins Theater am Nollendorfplatz gegangen und hab mir eine Matinee von Ernst Busch angehört.
Wissen Sie noch, was er da gesungen hat?
So genau weiß ich das nicht mehr, aber ich hab darüber geschrieben in unserer Autobiografie, die meine Frau und ich zusammen verfasst haben. Wir haben sie „Sag nie, du gehst den letzten Weg“ genannt nach dem jiddischen Partisanenlied. Ich hab das Buch hier, warten Sie, ich suche die Stelle … (Rebling blättert im Buch)
„Ich war berauscht von der metallisch glänzenden Stimme Buschs.“
Sie können mir von dem Konzert, wenn Sie mögen, auch einfach so erzählen. Was war denn der Unterschied zu Ihren bisherigen Musikerfahrungen?
Na ja, das kann man nicht vergleichen. Das Konzert mit Busch und Eisler war einfach etwas völlig anderes, das war eine Sensation! Schon das Publikum ist für mich eine enorme Überraschung gewesen. Sie müssen sich vorstellen: Sonntagvormittag, ausverkaufter Saal, hauptsächlich Arbeiter, die den Sänger auf der Bühne gut kennen und ihn anfeuern mit Zurufen und spontanem Zwischenapplaus. So etwas ist mir bis dahin völlig unbekannt gewesen! Es war eine aufregende, aufwühlende Stimmung, die mich elektrisierte. Das war ein Gemeinschaftserlebnis, das durch die vorwärts treibende Musik Hanns Eislers und den kraftvollen Vortrag Ernst Buschs unvergesslich für mich wurde. Und die Leute sind fast durchgedreht! Damals dachte ich mir: Vor solch einem begeisterten Publikum würde ich auch gerne einmal spielen! Aber ich spürte auch, dass diese Begeisterung etwas kaum Wiederholbares hatte, die ließ sich nicht einfach so erzeugen. Die Popularität, die Busch bei seinem Publikum genoss, die war einzigartig. Man kann das heute nicht mehr erklären, ein Auftritt wie dieser hatte mit klassischen Konzerten rein gar nichts zu tun, es war aber auch keine politische Kundgebung, es war etwas Eigenes. Ich denke, es trug Züge dessen, was später Popmusik genannt wurde, denn die Leute gingen dermaßen mit, sangen die Lieder mit und johlten wie im Fußballstadion. Für mich war es jedenfalls ein Erlebnis, das meinen weiteren Lebensweg entscheidend beeinflusst hat. Ich war berauscht von der metallisch glänzenden Stimme Buschs und den rhythmisch stampfenden Kompositionen Eislers – von da an wollte ich selbst auch Musik machen, mit der sich nicht nur ein bürgerliches Konzertpublikum, sondern auch ein Proletarierpublikum erreichen ließ. (…)
Zugfahrt mit Leo Balet: „Haben Sie mal etwas von Karl Marx gehört?“
Sie haben gesagt, dass Sie damals gerade anfingen, „politisch bewusster zu werden“. Hat dieses Konzert …
Dieses Konzert hat dazu beigetragen, dass ich Marxist geworden bin, ja. Wohlgemerkt: ohne dass ich damals schon etwas von Karl Marx gehört hatte … Hinzu kam kurz darauf ein zweites Erlebnis, das mich stark beeinflusst hat, das war eine Zugfahrt mit Leo Balet. Wir gastierten gemeinsam in einigen oberschlesischen Städten mit einem Programm zum 200. Geburtstag von Joseph Haydn. Für mich war es eine schöne Gelegenheit, mich als Pianist vor Publikum auszuprobieren. Es waren noch eine Sängerin und ein Geiger dabei und eben Dr. Balet, der zwischen den Musikstücken kurze Vorträge über Haydn hielt. Wir trafen uns am Bahnhof Charlottenburg und fuhren dann gemeinsam mit dem Schnellzug nach Breslau. Unterwegs erzählte ich ihm von meinen ersten pianistischen Erfolgen und meinem Universitätsstudium. Ich sagte: „Ich finde das Studium eigentlich unsinnig, wir lernen nur Fakten und Fakten und Fakten, die man sich auch aus Büchern beschaffen kann – was mir fehlt, sind die Zusammenhänge!“ Er hat sehr gelacht und ist dann ernst geworden und hat gesagt: „Haben Sie mal etwas von Karl Marx gehört?“ Ich sage: „Nee, wer ist denn das?“ Darauf er: „So sind unsere Universitäten! Da studiert einer Philosophie im Nebenfach im vierten Semester und hat noch nicht mal den Namen Karl Marx gehört!“ Er hat mir dann von Berlin bis nach Breslau einen Vortrag gehalten über historischen dialektischen Materialismus, über Sozialismus und Kommunismus, und mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Leo Balet hat tatsächlich bei mir, wie er später gesagt hat, eine kopernikanische Wende erreicht. Das war im Mai 1932 – in dem Jahr, als ich zum ersten Mal wählen und zum ersten mal Ernst Busch im Konzert erleben durfte. Es kam also einiges zusammen … (lacht)
(Exkurs über Eberhard Reblings erste Flugerfahrungen im Anschluss an die Tournee durch Oberschlesien und die Faszination des Fliegens)
Haben Sie Ernst Busch und Hanns Eisler in dieser Zeit noch ein weiteres Mal live erlebt?
Ja, und zwar bei einer großen Veranstaltung der Kommunistischen Partei in der Hasenheide. Da waren wieder fast nur Arbeiter in einem großen Saal, und die Stimmung war noch aufgeheizter als beim ersten Mal. Man merkte deutlich, wie beliebt Busch bei seinem Publikum war. Und Eisler saß am Klavier und begleitet ihn und schlug hin und wieder mit der Faust auf die Tasten – ich fand die Art, wie er spielte, fantastisch!
„Ernst Busch war ein Star! Er galt ja als ‚Barrikaden-Tauber’, das war sein Beiname.“
Wie konnte sich Busch in so einem großen Saal eigentlich Gehör verschaffen? Hat er mit Mikrofon gesungen?
Nee, er sang ohne Mikrofon, er hat immer „gebrüllt“! Er hat damals ein neues Genre der Gesangsmusik geschaffen: den politischen Song in deutscher Sprache. Man kannte ja vorher vorwiegend Chorlieder. Er war ja Solist. Und was er bot, war kein Belcanto, kein Operngesang, wo es auf die Worte überhaupt nicht ankam. Es war auch kein Konzertgesang, wo man auch immer den Text mitlesen musste. Das hier war Agitprop-Gesang, das heißt: Man musste jedes Wort verstehen. Und bei ihm verstand man alles, jedes Wort. Und dann diese metallene Stimme! Bei Busch sprang unmittelbar der Funke über auf das Publikum. Es ging sehr spontan zu bei diesen Veranstaltungen, in den bürgerlichen Konzerten dagegen wurde immer sehr gesittet geklatscht und gehüstelt, das war kein Vergleich!
Hatte Busch das Zeug, ein Star zu werden?
Er war ein Star! Er galt ja als „Barrikaden-Tauber, das war sein Beiname. Denn Tauber war damals der große Tenor, der von der Oper zur Operette rüber wechselte. (singt) „Dein ist mein ganzes Herz…“ Ich habe Tauber noch als Tamino gehört.
Hatte denn Ernst Busch wirklich was von Richard Tauber?
Ach wo, das war etwas ganz anderes. Man hat ihn eben nur verglichen, aber das betraf die Popularität, weil die bei beiden enorm war.
Der 27. Februar 1933: „Ich habe den Reichstag brennen sehen!“
Haben Sie Sich damals ’ne Schallplatte von Busch gekauft?
Nein, ich hatte kein Geld und hatte auch kein Grammophon. Aber ich habe mich dann sehr beeilt, es Busch gleichzutun und nach Holland zu emigrieren, als Hitler 1933 an die Macht geschoben wurde – er hat sie nicht ergriffen, er wurde an die Macht geschoben, das Wort von der „Machtergreifung“ stammt von Goebbels … Leo Balet hatte beim Abschied nach unserer Tournee zu mir gesagt: „Kommen Sie mich mal besuchen, ich wohne in der Künstlerkolonie am Breitenbachplatz!“ Dort wohnte er auf einem Flur mit Hermann Budzislawski, dem späteren Chef der „Weltbühne“, in der Künstlerkolonie wohnten auch Ernst Busch, Erich Weinert und viele andere berühmte Leute. Ich bin also dorthin gegangen und habe Leo Balet besucht. Und plötzlich fragt er mich: „Wollen Sie mit mir ein Buch schreiben? Es geht um die Verbürgerlichung der Literatur, Kunst und Musik im 18. Jahrhundert.“ Na, das war natürlich was für mich! Er konnte den Teil über die Musik nicht selbst bewältigen und wollte gerne, dass ich ihm half. Dieses Angebot war eine tolle Sache für mich, ich hab mich gleich an die Arbeit gemacht. So, und dann kam der 30. Januar 1933, und ich war in Panik. Dann kam der 27. Februar, und ich hab den Reichstag brennen sehen: Ich bin abends in der Staatsbibliothek gewesen und habe bis neun Uhr gearbeitet, dann wurde der Musiksaal zugemacht, und ich bin durch den Tiergarten nach Hause gelaufen. Unter den Linden war große Aufregung, ich sah all die Polizeiautos, die Feuerwehr fuhr hin und her. Dann kam ich zum Brandenburger Tor und sah, dass der Reichstag brannte.
Haben Sie Angst bekommen, dass jetzt in Deutschland alles den Bach runter geht?
Die hatte ich schon vorher. Am nächsten Tag stand dann in der Zeitung, dass der Kommunist Marinus van der Lubbe der Brandstifter gewesen sei. Ich sagte: „Das ist unmöglich!“ Das konnte kein Einzelner gewesen sein, denn dieses Riesengebäude hatte ja an allen Ecken und Enden gebrannt! Es ist dann bald das „Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitlerterror“ herausgekommen, darin war zu lesen, dass es von Görings Innenministerium einen unterirdischen Gang zum Reichstag gab. Später, als der VEB Deutsche Schallplatten in dem Haus untergebracht war, habe ich den Eingang zu diesem Gang selbst gesehen. Da war mir der Fall relativ klar. Es war ja beinahe alles, was die Nazis den Kommunisten in die Schuhe schieben wollten, von den Nazis selbst verursacht. Warum haben sie ausgerechnet den Reichstag brennen lassen? Weil sie das Parlament gehasst haben, das war ’ne „Quatschbude“ in ihren Augen – es ging ums „Führerprinzip“, und um nichts anderes. Vor ein paar Jahren habe ich darüber in Tutzing noch eine Auseinandersetzung mit dem Historiker Prof. Hans Mommsen gehabt. Der sagte, das stimme nicht, van der Lubbe sei der Einzeltäter gewesen. Ich sagte: „Ich habe den Reichstag brennen sehen, das ist unmöglich!“ (…)
„I invite you to come to our summerhouse during the holidays!“
Haben Sie den Reichstagsbrand damals als Alarmsignal empfunden, Deutschland möglichst bald zu verlassen?
Ja, das habe ich, aber es dauerte noch bis 1936, ehe ich tatsächlich nach Holland emigrierte. Ich wollte ja noch meine Dissertation in Berlin beenden. Am Tag nach dem Reichstagsbrand bin ich zum Laubenheimer Platz gegangen, wo ich wieder eine Verabredung mit Leo Balet hatte. Und ich komme hin, und die Käte, seine Frau, guckt runter und sagt: „Kommen Sie rauf!“ Oben in der Wohnung erklärt sie mir, dass Leo, genau wie Ernst Busch und andere, mit dem Nachtzug nach Holland geflüchtet war. Er hatte alle seine Arbeitsmaterialien mitgenommen, denn er wollte unser Projekt unbedingt weiterführen. Käte, die schwanger war, wollte noch ein paar Dinge erledigen und ihm dann nachfolgen. Ich habe Leo Balet dann zwei-, dreimal in Holland besucht und mit ihm an dem Buch gearbeitet. Das ging ganz gut, weil ich mich damals auf der Durchreise nach England und wieder zurück befand. Das hing mit einem „paying guest“ zusammen, den wir zu Hause in der Brandenburgischen Straße hatten. Für meinen Vater waren die Zeiten schlecht, und darum hatten meine Eltern untervermietet. Und dieser Engländer, Richard Malone, der bei uns wohnte, wurde ein guter Freund von mir, wir nannten ihn Dick. Er bekam eines Tages Besuch von seinem Vater, und Papa Malone liebte „dreamy music“, sein Lieblingsstück war der zweite Satz aus Beethovens „Pathétique“. Als ich zum Flügel ging und ihm das vorspielte, geriet er in Verzückung: „Oh, that’s marvellous! I invite you to come to our summerhouse during the holidays!“ Und tatsächlich durfte ich bald nach England fahren, weil ich so schön „dreamy music“ spielen konnte. Ich war dann auch in London, wo die Familie ein großes Flat in der Nähe des Marble Arch bewohnte, vor allem aber im Sommerhaus der Malones in Essex, in einem kleinen Ort zwischen London und Colchester. Ich habe dort fantastische Ferien erlebt. Diese Erfahrungen haben mich sehr bereichert. (…) Bei meinem vierten Englandaufenthalt, es war im Februar 1934, machte ich Zwischenstation in Noordwijk, wo Balet in einer kleinen billigen Wohnung den Winter verbrachte. Wir wollten unbedingt unser Buch fertig stellen und schrieben uns dauernd Briefe hin und her. Das Wunderbare ist, dass er all meine Briefe aufbewahrt hat und ich heute diese Briefe aus der Zeit von 1933 bis 1936 habe. (…)
War Leo Balet Mitglied der Kommunistischen Partei?
Nein, ich glaube nicht. Aber er engagierte sich in einer linken Schriftstellervereinigung, dem „Schutzverband deutscher Schriftsteller“. Er hat mich 1932 mal zu einer Veranstaltung mitgenommen, da habe ich Georg Lukács kennengelernt und Andor Gábor. Auch Erich Mühsam habe ich damals sprechen hören. All das hat mich sehr beeindruckt.
„Ich fühlte mich noch nicht reif genug, Genosse zu werden.“
Waren Sie Mitglied der Kommunistischen Partei?
Nein, aber ich würde sagen: Wenn Hitler ein Jahr später an die Macht gekommen wäre, dann wäre ich sicher Mitglied der Partei geworden. (…) Ich war dann also mehrfach im Ausland, in Prag, in Schweden, in Holland, und überall sprach ich mit Freunden über die politische Situation in Deutschland. Es war klar, dass ich nicht hier bleiben wollte. Dabei taten sich nun plötzlich ungeahnte Möglichkeiten auf, gerade im Bereich der Musik. Meine Klavierlehrerin sagte 1933 zu mir: „Der Arthur Schnabel, der Leonid Kreutzer, der Moritz Meyer-Mahr und der Erwin Bodky und wie sie alle heißen, die Juden, die haben jetzt alle ausgespielt. Jetzt kommt deine Chance, ich habe Einfluss, in ein paar Jahren kannst du es zum Professor bringen!“ Ich sagte: „Nee, das mache ich nicht.“
Man hat Ihnen also angeboten, richtig Karriere zu machen?
Wenn ich Nazi geworden wäre, hätte ich eine große Karriere machen können, dann wäre ich ein berühmter Nazi-Pianist geworden. Aber, nee, das war nichts für mich. Für mich stand fest, dass ich ins Ausland gehen würde. Ich habe zunächst meinen Doktortitel geholt und dann meine Schulden bezahlt, so ein Studium war ja teuer. Das Doktorexamen kostete auch ’nen Haufen Geld, man musste die Dissertation in 300 Exemplaren drucken lassen. Zudem hatten meine Eltern sich ja den Flügel gekauft, der mit 1950 Mark zwar lächerlich billig gewesen war, aber das war dennoch ein horrender Preis für meinen Vater und für mich. Ich habe geholfen, das abzubezahlen. Ich habe korrepetiert und Klavierstunden gegeben. Und dann bin ich nach Holland gegangen. Am 17. Oktober 1936 bin ich mit zehn Mark in der Tasche, mehr durfte man nicht mitnehmen, zwei Koffern und ’ner Schreibmaschine nach Den Haag gefahren. Balet hatte mich schon vorgewarnt, dass es schwer werden würde, in Holland Fuß zu fassen, das Land sei überschwemmt mit deutschen Künstlern. Na ja, ich habe das Risiko auf mich genommen …
Mein Vater sagte: „Komm mir nur nicht mit einer jüdischen Frau ins Haus!“
Haben Sie Sich von Ihren Freunden und Verwandten verabschiedet, als wäre es ein Abschied für lange Zeit?
Die meisten Freunde, vor allem die jüdischen Freunde, waren alle schon weg. Der Gerhard Fuchs war inzwischen in Palästina, und ein anderer Freund, Heinz Hollitscher, war zu seinem Vater nach Prag gegangen – ich war im Grunde ziemlich allein. Ich hatte eine liebe Freundin, das war eine Chinesin: Chin-hsin Yao, es ist immer platonisch geblieben, die ich auch unterrichtet habe – aber ansonsten vereinsamte ich nach ’33 immer mehr.
Wie war das Verhältnis zu Ihrem Bruder, der SA-Mann geworden war?
Vor dem musste ich aufpassen!
Es gab keinen brüderlichen Zusammenhalt …
Nein, überhaupt nicht. Wir waren nicht drei Brüder im brüderlichen Sinn, sondern wir gingen jeder seinen Weg. Mein ältester Bruder, ich nannte ihn „der Untertan“, hat immer alles getan, was unser Vater sagte. Er ist ab 1940, wie ich Jahre später erfahren habe, allerdings nicht von ihm, sondern durch eine Anfrage beim Bundesarchiv, Kriegsverwaltungsrat in Krakau gewesen, also am schlimmsten Ort. Er hat aber, wenn ich gefragt habe: „Was hast Du während des Krieges gemacht?“ behauptet, er sei Soldat gewesen und in amerikanische Gefangenschaft gekommen. Mit Politik habe er nichts am Hut gehabt. Das war aber nur ein Zehntel der Wahrheit. Aus den Archiv-Unterlagen ging auch hervor, dass er Mitglied der NSDAP gewesen war. Und der zweite Bruder, der SA-Mann geworden war, hat sich noch im November 1944, als der Krieg schon fast zu Ende war, freiwillig zur Waffen-SS gemeldet und ist dann hier auf den Seelower Höhen gefallen. (…) Das Schönste ist, dass mein Vater vor ’33 immer sagte: „Du hast so viele jüdische Freunde, wenn du mir nur nicht mit einer jüdischen Frau ins Haus kommst!“ Den Gefallen habe ich ihm nicht getan! Na ja, nun bin ich also nach Holland gekommen, und da hab ich unwahrscheinliches Glück gehabt. Die ersten Wochen lebte ich ganz sparsam, kaufte mir Puddingbroodjes, das waren so gemanschte Dinger, die aus Resten vom Vortag bestanden, da gab ’s drei für ’n Dubbeltje, also für zehn Cent. Das war das Billigste, was es gab. Wenn ich mich mal richtig satt essen wollte, dann ging ich in die Cafeteria und habe mir da ein Hutspot bestellt für 25 Cent.
„In Den Haag habe ich eine Woche im Puff gelebt.“
Wo haben Sie gewohnt?
Gewohnt habe ich erst bei Freunden in Wassenaar, dann in Bussum und dann in Utrecht, das waren meine Stationen in den ersten sechs Wochen. (…) Als ich in Utrecht nicht mehr bleiben konnte, bin ich mit der Eisenbahn nach Den Haag gefahren. Ich hatte nämlich ein neues Buchprojekt mit Balet, diesmal ging es um das 17. Jahrhundert in Holland. In dieser Zeit hat es zwar keine berühmten Musiker gegeben, aber die holländischen Maler haben dauernd musizierende Menschen dargestellt. Diesen Zusammenhang wollten wir erforschen. Ich habe dann viel in der Königlichen Bibliothek gearbeitet. Ich weiß noch, wie ich in Den Haag ankam und in einem Zigarrenladen fragte, ich hatte inzwischen schon ganz gut Holländisch gelernt, wo ich übernachten könnte, ob er nicht eine billige Pension wüsste. Ich hatte Hut und Mantel an und sah elegant aus, ’n ganz normaler junger Mann. Der Zigarrenhändler war sehr freundlich und sagte: „Gehen Sie hier die Straße runter, dann links rum auf den Fluwelen Burgwal Nummer acht.“ Da ging ich hin und wunderte mich über die dunkle Stimmung und die stark geschminkte Dame, die mir das Zimmer zeigte. Sie fragte mich, wie lange ich bleiben wollte, eine Nacht oder länger. Eine ganze Woche sei billiger, es gebe auch Frühstück. Und als ich das bezahlt hatte, es war wirklich sehr billig, merkte ich erst, dass ich in einem Puff gelandet war. (Lachen) Ich habe eine Woche im Puff gelebt, und die Damen haben wohl gestaunt, dass ich von ihren Diensten keinen Gebrauch gemacht habe. Am nächsten Morgen musste ich mich bei der Fremdenpolizei melden, dort sagte man mir: „Das ist doch keine Adresse für Sie!“ – „Ja,“ sagte ich, „das hab ich gemerkt, aber es ist sehr billig!“ Na ja, nach einer Woche bin ich umgezogen in eine richtige Pension, das war im November, Dezember 1936. Und dann hörte ich von Ben Polak, dass es in Voorburg ein Gemeinschaftshaus gab, wo lauter junge Leute wohnten, so ungefähr 17, 18 Leute. Jeder hatte sein eigenes Zimmer, es gab eine Haushälterin, alle aßen zusammen, die meisten Bewohner waren Studenten, Männlein und Weiblein durcheinander – das war damals etwas ganz Modernes. Und in diesem Gemeinschaftshaus wurde ein Zimmer frei. Dort bin ich Weihnachten ’36 eingezogen.
Kannten Sie eine vergleichbare Einrichtung bereits aus Deutschland?
Nein, gar nicht, das war für mich etwas ganz Neues! Später nannte man diese Art des Zusammenlebens „Kommune“. Diese Art der Freizügigkeit war fantastisch und ganz ungewohnt für mich, ich bin doch streng preußisch erzogen worden. In meinem Zimmer hatte vorher ein junger Mann gewohnt, der nach Spanien gegangen war zu den Internationalen Brigaden. Also, das waren lauter fortschrittliche Leute.
Das waren also Linke …
Ja, sie waren aber auch sehr freizügig was freie Liebe betrifft und so weiter. Und es waren sehr kreative Leute, die meisten waren an der Hochschule für Bildende Kunst in Den Haag. Als sie hörten, dass ich Pianist bin, sagten sie: „Ach, du musst unbedingt einen Klavierabend geben!“ Dazu haben sie dann alle möglichen Leute eingeladen und Kontakte für mich hergestellt, sodass ich mir schon im ersten Jahr eine eigene Existenz als Pianist und Korrepetitor aufbauen konnte.
Liebe auf den ersten und zweiten Blick: Lin Jaldati und Eberhard Rebling
Sie haben dann in den Niederlanden auch Ihre Frau kennengelernt …
Ja, das war im November 1937 kurz nach meiner dreimonatigen Reise durch Ostindien. (…)
(Exkurs zu Reblings Tournee mit Darja Collin und Alexander von Swaine durch Niederländisch-Ostindien; kennengelernt hat er die Tänzerin Darja Collin durch einen Auftritt als Pianist, den er in der Tanzschule von Peter Leoneff absolviert)
Das größte Glück, das ich im Gemeinschaftshaus hatte, war, dass ich die Lin kennengelernt habe. Sie war Tänzerin und tanzte in der Bouwmeester-Revue, sie war jeweils zwei Monate in Den Haag und in Amsterdam. Im Gemeinschaftshaus bekam sie ein Zimmer unter mir. Für mich war es Liebe auf den ersten Blick, bei ihr dauerte es eine Weile … Eines Tages ist sie bei Glatteis vom Fahrrad gefallen und hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, und Ben Polak, der Doktor war, sagte zu mir: „Du kannst nicht mehr Klavier üben, sie muss vier Wochen absolute Ruhe haben!“ Na ja, dann habe ich eine Weile woanders geübt. Am 31. Dezember waren dann alle Bewohner des Hauses weg bis auf Lin und mich und einen Jungen, dessen Eltern in Indonesien waren. Wir feierten zusammen, und um Mitternacht habe ich ihr den ersten Kuss gegeben, hmm, das ging mir durch Mark und Bein – aber ihr nicht … Schließlich habe ich ihr Herz gewonnen durch meine Musik. Nach einigen Wochen sagte sie zu mir: „Du kannst schon wieder spielen, nur nicht so laut!“ Da habe ich die E-Dur-Etüde von Chopin, (singt) Da-di-da-da-di, Di-di-da-di, extra für sie studiert. Am achten März habe ich ein Hauskonzert gegeben, bei dem sie auch dabei war, sie saß direkt neben mir. Und am 27. März haben wir uns dann zusammengetan, und dann ist das eine große Liebe geworden …
Die große Liebe Ihres Lebens …
Ja, genau 50 Jahre …
Reinhold Andert, von dem ich Sie übrigens grüßen soll, hat von Konzerten Ihrer Frau erzählt, bei denen Sie am Klavier saßen …
Das haben wir lange Zeit gemacht. Sie war ja nicht nur Ballett-Tänzerin, sondern sang nebenher auch jiddische Lieder. Ich kannte damals diese melancholischen Weisen nicht und fragte: „Was singst Du denn da?“ – „Das sind jiddische Lieder!“ Ich sagte: „Was ist denn das?“ Ich hatte zwar vier Jahre studiert und war Doktor der Musikwissenschaft, aber was jiddische Lieder waren, wusste ich nicht. Da hat sie mich aufgeklärt und mir Bücher gegeben, da eröffnete sich mir das ganze Universum des Ostjudentums. Sie tanzte auch einige Solotänze auf jiddische Themen, meistens Frauengestalten. Ich habe sie ermutigt, mehr solistisch zu arbeiten und habe angefangen, sie am Klavier zu begleiten. Nachdem ich sie in der Bouwmeester-Revue gesehen hatte, wo sie die zweite von links war und in chinesischen und griechischen und in-ich-weiß-nicht-was für Gewändern tanzte, sagte ich zu ihr: „Hör mal zu, in Dir steckt viel mehr als diese ewige Huppdohlerei!“
„’41 kam die Einberufung zur Wehrmacht, da bin ich untergetaucht.“
„Huppdohlerei“, damit meinten Sie das Revue-Tanzen …
Ja, heute müssen die Mädchen ja alle 1,76 groß sein, damals standen die 24 Mädchen wie die Orgelpfeifen auf der Bühne. Hier ist auch ein Foto drin (zeigt auf das Buch). Aber 300 mal im Jahr immer dasselbe zu tanzen, das tötet ja jede Kreativität. Sie hat dann einige Choreographien ausgearbeitet, und ich habe die Musik dazu ausgesucht. Ich sagte: „Das musst Du zum Hauptberuf machen!“ „Ja“, sagte sie, „aber ich muss doch Geld verdienen!“ Ich sagte: „Damit kannst Du auch Geld verdienen! Wenn Du von der Revue weg bist, machen wir unten im Haus ein Gymnastik- und Tanzstudio auf.“ Das haben wir gemacht, Lin hat Kinder unterrichtet und dicke Damen und alles, was möglich war, und damit gut verdient. Nebenbei gaben wir unsere ersten selbst organisierten Konzerte mit jiddischen Liedern … Und dann kam am 24. April 1940 der große Durchbruch: Nach unserem Konzert kam ein Musikmanager zu uns, der völlig begeistert war und sagte: „Ich werde für Sie im nächsten Jahr Konzerte in Belgien, in der Schweiz und in England organisieren!“ Das war am 24. April 1940 – am 10. Mai wurde Holland überfallen.
Damit war alles zunichte gemacht …
Ja, damit war alles zunichte gemacht. Wir konnten nicht mehr zusammen auftreten, sie konnte in ihrem Studio nur noch jüdische Kinder unterrichten. Am achten August 1941 bekamen wir unsere erste Tochter, die später Geigerin wurde.
Hatten Sie in dieser Zeit Kontakte zu anderen Emigranten? Sie waren ja nicht Mitglied einer Partei …
Nein, ich hatte wenig Kontakte, nur mit Nathan Notowicz habe ich hin und wieder gesprochen. Aber ansonsten hatte ich nur Kontakt mit Holländern. Ich war in keiner Partei, und ich war weder rassisch noch politisch verfolgt. Ich war ja, wie ich in Deutschland offiziell gesagt hatte, aus wissenschaftlichen Gründen in Holland, um an dem neuen Projekt von Balet mitzuarbeiten. Balet hat Gott sei Dank noch 1939 einen Ruf bekommen an das Brooklyn College in New York und ist mit seiner Frau nach Amerika gefahren. (…) Ich bekam dann kurz nach der Geburt unserer Tochter die Einberufung zur Wehrmacht, darauf bin ich untergetaucht.
„Das Einheitsfrontlied haben wir wie einen Schatz bewahrt und immer wieder abgespielt!“
Waren Sie bei der Musterung?
Ja, vorher habe ich mit Dr. Ben Polak eine Hungerkur gemacht, damit ich möglichst erbärmlich aussehe. Dann stand ich da nackig vor den feisten Offizieren und stellte mich auf die Waage. Der Arzt sagte: „101 Pfund, bisschen wenig!“ Es hieß dann „bedingt k.v.“, also bedingt kriegsverwendungsfähig. Na ja, zum Glück wurde ich nicht gleich eingezogen. Aber dann kam der Winter und damit der erste Gegenschlag der Sowjets vor Moskau, und ich wurde einberufen. Ich sollte mich am 15. Februar 1942 in Wolfenbüttel melden. Im Gemeinschaftshaus habe ich also meine neue Adresse in Wolfenbüttel hinterlassen. Dass ich untertauchte, wussten nur ganz wenige Leute. Auch die Lin durfte nicht wissen, wo ich war. Erst bin ich in Bergen untergetaucht, wo mich niemand kannte. Es dauerte ’ne Weile, da wurde im Gemeinschaftshaus eine Hausdurchsuchung gemacht, aber ich hatte all meine Sachen in Kisten verstaut und weggeschafft. Meinen Flügel hatten wir Bekannten übergeben und gesagt: „Wenn wir nicht zurückkommen, könnt ihr ihn behalten, ansonsten werden wir ihn wieder abholen nach dem Krieg.“ (…)
Vor dem Einmarsch der deutschen Truppen gab es in den Niederlanden ja ein sehr reges Kulturleben. Inwieweit haben Sie wahrgenommen, dass da auch deutsche Emigranten eine Rolle in der Kabarett- und Theaterszene gespielt haben?
Es waren viele deutsche Künstler da, das stimmt, zum Beispiel die Nelson-Revue mit Eva Busch. Und meine Lin hat mir erzählt, dass sie auch Ernst Busch in Holland auf der Bühne gesehen und gehört hat, das muss 1935 gewesen sein. Sie war ganz begeistert von ihm und hatte auch eine Schallplatte von ihm mit dem „Einheitsfrontlied“ – die haben wir wie einen Schatz bewahrt und immer wieder abgespielt. Leider ist sie während der Untertauchzeit kaputt gegangen. Aber die Lin bewunderte den Busch – genau das, was er machte, wollte sie auch machen, nur auf anderem Gebiet. (…)
Verhaftung 1944: „Wir übergeben Sie dem Militärgericht, die machen kurzen Prozess mit Ihnen!“
Nachdem Sie Ihrer Einberufung nicht gefolgt waren, begann Ihr Leben in der Illegalität …
Ja, wir mussten beide untertauchen, zuerst getrennt voneinander, dann gemeinsam in Amsterdam. Schließlich hatte ich das große Glück, dass ich unter falschem Namen ein Haus in Huizen mieten konnte, wo wir auch die ganze Familie meiner Frau untergebracht haben. Das Haus hieß „’t Hooge Nest“, das Hohe Nest. Da sind wir alle am ersten Februar ’43 eingezogen. Wir hofften, gemeinsam mit Freunden hier bis zum Ende des Krieges bleiben zu können. Aber wir wurden am zehnten Juli 1944 überfallen und verhaftet. Die anderen wurden gleich nach Westerbork gebracht, um dann nach Auschwitz überführt zu werden, meine Frau auch. Und mir wurde am 13. Juli ’44 im Haus des Sicherheitsdienstes vom Chef mitgeteilt: „Morgen übergeben wir Sie dem Militärgericht, die machen kurzen Prozess mit Ihnen! Sie werden zum Tode verurteilt wegen Fahnenflucht, Sabotage, Landesverrat und Rassenschande, das genügt.“ Ich hatte mit dem Leben wirklich total abgeschlossen. In der Nacht vorher hatte man noch meine Frau und mich zusammen in eine Zelle ins Gefängnis in der Marnixstraat gesperrt, und da hatte ich so eine Eingebung und habe zu ihr gesagt: „Sollten wir einander jemals wieder sehen, dann in der Johannes-Verhulst-Straat bei unseren besten Freunden …“ – da hat sie mir den Mund zugehalten und gesagt: „Red doch nicht so einen Unsinn, das ist doch total aussichtslos.“ Das war es auch, es war Juli ’44, und wir hatten Hoffnung in die zweite Front gesetzt und gedacht, im September würde der Krieg zu Ende sein. Die Amerikaner und die Engländer standen ja schon vor Paris, aber ich würde das nicht überleben, das wussten wir alle. Am nächsten Vormittag, die Lin war schon in ein anderes Gefängnis abgeführt worden, sollte ich mit einem Polizeiauto zum Haus der Gestapo in die Euterpestraat gebracht werden. Aber das Auto fuhr erst woanders hin. Das war so ein geschlossener Wagen mit gegenüberliegenden Sitzen, hier war eine Wand zum Chauffeur, nach der anderen Seite zwei aufschlagende Türen und zwei Fenstern, die weit offen waren, es war sehr heiß an dem Tag. Es war der 14. Juli 1944. Und das Auto fuhr also in eine andere Richtung, um noch jemanden zu holen. Wir waren zu dritt, und dabei waren zwei Polizisten. Jannie, meine Schwägerin, saß neben mir, gegenüber saß noch ein älterer Mitgefangener, daneben der andere Bewacher. Und wir hielten in der Spaarndammerstraat, einer Arbeitergegend. Und der eine Polizist ging weg, jetzt waren wir zu dritt mit nur einem Polizisten. Und ich beobachtete Jannie und dachte schon, sie würde versuchen, die Tür zu öffnen. Aber sie setzte sich ganz nach vorne und fing mit dem Polizisten ein belangloses Gespräch an. Das war für mich das Zeichen, dass ich hinter ihrem Rücken raus konnte. Und ich stürzte auf die Bank und stürzte raus aus ‚m Fenster. Sie umarmte ihn, hielt ihn fest, er war ziemlich klein, aber er hat sie natürlich abgeschüttelt und wollte noch nach mir greifen, packte aber nur noch meinen Mantel, ich hatte so ’n dünnen Trenchcoat an, der Regenmantel zerriss in zwei Stücke, und ich rannte so schnell ich konnte den Bürgersteig hinunter. Ich dachte, dass mir jemand folgen würde, aber niemand folgte mir. Es war früh um halb neun, die Leute guckten alle, ich rannte bis zur nächsten Ecke, da war eine offene Tür, und eine Frau nährte gerade ihr Kind. Zu der sagte ich: „Können Sie bitte den Mantel verschwinden lassen?“ Und ging wieder raus und sah, dass mir niemand folgte, und lief woanders weiter wie ein normaler Fußgänger. Ich wollte irgendwie in die Innenstadt kommen, da kannte ich verschiedene Adressen, wo ich hätte unterkommen können. Auf dem Weg musste ich die Haarlemmerstraat überqueren, da standen lauter SS-Leute und Polizisten, da bin ich eine andere Gracht zurückgegangen und wollte über ’ne Brücke, da stand wieder ein Uniformierter, aber dann kam ich näher und sah: „Ach, das ist nur ’n Brückenwärter!“ Ich rüber über die Brücke und gehe 100 Meter weiter auf der anderen Seite, blicke mich um und sehe, dass der die Brücke hochzieht, ohne dass ein Boot kommt. Ich denke: „Sollten die wegen mir das ganze Viertel absperren?“ Es stellte sich später raus, dass es so war. Aber ich war schon weg. Ich bin dann auf allerlei Nebenstraßen in die Stadt gekommen und habe bei Lex Metz geklingelt, den ich aus dem Gemeinschaftshaus kannte. Aber da meldete sich niemand. Ich versuchte es bei der Fotografin Eva Besnyö, sie machte auf, und ich stürzte rein. „Wo kommst Du denn her?“ Ich sage: „Ich bin geflohen!“ Später hat sie mir gesagt, dass sie noch nie jemanden in so einem Zustand gesehen hatte – ich muss Schaum vor ‚m Mund gehabt haben. Nachdem ich mich beruhigt hatte, hat sie dann ein neues Foto von mir gemacht, und ich habe am selben Tage noch ’nen anderen Personalausweis bekommen. (…)
„Eine tapfere Widerstandskämpferin hat unsere Tochter gerettet.“
Wo war ihre Tochter in dieser Zeit?
Das war meine erste Frage an Eva: „Was ist mit Kathinka?“ Denn meiner Frau hatten sie bei einem Verhör gedroht: „Wenn du weiter so störrisch bist, dann werden wir dich mit deiner Tochter konfrontieren!“ So hatten sie es ’33 mit der Lilo Hermann gemacht, und die war standhaft geblieben, auch als man ihr das eigene Kind gezeigt hat – das ist unglaublich … Ich bat also Eva, meinen Schwager Bob anzurufen. Der kam dann nach ’ner halben Stunde mit der guten Nachricht aus Huizen, dass Kathinka in Sicherheit war. Sie war nach unserer Verhaftung zu Dr. van den Berg, der uns als Arzt betreut hatte, gebracht worden. Von dort hatte sie eine Freundin unter abenteuerlichen Umständen entführt – gerade noch rechtzeitig, denn der Arzt hatte den Auftrag bekommen, das Kind nach Amsterdam ins Haus des Sicherheitsdienstes zu bringen und hätte das auch gemacht. Erst 2003 habe ich durch das Buch „Kopfgeld“ des Journalisten van Liemt erfahren, was da genau vor sich gegangen ist. Van Liemt hat verschiedene Prozessakten und Vernehmungsprotokolle untersucht, die 50 Jahre lang unter Verschluss lagen. Er hat auch die Geschichte unserer Verhaftung von der anderen Seite erzählt. Daraus geht hervor, dass die Kathinka gesucht wurde und sehr gefährdet war. Lin und ich hatten ja nicht heiraten dürfen wegen der „Nürnberger Gesetze“, und unsere Kathinka galt als Jüdin. Nachdem man Lin und mich verhaftet hatte, war nun ein Freund aus Bergen gekommen, Jan Hemelrijk, um unsere Tochter bei dem Arzt abzuholen. Aber die Frau des Arztes fing furchtbar an zu schreien, und die Sache misslang. Er konnte die Kathinka auch nicht einfach mitnehmen, weil er kein Fahrrad dabei hatte, er war mit dem Zug aus Bergen gekommen. Darauf ist er zu einer Bekannten gegangen, Marion van Binsbergen, und hat ihr das erzählt. Und sie sagte: „Ich gehe zu dem Arzt und hole das Kind da raus!“ Am gleichen Morgen, als mir die Flucht gelang, ist sie mit dem Fahrrad zum Haus des Arztes gefahren und ist durch den Hintereingang reingekommen. Sie hat die Kathinka auf den Arm genommen, ist zum Fahrrad gerannt, die Frau fing wieder an zu schreien, und Marion ist mit dem Kind über die Heide davon gefahren. So hat diese tapfere Widerstandskämpferin unsere Tochter gerettet. Ich dachte damals, dass Kathinka vielleicht als Geisel für mich benutzt werden sollte. Aber das war nicht so. Es ging auch bei Kathinka, die steckbrieflich gesucht war, um Kopfgeld. Man bekam für jeden Juden, den man anbrachte, 15 Gulden, das wären heute etwa 40 Euro. Und wir waren ja in unserem „Hohen Nest“ in Huizen 16 Personen gewesen, davon waren nur meine Schwager und ich keine Juden. Meine Frau und meine Schwägerin Jannie sind nach Auschwitz gebracht worden und dann nach Bergen-Belsen, und beide haben überlebt. (…)
Brief aus Bergen-Belsen: „Wir haben entsetzliche Dinge erlebt, aber wir leben!“
Sie haben Sich erst 1945 wiedergesehen …
Ja, Kathinka und ich hatten den Hungerwinter ’44/’45 in der Nähe von Leiden überstanden – durch die Solidarität holländischer Freunde. Und als dann die Befreiung kam, bin ich mit einem kaputten Fahrrad nach Amsterdam gefahren und habe für den Fall, dass Lin und Jannie zurückkommen sollten, ich hatte ja keine Ahnung, wo sie waren, in der Johannes-Verhulst-Straat eine Adresse hinterlassen. Dann bin ich wieder zurückgeradelt. Zehn Tage später, am 16. Mai, hatte ich ein ganz merkwürdiges Gefühl, und ich beschloss, noch mal nach Amsterdam zu fahren. Ich hatte mit Freunden inzwischen einige Hauskonzerte gegeben und war mittlerweile auch „enttarnt“ worden, und kaum jemand wollte glauben, dass ich ein Deutscher war. Jedenfalls stand ich nun wieder in der Johannes-Verhulst-Straat, aber da war alles wie zuvor, keine Nachricht für mich. Ich übernachtete dort, und am andern Morgen, am 17. Mai, klingelt es, und da steht plötzlich vor der Tür ein Mann der BS, der Binnenlandse Strijdkrachten, das waren militärisch organisierte Untertaucher, die im letzten Kriegswinter sehr viel organisiert und nach dem Abzug der Deutschen die Macht übernommen hatten. Denn es gingen ja noch drei Tage vorbei, ehe die Kanadier kamen und Holland besetzten. Der Mann von der BS fragte: „Sind Sie Herr Stotijn?“ Haakon Stotijn hieß der Freund, bei dem Lin und ich uns treffen wollten … Ich sage: „Nein, der bin ich nicht, aber ich bin mit ihm gut befreundet und treffe ihn heute in Oegstgeest.“ – „Es ist ein Brief für ihn abgegeben worden.“ Mir lief es schon kalt übern Rücken. „Sie können den Brief abholen im Büro der BS in der Jan-Willem-Brouwers-Plein gegenüber vom Concertgebouw.“ Ich hab mich wie ein Irrer angezogen und bin hingegangen. Es war ein Brief von Lin und Jannie aus Bergen-Belsen. Sie hatten den Brief am 10. Mai geschrieben. Am 15. April war Bergen-Belsen von den Engländern befreit worden, und die beiden hatten auf diesem Zettel geschrieben: „Wir haben entsetzliche Dinge erlebt, aber wir leben!“ Lin war bei der Befreiung bewusstlos gewesen und hat nur noch 28 Kilo gewogen. Sie hat Fleckentyphus gehabt, und wenn die Engländer drei, vier Tage später gekommen wären, hätte sie wohl nicht mehr gelebt. Die Jannie hat auch Fleckentyphus bekommen, aber erst später, als sie in einem Hospital waren. So hab ich die Botschaft erhalten …
Sie müssen Sich wie verrückt gefreut haben …
(Pause) Gefreut ist nicht das richtige Wort … Ich habe wie ein Schlosshund geheult! Und der Beamte dort sagte: „Seien Sie froh, dass Sie eine gute Nachricht haben, wir kriegen hier so viele schlechte Nachrichten!“ Es war überhaupt ein Wunder, dass dieser Brief aus Bergen-Belsen innerhalb von acht Tagen in Holland ankam. Das war einer Reihe von glücklichen Umständen zu verdanken … Wiedergesehen haben wir uns am 27. Mai, Haakon und ich gaben gemeinsam mit anderen Musikern an diesem Sonntag ein Abschiedskonzert in Oegstgeest, es war ein Bach-Abend. Ich spielte zuerst die Chromatische Phantasie und Fuge, dann spielten Haakon, der Oboist, und ein Hobbygeiger, der sehr gut Geige spielte, das Konzert für Oboe und Violine, ich am Flügel. Zum Schluss kam die Hochzeitskantate „Weichet nur, betrübte Schatten“. Es sang Frau Kramer, die dänische Sängerin, ich saß am Flügel, neben mir war das Fenster. Und in den beiden Zimmern saßen dicht gedrängt die Menschen, wir waren ja im Lauf der Zeit eine verschworene Gemeinschaft geworden. An der Seite saß ein Streichquartett von Leidener Professoren. Und die Sängerin sang: „Und dieses ist das hohe Glücke, / Daß durch ein hohes Gunstgeschicke / Zwei Seelen einen Schmuck erlanget, / An dem viel Heil und Segen pranget.“ Und auf „Seeegen“ eine lange Koloratur, da hält plötzlich ein Auto vor der Tür. Da steigt eine kleine Gestalt aus, und ich sehe nur, dass die Lin da ist … Sie hatte also in Amsterdam den Brief mit der Adresse gefunden und hatte erst die Jannie bei ihrem Bob und den beiden Kindern auf der Amstel abgesetzt und war dann weiter gefahren. Sie hatte großes Glück gehabt, dass sie in Enschede einen Arzt getroffen hatte, der mit einem Auto unterwegs war, weil er Insulin zu verschiedenen zuckerkranken Leuten bringen musste. Dieser Arzt hatte sie nun bis vor unser Haus gefahren. So haben wir uns wiedergefunden unter den Klängen von Bach … Das ist so wunderlich, so unbegreiflich! Na ja, wir sind dann nach Amsterdam zurückgezogen und haben unser zweites Leben angefangen.
Übersiedlung in die DDR: „Wir wollten eigentlich in Holland bleiben.“
Ihr „zweites Leben“ fand zunächst in den Niederlanden statt. Nach einigen Jahren haben Sie Sich dann entschieden, in die DDR überzusiedeln. Warum?
Die Kommunistenhetze der McCarthy-Zeit hat auch auf Holland übergegriffen. Ich war seit 1946 Mitglied der holländischen Partei. Das war möglich, nachdem ich die holländische Staatsbürgerschaft angefragt hatte, die ich dann 1948 auch bekam. Die Lin war schon 1936 Mitglied der Partei geworden. Als Musikredakteur der kommunistischen Zeitung „De Waarheid“ verdiente ich nicht genug, also traten wir nebenher international auf, machten Schulkonzerte für 25 Gulden pro Konzert, an manchen Tagen hatten wir drei, vier Konzerte, also das läpperte sich zusammen und wurde schnell zu unserer Haupteinnahmequelle … Aber so ab ’48, ’49 ließ das allmählich nach, und bald wurden wir nirgends mehr engagiert. Der Organisator dieser Konzerte, Herr Aufrecht, machte seinem Namen alle Ehre und sagte zu mir: „Herr Dr. Rebling, ich muss Sie dringend sprechen!“ Ich sage: „Was ist los?“ – „Ich kann Sie nicht mehr beschäftigen.“ Ich sage: „Warum? Ist meine Arbeit schlecht?“ – „Nein, ich habe nur gute Sachen gehört! Aber ich bekomme Subventionen vom Reich und von den Gemeinden. Und man hat mir gedroht, die Subventionen zu kürzen, wenn ich Sie weiter engagiere.“ Da waren die Schulkonzerte weg.
Weil Sie Kommunist waren?
Weil ich bei „De Waarheid“ war, ja. Und weil ich als Kommunist bekannt war. Lin und ich sind ja auch bei kommunistischen Veranstaltungen zusammen aufgetreten. Wir haben da sehr politische Musik gemacht und haben versucht, eine neue Arbeiterkultur aufzubauen. Das war ja bekannt in Holland.
Haben Sie da auch die Brecht / Eislerschen Lieder gespielt?
Ja, aber es gab ja kaum etwas anderes als das „Einheitsfrontlied“, die anderen Lieder waren ja nicht veröffentlicht. 1948 habe ich in Prag Hanns Eisler zum ersten Mal persönlich gesprochen, da war der Kongress der fortschrittlichen Komponisten und Musikwissenschaftler, wo er ein Aufsehen erregendes Referat gehalten hat. Dazu gibt es eine hübsche Anekdote: Man hätte ja ’48 in Prag kein Deutsch auf der Straße sprechen können, man wäre gelyncht worden, so verhasst war alles, was deutsch war. Die vier Kongress-Sprachen waren Tschechisch, Russisch, Englisch und Französisch. Hanns Eisler fing also an, auf Englisch zu sprechen, und plötzlich sagte er: „Ach, lassen Sie uns Schweizerisch sprechen!“ Und von dem Moment an war die Hauptumgangssprache Deutsch auf diesem Kongress. (Lachen) So haben wir Hanns Eisler kennengelernt. Wir haben ihm dann gesagt, dass seine vielen Lieder kaum zu kriegen seien. „Das wird sich schon ändern!“, sagte er.
Sie sind also aus politischen Gründen in die DDR gegangen …
Wir wollten eigentlich in Holland bleiben. Aber dann bekam ich auch noch Krach mit der holländischen Partei, weil es damals sehr gegen Tito ging …
… der als Abweichler galt …
… ja, aber wir verehrten Tito, weil er der Einzige war, der sein Land selbst befreit hatte mit seinen Partisanen. Und dann hat mich „De Waarheid“ entlassen, und ich saß zwischen allen Stühlen und verdiente nichts mehr.
Wo wollte Ihre Frau gerne leben? Hat sie auch gesagt: „Lass uns in die DDR gehen“?
Nee, sie wollte gar nicht. Aber ich war ’51 in Berlin beim Gründungskongress des Verbandes der Komponisten und Musikwissenschaftler (VdKM), da habe ich mit dem Paul Wandel gesprochen, der war damals fürs Erziehungswesen zuständig. Und der hat zu mir gesagt: „Komm zu uns, wir brauchen Dich dringend! Du kannst sofort die Chefredaktion der Zeitschrift Musik und Gesellschaft übernehmen!“ Naja, das war natürlich ein Angebot … Ich habe zu diesem Zeitpunkt in Holland nur noch Presseberichte für die ungarische Botschaft geschrieben, weil ich ja irgendwo Geld verdienen musste.
War Ihre Frau sofort damit einverstanden, nach Ost-Berlin zu gehen?
Na ja, sie hat später mal gesagt: „Das war der schwerste Entschluss meines Lebens!“ Das hat sie 1982 in einer Fernsehdokumentation zu ihrem 70. Geburtstag gesagt, und so war es auch. (…) Sie hatte anfangs auch eine schwere Zeit hier …
Sie wäre lieber in Holland geblieben …
Natürlich! Ich wäre auch lieber in Holland geblieben!
Also waren eigentlich berufliche Gründe ausschlaggebend für den Umzug …
Ja, ich hatte in Holland nichts mehr zu tun, ich wurde nicht mehr gebraucht. Im Februar 1952 sind wir dann in die DDR gezogen.
„Ich war schon ’n weltberühmter Kommunist, da habt Ihr noch in die Windeln geschissen!“
Sie haben ja schon vorher Verbindungen zur DDR gehabt und sind öfters nach Berlin gekommen. Die Klaviernoten zur „Mutter“ von Hanns Eisler, die Sie mir gezeigt haben, sind Ihnen im Jahr 1951 von Ernst Busch gewidmet worden …
Ja, die Lin und ich hatten schon 1947 für die UNRA im Camp für „displaced persons“ am Schlachtensee ein Konzert gegeben, bevor wir dann am 14. Juni 1949 im Haus des Kulturbundes erstmals mit jiddischen Liedern in (Ost-) Berlin auftraten. Und da saß die ganze Prominenz, vorne in der ersten Reihe saß Arnold Zweig mit seinem Hörapparat. Dann waren da Anna Seghers und Ernst Busch und Jean Kurt Forest und alle möglichen Leute im Saal. Das war ein Riesenerfolg, dadurch ist die Lin bekannt geworden in Ost-Berlin! Nachdem wir dann nach Berlin gezogen waren, haben wir im November 1952 im Haus der Sowjetischen Kultur wieder einen Abend mit jiddischen Liedern gegeben – ohne zu wissen, dass im August des gleichen Jahres unter Stalin einige der besten jiddischen Schriftsteller ermordet worden waren, das haben wir erst viel später gehört. Mit Ernst Busch hatten wir auch schon früh Kontakt, weil die Lin und ich merkten, dass die Konzerte mit jiddischen Liedern allein nicht zu bestreiten waren. Das war schon in Holland so, und wir suchten für unsere Programme nun auch internationale Lieder, und Busch schenkte uns dieses Heft mit Eisler-Liedern, die er ja auch gesungen hat.
Hatten Sie auch überlegt, mit Ihrer Frau ’ne Schallplatte rauszubringen bei Lied der Zeit?
Nee, das ist erst später gekommen. Wir haben damals zwar Aufnahmen im Haus des Rundfunks in der Masurenallee gemacht, aber erst ein paar Jahre später wurden dann im Pläne-Verlag in Dortmund drei, vier Platten veröffentlicht. Das waren noch die 78er Platten mit einem Lied auf einer Seite, das muss so ’56 gewesen sein.
Zu diesem Zeitpunkt war Busch ja auch schon nicht mehr Chef von Lied der Zeit …
Der Ernst Busch hat ja mit der Partei große Schwierigkeiten gehabt. Es wurde gemunkelt, ob es stimmt, weiß ich nicht, dass ihn bei der Parteiüberprüfung 1950 zwei junge Schnösel besucht haben. Und die hat er rausgeschmissen. Er hat gebrüllt: „Ich war schon ’n weltberühmter Kommunist, da habt Ihr noch in die Windeln geschissen!“ Es hat dann eine Zeit gegeben, wo er nicht Mitglied der Partei war. Erst später hat man ihm das wieder angetragen.
Das hat man sich damals erzählt? Oder woher wissen Sie das?
Ja, das wurde erzählt. Vor allem, dass er die Funktionäre rausgeschmissen hatte … Aber da fällt mir noch eine Geschichte ein, die ihn betrifft. Wir wunderten uns, als wir in die DDR kamen, dass er gar keine politischen Lieder mehr sang. Aber wir konnten ihn im Theater am Berliner Ensemble sehen. Und Lin und ich saßen vorne in der dritten Reihe, als „Mutter Courage und ihre Kinder“ gespielt wurde und die Helene Weigel über die Bühne tourte. Busch spielte den Koch, und der war ja ursprünglich Holländer. Na ja, auf alle Fälle war das die hundertsoundsovielte Aufführung, und es war schon ’ne richtige Routine drin. Und Busch mischte ab und zu etwas Improvisiertes darunter. Plötzlich trat die Yvette auf, und Busch sagte auf Holländisch: „Oh, wat en lecker Snolletje!“
Was heißt das?
Snol ist ein Kosename für eine Hure. Und wir saßen da vorne und fingen laut an zu lachen. Und er guckte runter, hat uns gesehen und hat dann im Lauf des Abends noch allerlei holländische Flüche eingebaut. Das war sehr lustig … Eine andere hübsche Episode hat meine Lin erzählt, die steht auch in unserem Buch: Sie saß in den 60er Jahren bei einer Preisverleihung vom Zentralrat der FDJ, es ging um die Erich-Weinert-Medaille, den Kulturpreis der FDJ. Da waren lauter Künstler und Intellektuelle eingeladen, und die Lin saß ganz vorne, links neben ihr Bruno Apitz und rechts neben ihr Ernst Busch. Und als der Aurich da ’ne lange Rede hielt, entspann sich über ihrem Kopf ein Gespräch. Apitz (im Flüsterton): „Sag mal, Ernst, Du hast doch einen Sohn, Ulrich. Wie alt ist denn der?“ – Busch: „Na, so drei Jahre.“ – Apitz: „Ja, und ich habe eine Tochter, mein Bienchen, meine Sabine!“ – Fragt Busch: „Wie alt ist die?“ – Apitz: „’n halbes Jahr.“ – Busch: „Viel zu alt! Wenn Du noch eine produzierst, die zwei Jahre jünger ist, können wir drüber reden.“ Die Lin saß dazwischen und konnte sich vor Lachen kaum halten.
„Ich habe mal einen Streit mit Ernst Busch wegen Fürnbergs ‚Lied der Partei’ gehabt.“
Sind Sie auch mal mit Ernst Busch aufgetreten?
Ja, wir sind 1976 zusammen mit Ernst Busch im Filmtheater „Kosmos“ aufgetreten, Gisela May und verschiedene andere waren dabei, es war ein Gedenkkonzert für Paul Robeson. Nun hatte Ernst Busch in den letzten Jahren Gedächtnisstörungen und legte sich deswegen immer die Texte auf den Fügel, er stand seitlich hinter dem Flügel. Ich erinnere mich, dass, er einmal im Saal der Akademie mit den Texten durcheinander kam, und dann lagen die alle auf dem Boden, und wir stürzten rauf, um ihm die Texte wieder auf den Flügel zu legen. Jedenfalls war er bei diesem Konzert 1976 furchtbar nervös. Bevor er auf die Bühne ging, machte ihm seine Frau Irene noch den Hemdknopf zu, wir saßen daneben, vorne in der ersten Reihe. Gisela May hatte schon gesungen, dann trat Ernst Busch auf und sang die „Jarama-Front“ und noch ein anderes Lied. Alles klappte wunderbar, und anschließend war die Lin dran, sie war noch viel aufgeregter. Sie verehrte doch den Busch und fand es unglaublich, direkt nach ihm aufzutreten. Sie sang „If We Die“, das war das letzte Gedicht, das Ethel Rosenberg im Gefängnis geschrieben hatte. Edino Krieger, ein brasilianischer Komponist, hatte die Musik dazu komponiert. Dann sang sie das jiddische Partisanenlied, das Paul Robeson auch oft gesungen hatte. Das war dann der Schluss, es war unsere letzte Zusammenkunft mit Ernst Busch.
Haben Sie ein Lieblingslied von Ernst Busch?
Ach, das kann ich nicht sagen.
Welche Lieder verbinden Sie am stärksten mit ihm?
Na ja, hauptsächlich das Einheitsfront- und das Solidaritätslied, da kommt mir sofort seine Stimme in den Sinn. Aber es gab so viele andere Lieder … Ich habe alle seine Schallplatten hier! (…) Ich habe übrigens mal einen Streit mit Ernst Busch wegen Louis Fürnbergs „Lied der Partei“ gehabt. Das kam so: Wir waren sehr befreundet mit Louis Fürnberg. Er ist ja sehr früh gestorben, und ich habe danach seiner Frau Lotte versprochen, alle seine Lieder herauszugeben. Ich bin dann hin- und hergereist, habe zum Teil Melodien rekonstruiert, habe mir Lieder von verschiedenen Leuten vorsingen lassen, denn es war nicht alles erschienen. Zum Teil hatte Louis auch Lieder auf Band gesungen, sodass ich am Ende dann doch alles beisammen hatte. Das Buch erschien 1966 bei Breitkopf & Härtel in Leipzig, so ’n großer grüner Band. Da drin habe ich auch geschrieben, dass ich das „Lied von der Partei“ so aufgeschrieben habe, wie er es auf einem Band gesungen hat. Beim „Lied von den Träumern“ habe ich es genauso gemacht. Und zwar sang der das „Lied von der Partei“ wie ein Wiener Chanson: (singt auftaktig und sehr sanft) „ Sie hat uns Alles gegeben. / Sonne und Wind. Und sie geizte nie. /Wo sie war, war das Leben. / Was wir sind, sind wir durch sie. / Sie hat uns niemals verlassen. / Fror auch die Welt, uns war warm. / Uns schützt die Mutter der Massen. / Uns trägt ihr mächtiger Arm. / Die Partei, die Partei, die hat immer recht. / Und, Genossen, es bleibe dabei. / Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht …“ Er hat das gesungen, als ob er das seinem Sohn mitteilen wollte. Und so habe ich das abgedruckt und auch dazugeschrieben, dass Louis Fürnberg sich das so vorgestellt hatte. Und dass er sich nicht dagegen hatte wehren können, dass sein Lied wie ein Marsch gesungen wurde. Busch hat gesungen: (poltert marschmäßig) „Sie hat uns alles gegeben … Die Partei, die Partei, die hat immer Recht“ – Busch hat ja oft Lieder geändert. Aber das war überhaupt nicht in Fürnbergs Sinn. Und als Busch das Liederbuch zu Gesicht bekam, war Busch sehr erbost und hat gegen mich polemisiert.
Hatte Fürnberg die Busch-Version damals nicht autorisiert?
Wissen Sie, Louis Fürnberg war ein ganz lieber Mensch. Der freute sich ja, wenn seine Lieder überhaupt gesungen wurden. Natürlich hat er zu Busch gesagt: Ist in Ordnung. (…) Jedenfalls hat Ernst Busch dieses Marschartige eingeführt – allerdings nicht auf so üble Weise, wie es dann die FDJ-Chöre alle getan haben.
Haben Sie mit Busch über die Sache gesprochen?
Nein, er hat sich schriftlich geäußert, er hat sich in irgendeiner Zeitschrift beschwert und war sehr böse auf mich. Ich habe ihm geantwortet, aber das ist dann im Sande verlaufen. (…)
Fanden Sie dieses Lied interessant?
Nun, ich habe es so wiedergegeben, wie es der Fürnberg auf Band gesungen hat, um möglichst authentisch zu sein.
Ist das Lied in der Fürnberg-Version besser?
Na ja, es ist nicht so sehr Agitprop, es ist mehr chansonartig.
Aber der Text ist doch Agitprop …
Ja, natürlich ist das Agitprop. Nun kommt noch etwas: In den 50er Jahren ist der Busch ja als Liedsänger gar nicht aufgetreten, weil sich die Partei gegen Agitprop gewandt hatte. Es hieß: „Wir haben jetzt die Macht und brauchen kein Agitprop mehr!“ Aber dann hat Brecht 1956 kurz vor seinem Tode auf einem Schriftsteller-Kongress gesagt: „Wir brauchen wieder eine neue Agitprop-Bewegung. Und dann kamen, Langhoff hat dafür gesorgt, 1957 eine Tucholsky-Matinee und dann eine Brecht-Matinee, zu der meine Frau und ich gingen. Und da hat Ernst Busch ein Lied gesungen, das uns durch Mark und Bein ging, weil er diese Schwierigkeiten mit der Partei hatte: „O Falladah, die du hangest“ oder „Ein Pferd klagt an“. Busch sang: „Was für eine Kälte muss über die Leute gekommen sein!“ Bei Brecht steht „muss unter die Leute“, aber Busch sang „muss über die Leute“, aber das war nicht der Punkt. Ich empfand das als eine Klage gegen die Partei, weil die Partei ihn so mies behandelt hatte in den 50er Jahren. Wir alle haben das so empfunden, wir haben hinterher noch darüber diskutiert, dass der Busch da seinen Frust rausgesungen hatte. Aber es war ein Menetekel.
Was meinen Sie damit?
Dass der Umschwung 33 Jahre später kam: 1990. (…)
Was war Ihrer Meinung nach das Charakteristische an Busch als Sänger?
Die innere Überzeugung. Und das politische Bewusstsein, das er in den Liedern zum Ausdruck brachte. Und in seiner Interpretation das deutliche Aussprechen jedes Wortes. Bei ihm konnte man auch in einem großen Saal jedes Wort verstehen – was ja bei Kunstsängern nicht der Fall ist. Er hat, wie ich schon eingangs sagte, ein neues Genre geschaffen. Und er hatte natürlich eine unvergleichliche, metallische Stimme. (…)
Glauben Sie, dass er an seine Popularität der 30er Jahre in der DDR anknüpfen konnte?
Na ja, im Alter ist er natürlich weniger aufgetreten. Aber Ernst Busch war in der DDR auch bei der Jugend ein Begriff. Er hat versucht, die Tradition weiterzugeben. Das deutet ja auch die Tatsache an, dass die Schauspielschule nach ihm benannt wurde, und das finde ich sehr gut. (…)
Interview: Jochen Voit
Foto: Jochen Voit
(Textfassung autorisiert von Prof. Dr. Eberhard Rebling unter Mithilfe von Jalda Rebling im Frühjahr 2008)

Werner Sellhorn
über Jazz und Politik in der DDR und die Unfähigkeit, früh aufzustehen
„Ernst Busch verkörperte den richtig verstandenen Sozialismus - nicht diesen kastrierten Sozialismus, den die hier verbrochen haben.“
(Gespräch am 17. Januar 2006 in Berlin-Prenzlauer Berg)
Werner „Josh“ Sellhorn ist Jahrgang 1930. Die ersten Kindheitsjahre verbringt er in Hamburg, wo er in einem, wie er sagt, „kleinbürgerlichen Elternhaus“ aufwächst. Nach der Trennung der Eltern 1942 bleibt er zunächst bei seinem Vater, einem Justizangestellten, und dessen neuer Lebensgefährtin. In Hamburg ausgebombt kommt er ein Jahr später nach Berlin zu seiner Mutter, die ihn aber nicht bei sich aufnehmen kann, sodass Werner Sellhorn zunächst auf sich allein gestellt ist. Kurze Zeit findet er Unterschlupf in einem Lager, in dem russische Zwangsarbeiter eingesperrt sind, anschließend kommt er in ein Waisenhaus. Die Mutter bringt den Jungen schließlich in der Schulfarm Insel Scharfenberg unter, einem ursprünglich reformpädagogischen Internat im Tegeler See, das zu einer nationalsozialistischen Erziehungsanstalt umfunktioniert ist. Im Rahmen der Kinderlandverschickung wird die Schule nach Wiek auf Rügen ausgelagert, das Kriegsende erlebt Werner Sellhorn in Mecklenburg. Zurück in der Trümmerstadt Berlin versucht er sich kurze Zeit als Zigarettenschieber; er wohnt zur Untermiete in der Schönhauser Allee und besucht die Karl-Marx-Oberschule in Neukölln. 1946 verlässt er Berlin auf Bitten der Mutter, die inzwischen in einem Dorf in der Westprignitz als Gemeindeschwester arbeitet. In Wittenberge geht er auf die Oberschule und macht 1950 Abitur. Das Fernsein von der Großstadt kompensiert Werner Sellhorn durch Besuche im Schallplattenladen, wo er sich vor allem die Amiga-Neuerscheinungen vorspielen lässt. Er begeistert sich für diverse Genres, kauft sich Schellacks von Ernst Busch, Bully Buhlan und dem Alexandrow-Ensemble. Neben der Musik gilt sein Interesse dem Sport und der Politik. 1950 wird er DDR-Studentenmeister im Boxen (Bantam-Gewicht). Sellhorn ist überzeugter Sozialist und seit 1949 in der SED: „Ich war der einzige Schüler – wenn wir Parteiversammlung hatten, saßen da nur Lehrer und ich!“ Ab 1950 studiert er Philosophie an der Humboldt-Universität in (Ost-) Berlin und vertieft sich ab 1956 in den Blues und den Jazz; Freunde in West-Berlin helfen ihm, die in der DDR nicht erhältlichen Platten zu bekommen. In den Semesterferien besucht er seinen Bruder und die Mutter, die in Wittenberge als Betriebsschwester in einem Zellwolle- und einem Nähmaschinenwerk arbeitet. Nach dem Studium, das wegen Überschreitung der Abgabefrist für die Abschlussarbeit als nicht bestanden gewertet wird, muss sich Sellhorn „in der Produktion bewähren“. Auch mit der Partei bekommt er Schwierigkeiten, was 1957 zum Ausschluss auf eigenen Antrag führt. Als Sozialist fühlt sich Sellhorn nach wie vor; 1958 wird er vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS) als sogenannter Gesellschaftlicher Informant (GI) angeworben. Unter dem Decknamen „Zirkel“ verfasst er Berichte über Künstler in der DDR und in West-Berlin. Nach dem Tod seiner ersten Frau Regina Sellhorn 1957 heiratet er 1960 die Tochter von Isot Kilian (die ebenfalls Isot heißt). Im Jahr 1963 bricht er den Kontakt zum MfS ab, u.a. weil seine neue Lebensgefährtin strikt dagegen ist. Mittlerweile hat Sellhorn als Verlagslektor und -werbeleiter Fuß gefasst und seine Musikleidenschaft zum Zweitberuf gemacht. Für den Verlag Volk und Welt organisiert er 1963 die Veranstaltungsreihe „Jazz und Lyrik“, die 1964/65 knapp hundertmal in Städten der DDR aufgeführt wird und große Publikumsresonanz findet. Mit dabei sind die Jazz-Optimisten Berlin mit dem Sänger Manfred Krug, der auch Texte rezitiert. 1965 startet das neue ebenfalls erfolgreiche Programm mit dem Titel „Lyrik – Jazz – Prosa“. Als Gastsolisten treten Künstler auf wie die Jazzsängerin Ruth Hohmann, der Liedermacher Wolf Biermann, der Kabarettist Gerd E. Schäfer, die Schauspielerinnen Angelika Domröse und Annekathrin Bürger sowie die Schauspieler Eberhard Esche, Gerry Wolf und Edwin Marian. Nach einer Solidaritätsaktion „seiner“ Künstler für den verhafteten Biermann im Jahr 1965 wird Sellhorn mit einem Berufsverbot in belletristischen Verlagen der DDR belegt. Er arbeitet nun frei schaffend als Lektor, Herausgeber und Nachwortautor, schreibt Liner Notes für Amiga-Platten, meist Lizenzausgaben amerikanischer Jazzproduktionen. In den letzten zwei Jahrzehnten der DDR ist Sellhorn, dessen Spitzname „Josh“ auf seine Begeisterung für den Blues-Sänger Josh White zurückgeht, als Manager und Ansager von Jazzgruppen tätig. Außerdem reist er mit Schallplattenvorträgen über Jazz und Rock durch die DDR. Mittlerweile gilt er, neben Karlheinz Drechsel, als führender Jazz-Spezialist in der DDR. Zwischen 1972 und 1976 nimmt das MfS erneut Kontakt zu Sellhorn auf und gewinnt ihn als sogenannten Inoffiziellen Mitarbeiter (IM), diesmal liefert er jedoch keine Berichte, es werden lediglich Gespräche mit ihm geführt. Da Sellhorn gegen die Ausbürgerung Biermanns protestiert, endet die Zusammenarbeit mit der Stasi 1976. Sellhorn wird nun endgültig bewusst, „dass hier in der DDR etwas grundsätzlich schief läuft“, wie er sagt. Er setzt sich dafür ein, dass die mit Auftrittsverbot belegte Bettina Wegner auf Tournee gehen kann. In den 80ern stellt er musikalisch-literarische Programme zusammen – mit Künstlern wie Peter Bause und Mike Friedman. Seit der Wiedervereinigung kümmert sich Sellhorn vorrangig um das musikalische Erbe der DDR. Er kompiliert CD-Editionen für Buschfunk, Eulenspiegel und Amiga, veröffentlicht Artikel, Rezensionen und Bücher, geht wieder als Ansager auf Tournee („Jazz-Lyrik-Prosa“) und macht musikalische Programme mit seinem Sohn Karsten Troyke. Für kurze Zeit ist er Chefredakteur der Zeitschrift Horch und Guck, die sich der Aufarbeitung der SED-Diktatur widmet, wird jedoch entlassen, als seine Stasi-Tätigkeit bekannt wird. Der Plattensammler, Musikpublizist und „Jazz-Hamster“ (so nennt ihn Manfred Krug), der fünf Kinder aus fünf Ehen hat, lebt in Berlin-Prenzlauer Berg.
Der Duden bei ihm im Regal steht eingeklemmt zwischen einem Jazzlexikon und einer Janis-Joplin-Biografie. Werner „Josh“ Sellhorn ist ein Musikfan mit großem Sendungsbewusstsein, ein geübter Erzähler, der im Interview vom hundertsten ins tausendste kommt, ohne jemals (im Gegensatz zum Interviewer) den Faden zu verlieren. Als eine 90er Kassette voll ist, eine zweite habe ich nicht dabei, sagt er: „So, und jetzt erzähle ich Ihnen meine Stasi-Geschichte.“ Seine Autobiografie ist in Vorbereitung.
Am 17. Mai 2009 starb Werner „Josh“ Sellhorn im Alter von 79 Jahren in Berlin.
________________________________________________________________________
Bücher und Artikel meines Gesprächspartners (Auswahl):
– Gerhard Branstner / Werner Sellhorn (Hrsg.): Anekdoten. (Ost-) Berlin 1962.
– Erich Weinert: Die juckt es wieder. Ein Vortragsbuch mit 100 Gedichten und 3 Aufsätzen. Hrsg. v. Werner Sellhorn m. Hilfe v. Li Weinert. (Ost-) Berlin 1964.
– Werner Sellhorn / Gerhard Branstner (Hrsg.): Das Tier lacht nicht. Ein Stammbuch des komischen Menschen. (Ost-) Berlin 1965.
– Louis Armstrong: Mein Leben in New Orleans. Aus d. Amerikan. v. Hans Georg Brenner. Hrsg. u. m. e. Nachw. v. Werner Sellhorn. (Ost-) Berlin 1967.
– Werner Sellhorn (Hrsg.) Protestsongs. (Ost-) Berlin 1968.
– B. Traven: Erzählungen (2 Bde.). Hrsg. u. m. e. Nachw. v. Werner Sellhorn. (Ost-) Berlin 1968.
– Josh Sellhorn: Meine Kontakte zur Stasi. In: Horch und Guck 3/1994 (Heft 13), S. 50-52 (+ Dokumententeil zum GI/IM „Zirkel“, S. 53-64).
– Werner Josh Sellhorn: Das Hausbuch des Humors. Berlin 2000.
– Werner Josh Sellhorn: Jazz – DDR – Fakten. Mit einem Geleitwort von Manfred Krug. Interpreten, Diskographien, Fotos, CD. Berlin 2005.
– Werner Josh Sellhorn: Jazz – Lyrik – Prosa. Zur Geschichte von drei Kultserien. Berlin 2008.
___________________________________________________________________________
Von Sellhorns Musikveranstaltungen sind Mitschnitte auf LP bzw. CD veröffentlicht. Legendär sind die LP „Jazz und Lyrik“ (1965) von einer Veranstaltung aus dem Jahr 1964 und die LP „Lyrik – Jazz – Prosa“ (1968) von einer Veranstaltung aus dem Jahr 1965. In den 90er Jahren erschien eine zusammenfassende CD unter dem Titel „Jazz – Lyrik – Prosa“. Weitere neun CDs sind von Sellhorns neuer (seit 1997 laufender) „Jazz – Lyrik – Prosa“-Reihe herausgekommen.
__________________________________________________________________________
JV: Wer waren Ihre frühen musikalischen Helden?
Werner „Josh“ Sellhorn: Meine musische Vorbildung war, um es deutlich zu sagen, beschissen. Mein Vater hatte zwar ’nen Bücherschrank, wo vielleicht zehn Bücher drin standen, aber der war immer zugesperrt, da durften wir Kinder gar nicht ran. Ab und an hat er uns sonntags in Plattdeutsch was von Fritz Reutter vorgelesen oder Bildergeschichten von Wilhelm Busch gezeigt. Aber das war außergewöhnlich, man hat in der Richtung keine wirkliche Bildung gekriegt. Immerhin hat mein Vater so ’n Kurbelgrammophon gehabt, was mich als Kind sehr beeindruckt hat. Ich erinnere mich, dass ich, das muss ungefähr 1942 gewesen sein, und mein Vater war damals schon wieder neu liiert mit einer Frau, die ich Tante Gercia nannte, eines Abends Gäste hatte. Ich bin nachts aufgewacht und über unseren langen Flur zur Toilette gelaufen, und da hörte ich Musik aus dem Wohnzimmer. Mein Vater und eine befreundete Familie, die zu Besuch war, hörten sich Schellackplatten an. Mir gefiel das Lied, das da gespielt wurde, ich ging also rein im Schlafanzug und rief: „Das ist schöne Musik!“ Mein Vater sagte: „Komm, komm, komm, geh mal wieder ins Bett!“ Was da lief, war „La Paloma“ mit Hans Albers. Daher stammt wohl meine Vorliebe für Albers, die mit einem kleinen Lächeln bis heute erhalten geblieben ist. (…) Als ich aber 1950 nach Berlin kam, war für mich das Größte das Tanzorchester Leipzig unter Kurt Henkels und das Ballett vom Friedrichsstadtpalast, was ich heute nicht mehr besonders mag – wobei Kurt Henkels gar nicht so schlecht war …
„’Flamingo’ von Earl Bostic, das ging so: (singt) Dä-dää-dä-dädädädä…“
Das heißt, Ihre Vorliebe für Jazz begann in der Studentenzeit …
Ja, wobei ich sogar schon ’ne Affinität zum Jazz hatte, als ich noch in der Schule in Wittenberge war. Da gab ’s ’ne Wandzeitung, die ich mitgestaltet habe, und ich habe mich erdreistet, einen Artikel über Jazz zu schreiben und da hinzuhängen. Würde ich heute für Dreck halten, was ich damals von mir gegeben habe, es war von keiner Sachkenntnis getrübt, aber immerhin … Und als ich nach Berlin kam, bin ich gleich nach West-Berlin in einen Plattenladen gegangen und habe mir, so schlecht war mein Geschmack gar nicht, „Blueberry Hill“ von Louis Armstrong gekauft und „Flamingo“ von Earl Bostic, das ging so: (singt den Anfang von „Flamingo“) Dä-dää-dä-dädädädä … Das waren recht populäre Nummern zu Beginn der 50er.
Wie kamen Sie drauf, sich als Schüler für Jazz zu interessieren?
Das war der Sound der Zeit, ich kaufte ab ’47 die Amiga-Platten, die bei Lied der Zeit rauskamen, „Ciu-ciu-ciu-cu“ und solche Sachen. Diese frühe Nachkriegs-Schlagermusik mag ich teilweise heute noch, weil sie mit Swingbands begleitet und immer noch irgendwie jazzig war. Aber ich hab als Schüler auch andere Sachen gehört: Damals in Wittenberge entdeckte ich zum Beispiel auch Ernst Busch für mich, seine Stimme fand ich großartig, sie erinnerte mich an Hans Albers, da war auch dieses norddeutsche Timbre drin. Also, ich verbrachte viel Zeit im Plattenladen. Die Platten waren ziemlich billig, aber man musste anfangs, wenn man eine neue Platte kaufte, zwei kaputte alte Platten abgeben. Das Schellack wurde gebraucht.
Wo bekam man zwei kaputte alte Platten her, wenn man noch keine Plattensammlung hatte?
Da ist mir eben mal ’ne Platte mit Wiener Walzern von meiner Mutter kaputtgegangen: „Oh, jetzt issse mir runtergefallen! Schade, Mama …“ ! Und dann konnte ich mir wieder ’ne neue Platte kaufen. Insgesamt kann man sagen: Das, was mich am meisten interessierte, war halb Schlager und halb Jazz, und das hielt an bis zu meiner Studentenzeit in Berlin. Dann schickte mir meine Großmutter aus Hamburg 1956, ich weiß nicht warum, denn sie hat sich dafür gar nicht interessiert, das „Jazzbuch“ von Joachim Ernst Berendt. Das hatte sie ganz unten in eines ihrer Päckchen reingelegt, ich fand dieses Buch unter Keksen, Zucker und sonstwas alles. In diesem Sommer fuhr ich mit dem Buch nach Thüringen zu meiner Mutter, die später dann in den Westen ging, und lag dort nachts auf dem Boden in der Küche und las unentwegt den Berendt. Ich fand alles so interessant und so logisch, was ich da las. Heute besitze ich alle neun Auflagen davon. Damals kannte ich nicht mal die Musik, von der die Rede war. Ich bin sozusagen über die Zweitdarstellung in einem Buch richtig auf den Jazz eingeschworen worden. Und als ich nach den Semesterferien wieder zurück in Berlin war, habe ich Freunde in West-Berlin besucht und mir von denen Jazzplatten ausgeliehen. Das war ein gefährliches Unterfangen, denn die konnten an der Grenze beschlagnahmt werden. Ich musste also den Freunden versprechen, in so einem Fall die Platten zu ersetzen, ist mir zum Glück nie passiert. Ich habe die Scheiben über Nacht auf Tonband überspielt und am nächsten Tag wieder zurückgebracht, und es ist immer gut gegangen. Das ging ungefähr ein Jahr lang, nachher hatte ich 30 große Tonbandspulen, zweiseitig eng bespielt, in Mono natürlich. Auf diese Weise hab ich mich selbst weitergebildet, ich kannte ja nur die Beschreibungen aus dem Buch, dann wollte ich die Musik auch hören. Ich hab mich natürlich bei der Auswahl der zu borgenden Platten erst mal im Buch vergewissert, was man hören muss, um diesen oder jenen Stil zu verstehen: Soso, aha … dann hin, Platten geholt, überspielt und wieder zurückgebracht.
Der Berendt war die Bibel …
Ja, das war die Bibel damals für mich. Meine Tonbänder habe ich irgendwann einem Westdeutschen gegeben, der diese Sammlung bewunderte. Dafür hab ich meinen ersten Stereo-Plattenspieler gekriegt. 1956 hörte ich auch, dass es in Berlin so etwas wie einen Jazz-Club gab, man traf sich in einem Jugendklubhaus in der Gartenstraße am Nordbahnhof, organisierte Vorträge und hörte gemeinsam Platten. Außerdem übte man sich in Demokratie, es wurde unentwegt irgendwas gewählt, alle viertel Jahre gab es einen neuen Vorstand: Es gab den ersten Vorsitzenden, den zweiten Vorsitzenden, und dritter Vorsitzender wurde ich. Und da hab ich mir jede Woche ’nen Vortrag angehört über Dizzy Gillespie, Charlie Parker und was da alles angeboten wurde. Irgendwann sagten die zu mir: „Du könntest ja auch mal ’nen Vortrag machen!“ Ich sage: „Vortrag? Ich kenne mich noch nicht so gut aus, ich bin zwar interessiert, aber …“ – „Na, such dir doch mal ’n Thema, was du einigermaßen überblicken kannst!“ – „Gut“, sage ich, „dann mach ich einen Vortrag über Armstrong.“ Darauf hab ich einen Fachmann in West-Berlin besucht, der mir ’n bissl was erzählt hat, und habe mir dort nach dessen Empfehlungen Platten gekauft, was ja immer teuer war: Man musste fünf- bis sechsmal so viel Ost-Geld hinlegen.
Gab es Armstrong im Osten gar nicht zu kaufen?
Zu der Zeit? Nee, gar nicht dran zu denken! Das kam erst viel später, da hab ich dann selbst Armstrong-Platten für Amiga zusammengestellt … Jedenfalls hab ich dann den Vortrag gehalten, und der kam gut an, und von da an hab ich öfter ’nen Vortrag gehalten. Irgendwann kam jemand, der sagte: „Bei uns im Betrieb gibt ’s auch allerhand Jugendliche, die sich dafür interessieren, können Sie nicht auch mal bei uns ’nen Vortrag machen? Und was kostet das eigentlich?“ Da wurde mir klar, dass ich ein Honorar dafür nehmen könnte. Das fand ich ungewöhnlich, aber nicht schlecht …
16./17. Juni 1953: „’Ne Maschinenpistole müsste man haben und reinhalten!“
Womit haben Sie denn zu diesem Zeitpunkt sonst Ihr Geld verdient?
Stimmt, wie war das eigentlich? Mein Studium war ja schon beendet und damit auch mein Stipendium … Jedenfalls hatte ich erst mal großen Ärger mit der Partei …
Sie waren als Schüler schon in die SED eingetreten. Was war damals der Grund gewesen?
Ich hab gedacht: Der Kapitalismus mit seinen Kriegen ist der falsche Weg. Ich muss irgendwo mitmachen, wo dagegen gearbeitet wird. Und da gab es ja nur die SED, die Blockparteien fand ich lächerlich. Also, mir war das anfangs schon sehr ernst mit dieser Partei. Es würde jetzt zu weit führen, von den Schwierigkeiten zu erzählen, die sich dann ergeben haben: Ich war bereits Mitglied geworden, da hat man mich strafweise wieder in den Kandidatenstand zurückversetzt und solche Scherze. Irgendwann wurde es ganz schlimm, sodass mich mein Studienkollege Fritz beiseite nahm, weil ich dauernd kritisiert wurde, und zu mir sagte: „Sag denen doch endlich, was sie hören wollen!“ Ich sage: „Ich weiß doch nicht, was die hören wollen!“ Er: „Du musst sagen, du bist bürgerlich aufgewachsen und hast keine Verbindung zur Arbeiterklasse, und deswegen ist dein Zugang zum Marxismus nur ein theoretischer und deswegen gibt es bei dir Fehleinschätzungen.“ Ich sage: „Ich sehe das nicht so.“ – „Ja, aber das wollen die hören.“ Na gut, ich bin also hingegangen und hab das denen erzählt, und damit war die Sache erst mal in Ordnung. Aber kurze Zeit später gab es neue Ansatzpunkte und neue Vorwürfe …
Vielleicht können Sie kurz skizzieren, was die Ursache für diese Vorwürfe war …
Die Ursache war, dass ich die Sache ernst nahm: den Sozialismus und den Marxismus. Na gut, dann muss ich doch eine Geschichte erzählen: Als wir 1953 Semesterferien hatten, sollten wir ’n Praktikum machen, das war so üblich. Manche wurden zum Ernteeinsatz geschickt, wir „Philosophen“, als zukünftige Partei-Elite, kamen zur Reichsbahn-Bau-Union in Mecklenburg. Unsere Aufgabe war: Wir sollten mit den Arbeitern dort diskutieren und sie sozialistisch beeinflussen. Ich hatte ja immer ’ne Neigung zum Theoretischen und hatte für die SED bereits Parteilehrjahr durchgeführt, zum Beispiel beim Schriftstellerverband, wo Christa Wolf, die damals noch unverheiratet war und anders hieß, meine Schülerin war. Jedenfalls erinnere ich mich noch, dass wir bei einem Mann vom ZK ’ne Schulung hatten für diese Agitationsaufgabe. Da saßen wir Unter den Linden in einem Hochhaus ganz oben in der Nähe der Friedrichstraße und kriegten unsere Belehrungen. Und plötzlich hörten wir von der Straße Geräusche, die wie Sprechchöre klangen. Es war der 16. Juni ’53. An diesem Tag begannen ja bereits die Demonstrationen. Wir waren beunruhigt und fragten: Was ist denn da draußen los?“ Irgendjemand meinte: „Ach, da dreh’nse wieder ’nen Thälmann-Film!“ Wir haben weitergesprochen, aber die Rufe wurden immer lauter …
Erinnern Sie sich noch an die Parolen, die gerufen wurden?
„Runter mit den Normenerhöhungen!“ und so was, allerdings auch: „Der Spitzbart muß weg!“, was konkret gegen Ulbricht gerichtet war. Und dann kriegte der, der uns schulte, einen Anruf und kam nach einer Weile etwas bleich aus dem Nebenraum zurück und sagte: „Wir unterbrechen die Schulung für anderthalb Stunden.“ Der wollte sich wahrscheinlich informieren, was nun los war. Wir sind runtergegangen auf die Straße und sahen die Demonstranten kommen mit ihren Plakaten gegen Normenerhöhungen und gegen undemokratische Tendenzen. Ich stand am Straßenrand neben dem Genossen, der mir die Empfehlung gegeben hatte, der Partei mein bürgerliches Verhältnis zum Sozialismus zu erklären. Wir guckten uns die Demonstration an und reagierten völlig unterschiedlich. Er sagte: „’Ne Maschinenpistole müsste man haben und reinhalten!“ Und ich sagte: „Irgendwas haben wir falsch gemacht. Wieso sind die Arbeiter gegen unsere Partei?“ Also, ich war erschüttert, und der war erbost und hätte am liebsten auf die Demonstranten geschossen. Und dann sind wir in ein Restaurant, das im selben Haus unten war, reingegangen, um was zu essen. Wir hatten beide natürlich ’n Parteiabzeichen am Hemd …
Weil Sie gerade diese Schulung hatten? Oder trugen Sie das immer?
Ein Parteiabzeichen hat man getragen als Student. Nun hatte er aber seins gleich abgemacht. Interessant, oder? Dann setzten wir uns hin und wollten bestellen, der Kellner kam und sagte zu mir: „Den Bonbon müssense abmachen, sonst bedien‘ ich Sie nich‘.“ So war die Stimmung. Da hab ich gesagt: „Dann verzichte ich aufs Essen“, und bin rausgegangen. Das heißt, ich stand noch zur Sache, wenn man so will, aber ich war tief erschüttert, dass Arbeiter gegen eine Arbeiterpartei demonstrierten. So sah ich ’s damals. Der Kollege, der sich angepasst hat, also sein Parteiabzeichen abgemacht und sein Essen gekriegt hat, hat später groß Karriere gemacht und es bis zum Stellvertretenden Leiter der Nachrichtenagentur ADN gebracht. Und ich hatte immer nur Schwierigkeiten, politisch gesehen.
Auf Ihre Art haben Sie auch ’ne Karriere gemacht, ’ne ganz andere …
… ne zufällige … Um mit Herrn Gaus zu sprechen: Ich fand keine andere Nische. In dieser Nische habe ich mich wohlgefühlt und weiterentwickelt. (…)
„Ich möchte bitte den Hauptbuchhalter sprechen.“
Hatten Sie damals das Gefühl, als Sie auf der Straße standen und dann in die Gaststätte reingingen, dass die Proteste das Werk von, wie es damals in der DDR hieß, „Westberliner Provokateuren“ waren, ja von „Faschisten“?
Nee, so hab ich ’s nicht gesehen. Gut, als ich dann hörte, dass am Potsdamer Platz schon Zeitungsbuden in Brand gesteckt worden sind, hab ich gedacht: „Der Westen mischt natürlich mit.“ Und hat er ja auch. Aber ich hab die Proteste schon ernst genommen und dachte: So können wir nicht weiter machen, wir müssen etwas ändern. Wir sind dann am andern Tag, also am 17. Juni, zur Reichsbahn-Bau-Union nach Mecklenburg gefahren. Im Äther hieß es, dass überall große Streiks im Gange seien, und auch die Arbeiter in Mecklenburg fingen an zu streiken. Ich habe dann mit denen diskutiert und aus meiner damaligen Haltung heraus erklärt, dass es doch unsinnig sei, gegen den eigenen Staat zu demonstrieren. Die Arbeiter sagten mir, wie ungerecht sie alles fänden, und der Betriebskollektivvertrag verspreche dies und das, und nichts davon sei verwirklicht. Ich hab mir all die Punkte schön notiert und gleichzeitig versucht, denen klarzumachen, dass Streiken nicht der richtige Weg ist. „Ja, was sollen wir denn sonst unternehmen!“, haben die gesagt. Ich hab versucht, so gut ich konnte, dagegen zu halten, also, ich hab die Parteilinie vertreten. Und auf dem Heimweg in die Baracke, wo ich Quartier bezogen hatte, wurde mir von ein paar Arbeitern aufgelauert, die mich übel zusammenschlugen. Das war nicht lustig, die traten mir ins Gesicht, ich war richtig lädiert. Hier ist noch ’ne Narbe davon als kleines Andenken an die Geschichte (W.S. zeigt mir die Stelle im Gesicht). Ich bin trotzdem am nächsten Tag zur Leitung der Reichsbahn-Bau-Union nach Wahren (Müritz) gefahren und habe gesagt: „Ich möchte bitte den Hauptbuchhalter sprechen.“ Wir hatten ja alle ein Schreiben vom Zentralkomitee der SED mit, aus dem hervorging, dass wir als Instrukteure eingesetzt waren, und dass man unseren Anweisungen Folge zu leisten habe. Das hab ich einfach benutzt und habe die Punkte aufgezählt, die mir die Arbeiter genannt hatten: dass der Betriebskollektivvertrag nicht eingehalten worden ist, und dass Nachzahlungen geleistet werden müssen. Da ist der Buchhalter bleich geworden und hat gesagt: „Das kann ich nicht verantworten!“ – „Macht nichts“, sage ich, „das verantworte ich!“
Sie haben die Beschwerden weitergegeben?
Ja, und ich hab ihm sozusagen den Befehl gegeben, dass da Auszahlungen gemacht werden.
Den Zwischenfall vom Abend vorher haben Sie offenbar nicht erwähnt. Hat man Ihnen nicht angesehen, dass Sie irgendwo gegen gelaufen sind?
Kann sein, aber ich habe da nicht weiter drüber gesprochen. Das hätte ja für mich bedeutet, meinen Parteiauftrag nicht ernst zu nehmen. Denn für die Arbeiter war ich natürlich der klugscheißende Funktionär aus der Hauptstadt, der sie vom Streiken abhalten will. Und das konnte ich bis zu einem gewissen Grad verstehen … Ich bin dann erst mal nach Wittenberge zu meiner Frau gefahren, die lebte noch dort als Pionierleiterin, und hab mich pflegen lassen, denn ich war wirklich fertig. Und dann war die Praktikumszeit auch vorbei. Als ich wieder zurück in Berlin war, wurde mir in meiner Parteigruppe an der Universität vorgeworfen: „Du hast völlig falsch gehandelt, Genosse Sellhorn! Das hättest Du nicht tun dürfen! Die Anweisung, die Du gegeben hast, hat uns viele Zehntausende gekostet.“ Da habe ich gesagt: „Das war doch gerecht!“ – „Aber das war zu unserem Schaden, deswegen hättest Du das nicht machen dürfen.“ Das sah ich nicht ein. Darauf wurde ich strafweise zurückversetzt in den Kandidatenstand der Partei.
Warum konnten Sie überhaupt so folgenschwere Anweisungen geben als 23jähriger Student?
Solche Vollmachten hatten alle, die als Instrukteure im Praktikum eingesetzt wurden. Die Partei vertraute uns, man sah in uns gestählte Marxisten und Leninisten. Und ich hab mich ja auch so verhalten. Ich hab nicht etwa sympathisiert mit den Streikenden, ich habe dagegen geredet. Und dafür wurde ich zusammengeschlagen. So, und jetzt kommt ein Erlebnis, das für mich viel wichtiger ist, als der ganze Ärger, den ich gekriegt habe: Ich wohnte damals in der Schönhauser Allee 53 im zweiten Stock, hatte ’n ganz kleines Zimmer. Nachts musste ich meine vielen Bücher vom Bett auf die Erde legen, damit ich schlafen konnte, und am Tag legte ich sie wieder aufs Bett, damit ich mich im Zimmer bewegen konnte. Also, es war ganz eng. Und eines Tages, es war Wochenende und ich schlief länger, was ich heute noch gerne tue, da klopfte es, und meine Wirtin kam und sagte: „Herr Sellhorn, da stehen drei Herren draußen vor der Tür. Die wollen Sie sprechen“ Ich habe kurz überlegt, ob die Wohnung nicht vielleicht ’nen zweiten Ausgang hat, hatte sie aber nicht. Ich gehe also zur Tür und sage: „Was gibt ’s denn?“ Und in dem Moment erkannte ich genau die Männer, die mich einige Wochen zuvor zusammengeschlagen hatten. Ich konnte ja nicht abhauen und sagte: „Kommt rein!“ Die gaben mir freundlich die Hand, was ich als gutes Zeichen interpretiert habe, und dann gingen wir in mein enges Zimmer und setzten uns alle auf mein Bett. Da packten sie ihre Aktentaschen aus und holten lauter Schnapsflaschen raus. „Du hast die Sache für uns geregelt“, sagten sie. „Wir haben alle viel Geld gekriegt, und dafür wollen wir uns bedanken. Außerdem wollen wir uns entschuldigen, dass wir Dich verdroschen haben, und darauf trinken wir jetzt!“ Ich habe gesagt „Jawoll“, und dann haben wir uns wie verrückt besoffen.
Unglaublich (lacht) …
Das war für mich ’ne schöne Sache. Aber die Partei, also die Genossen um mich herum, fanden das weniger schön. Ich habe das denen erzählt, und dann hieß es: „Was? Du machst mit denen noch gemeinsame Sache, nachdem die Dich zusammengeschlagen haben?“ Ich war sowieso ’n bissl naiv in solchen Dingen. Ich hab denen auch erzählt, als gesagt wurde, man müsse jetzt mal über seine Vergangenheit sprechen, dass ich mich ’45 in Berlin als Zigarettenschieber durchgeschlagen habe. Da habe ich Entsetzen geerntet: „Aber so was sagt man doch nicht!“ (…)
„Ich möchte den Antrag stellen, dass der Genosse Sellhorn aus der Partei ausgeschlossen wird.“
1957 sind Sie aus der SED ausgetreten …
Austreten konnte man nicht. Laut Statut der Partei konnte die Mitgliedschaft nur beendet werden durch Tod oder Ausschluss. Einen Austritt gab es nicht.
Es gab noch die Streichung, und zumindest theoretisch gab es auch den Austritt.
Theoretisch ja, aber nicht praktisch. Also habe ich mich, nachdem ich mal wieder durch die Mangel gedreht worden bin, 1957 in einer Parteiversammlung zu Wort gemeldet. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da schon wieder Mitglied war oder immer noch Kandidat … Wir hatten damals immer unser Parteibuch in so ’nem Lederbrustbeutel um den Hals hängen, ich hab das Buch rausgezogen und gesagt: „Ich möchte einen Antrag stellen.“ – „Ja, Genosse Sellhorn, bitte, was für ’n Antrag möchtest Du stellen?“ Ich sage: „Ich möchte den Antrag stellen, dass der Genosse Sellhorn aus der Partei ausgeschlossen wird. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Heben des Dokuments!“ Und dann hab ich meins hochgehalten. Das hat ’ne suggestive Wirkung gehabt: Die haben alle den Lappen hochgehalten. Dann hab ich das Parteibuch auf ’n Tisch geschmissen, hab gesagt „Tschü-hüss!“ und bin rausgerannt. Anschließend wurde ich zur Kreisleitung Berlin-Mitte bestellt, in das Gebäude in der Friedrichstraße, in dem nach der Wende das Haus der Demokratie war. Da hieß es dann: „Genosse Sellhorn, setz Dich mal hin hier. Du hast Dich ja quasi selbst ausgeschlossen. Also, das geht nicht, das machen wir jetzt mal schön rückgängig.“ Da hab ich gesagt: „Nein, gesagt ist gesagt. Ich bin nicht mehr in der Partei.“ – „Ja, das geht doch nicht!“ – „Das geht“, sag ich, „sieht man doch an mir, dass das geht!“ Da haben die resigniert und gesagt: „Gut, dann nicht.“ Dann war ich weg. (…)
Sie wollten noch erzählen, womit Sie Ihr Geld nach dem Studium verdient haben. Von den Vorträgen über Jazz konnten Sie ja nicht leben …
Nach dem Studium hätte ich am liebsten im Aufbau-Verlag gearbeitet, weil dort der Cheflektor für philosophische Literatur, was ja mich betroffen hätte, Wolfgang Harich war, einer meiner ehemaligen Dozenten. Harich ist Ihnen ein Begriff, oder? Später war ich übrigens, nachdem meine erste Frau an einer Blinddarmoperation gestorben war, mit seiner Stieftochter verheiratet, und wieder etwas später habe ich mit seiner richtigen Tochter Katharina Harich zusammengelebt. Deswegen hat mich Wolfgang Harich bis an sein Lebensende, wenn wir uns begegneten, immer umarmt, mir ’nen Kuss auf die Wange gegeben und hat mich Leuten als seinen Schwiegersohn vorgestellt, der ich ja im engeren Sinne nicht war.
„Sellhorn? Ist denn der immer noch nicht nach dem Westen abgehauen?“
Durften Sie denn beim Aufbau-Verlag anfangen?
Nein, ich wurde überall abgelehnt. Ich hab dann mein Heil an der Volkshochschule gesucht. Dort war man nicht so streng, und so konnte ich als Dozent arbeiten. Ich hab mich immer wieder hier und da beworben, zum Beispiel beim Johannes-R.-Becher-Archiv, und anfangs war man auch immer sehr interessiert an meiner Mitarbeit. Aber dann wurde an der Uni und bei der Partei nachgefragt, und anschließend erklärte man mir, dass der Job bereits vergeben sei. Eine Kaderleiterin hat mir damals gesteckt, dass sie von der Universität die Auskunft bekommen hatte: „Der Sellhorn? Ist denn der immer noch nicht nach dem Westen abgehauen? Auf keinen Fall einstellen!“ Also, ich galt als „politisch unzuverlässig“, und man wollte, dass ich nach dem Westen gehe. Mir wurde dann von der Kaderleiterin, die mich gut leiden konnte, nahegelegt, weil meine Aufenthaltsgenehmigung für Berlin abgelaufen war, mich entweder als Kulturleiter bei einer MTS (= Maschinen-Traktoren-Station; JV) auf dem Land zu bewerben, „da nimmt man Sie mit Kusshand!“, oder als ungelernter Arbeiter in die Produktion zu gehen. Also bin ich in die Produktion gegangen, weil ich in Berlin bleiben wollte, und hab beim Stern-Radio in Weißensee am Fließband gearbeitet. Immer wenn ein Radioapparat an mir vorbeikam, musste ich das magische Auge anlöten und irgendeine Funktion am Gerät prüfen. Dieses Arbeitsverhältnis scheiterte aber daran, dass ich immer verschlief. Ich habe nie eine richtige Beziehung zum Frühaufstehen gefunden in meinem Leben. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich als Kind in Hamburg, als ich während des Krieges bei meinem Vater lebte, manchmal viermal in der Nacht geweckt wurde und in den Luftschutzkeller musste. Ich hasste es, aufzustehen, wenn ich noch nicht ausgeschlafen war. Das misslang mir später immer wieder. Sonst war ich bei den Kollegen eigentlich ganz beliebt. Aber die haben sich natürlich auch geärgert, dass ich immer erst um zehn kam, statt um sieben. Außerdem bekam ich den Spitznamen „Professor“, weil ich mich in den Pausen, wenn die anderen sich zum Essen zusammengesetzt haben, in irgendeine Ecke verzogen und Bücher gelesen habe. „Ach, der Professor liest wieder“, hieß es. Ich hatte dann mehrere Aussprachen wegen dieser Zuspätkommerei, aber es half alles nichts. Ich hab versucht, mich von ’nem Freund wecken zu lassen, auch das klappte nicht, und schließlich mussten wir ’nen Aufhebungsvertrag machen. (…)
Diese Maßnahme, sich „in der Produktion zu bewähren“, war ja eine Strafmaßnahme. Warum hatten Sie Ihr Studium nicht regulär abgeschlossen?
Das Staatsexamen an der Universität ist mir letztlich nicht anerkannt worden, weil ich die Auflagen nicht erfüllt hatte. Ich hatte die schriftliche Arbeit zu spät abgegeben. In den Prüfungen hatte ich lauter Einsen und Zweien, aber meine Arbeit über die Beziehung zwischen Karl Marx und dem Anarchisten Pierre Joseph Proudhon zog sich etwas hin, weil die Sekundärliteratur auf Französisch war, und ich kein Französisch konnte. Dabei hatte mein alter Klassenlehrer aus Wittenberge, bei dem ich Abitur gemacht hatte, und der inzwischen Professor in Leipzig war, mir extra das wichtigste Buch handschriftlich ins Deutsche übersetzt, er war ’n richtig dufter Kumpel. (…) Jedenfalls habe ich die Arbeit zwei Tage zu spät abgeliefert. Und dann bestellte mich Wolfgang Heise zu sich in sein Zimmer und erklärte mir, dass ich all die Prüfungen im nächsten Jahr noch einmal machen müsste. Zuvor solle ich mich aber ein Jahr lang „in der Produktion bewähren“, wie das damals hieß. Ich kam dann ins KWO (= Kabelwerk Oberspree) in Oberschöneweide, das war schwere körperliche Arbeit. Ich hab da sogar ’ne sozialistische Brigade gegründet und sie „Bertolt Brecht“ genannt. Wir haben Feten zusammen gefeiert und sind gemeinsam ins BE gegangen, was einigen auch Spaß gemacht hat. Aber die meisten haben ihre Eintrittskarten wohl an irgendwelche Spinner im Bekanntenkreis verschenkt. Nach einem Jahr kriegte ich eine sehr gute Beurteilung und das Angebot, im KWO zu bleiben – nicht als Arbeiter, sondern in der Verwaltung. Das wollte ich aber nicht. Ich bin wieder zur Universität gegangen, und dort sagte man mir: „ Wir haben uns die Sache überlegt, zwei Jahre wären besser. Also: noch ein Jahr Produktion!“ Da hab ich gesagt: „Das mach ich nicht!“ Wir haben uns dann auf einen Kompromiss geeinigt: Zwar bekam ich keinen Abschluss und keine Unterstützung von der Universität, aber sie hörten damit auf, allen Chefs davon abzuraten, mich einzustellen. (…) Ich hab mich nie wieder drum gekümmert, die Prüfungen nachzumachen. Ich weiß, dass ich studiert hab – warum soll ich dafür ’nen Stempel haben? Ich bin auch nie wieder in meinem Leben danach gefragt worden.
„Man sagte mir: ‚Wir werden es nicht dulden, dass Sie sich öffentlich für den Jazz einsetzen!’“
Wann haben Sie beschlossen, Ihr Hobby, also die Beschäftigung mit Musik, zum Beruf zu machen?
Das kam erst ganz langsam. Ich würde sagen, das hat sich bei mir Mitte der 60er Jahre herausgestellt, dass ich mit der Musik, dem Veranstalten und Ansagen, meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Erst hab ich beim Eulenspiegel-Verlag als Buchlektor gearbeitet, was mir Spaß machte, wobei ich auch dort Probleme mit dem Frühaufstehen hatte. Und irgendwann hab ich dann öffentliche Jazz-Veranstaltungen organisiert und angesagt, heute würde man sagen: moderiert. Den Leuten gefiel die Mischung, die geboten wurde: Die Karten für ein Konzert im Kabarett in der Friedrichstraße, wo jetzt die „Distel“ drin ist, wurden alle mit Hilfe einer kleinen Zeitungsannonce verkauft, und zwar direkt in meiner Wohnung in der Christburger Straße im dritten Stock, da standen die Anwärter Schlange bis auf den Hof runter. Dann erfuhr ich eines Tages, dass bei einer Konferenz der Berliner FDJ erzählt wurde, dass ein gewisser Werner Sellhorn eine Widerstandsgruppe gegen die DDR leite, die sich mit dem Decknamen „Jazz“ tarne und vom Amerikahaus in West-Berlin finanziert werde. Das stimmte zwar alles nicht, aber solche Gerüchte machten mir das Veranstalten von Konzerten nicht gerade leichter. (…) Ich war damals schon mit Harichs Stieftochter verheiratet und hab mich dann an ihre Großmutter gewandt, die ’ne menschlich dufte Frau war und ’ne stramme Genossin, die in der Weimarer Zeit für Georgi Dimitroff gearbeitet hatte. Und die versprach, sich darum zu kümmern, dass diese Gerüchte verstummten. Sie stellte den Kontakt zu Alexander Abusch her, der damals Minister ohne Geschäftsbereich war, das muss 1962 gewesen sein. Ich wurde daraufhin zu einer Sitzung im Kulturministerium geladen; außer mir nahmen noch der Chef der Abteilung Tanzmusik, wozu auch der Jazz zählte, teil, ein gewisser Dr. Uszkoreit, dessen Adjutant und der persönliche Referent des Ministers Alexander Abusch, ein gewisser Kurt Reppe. Bei dieser Aussprache hat Dr. Uszkoreit das große Wort geführt und mich gefragt: „Wir wissen ja, Herr Sellhorn, dass Sie viele Jazzplatten haben – wo haben Sie die eigentlich alle her?“ Ich konnte ja schlecht sagen, dass ich die in West-Berlin gekauft hatte, also sagte ich: „Die haben mir Freunde aus West-Berlin geschickt!“ Darauf Dr. Uszkoreit: „Na, die werden doch immer beschlagnahmt!“ Ich: „Bei mir sind die nicht beschlagnahmt worden, die sind durchgekommen.“ War natürlich gelogen. Da sagt er: „Wissen Sie, wo diese Platten normalerweise hinkommen?“ – „Nee“, sage ich. „Na, dann kommen Sie mal mit!“ Dann sind wir alle in den Nebenraum gegangen, und er hat mir große Schränke voller beschlagnahmter Platten gezeigt. Ich bin ganz nervös geworden, als ich all die Schätze gesehen habe: „Oh, dieses kanadische Konzert mit Gillespie und Parker, das suche ich ja schon lange.“ Da sagt er: „Dann legen wir das doch mal auf.“ Also haben wir die Platte aufgelegt und angehört, es war wunderbar. Aber irgendwann gingen wir wieder zurück in den anderen Raum, und dann sagte Dr. Uszkoreit: „Wissen Sie, Herr Sellhorn, wir werden es nicht dulden, dass Sie sich öffentlich für den Jazz einsetzen! Wissen Sie, was ein Schlagzeug ist?“ Ich sage: „Klar weiß ich, was ’n Schlagzeug ist!“ – „Nicht das, was Sie meinen! Ich spreche nicht von dem Musikinstrument, sondern von den Arbeiterfäusten. Und dieses natürliche Schlagzeug wird gegen Sie eingesetzt werden!“
Das war ja schon mal gegen Sie eingesetzt worden …
Ja, aber damals war das nicht organisiert gewesen. Dieser Dr. Uszkoreit drohte mir nun damit, mich zusammenschlagen zu lassen, wenn ich mich weiter für den Jazz einsetzen würde : „Die Arbeiter sind zwar sehr geduldig, aber wir können das ja auch organisieren!“ Das hat er zu mir gesagt. Ich habe geantwortet: „Herr Dr. Uszkoreit, das ist in meinen Ohren Faschismus, was Sie da gesagt haben.“ Er darauf lächelnd: “Wie Sie das nennen, Herr Sellhorn, ist mir völlig egal.“ Der war eiskalt. Und der Dr. Rebbe, der persönliche Sekretär von Abusch, saß immer nur beobachtend dabei. Später hat er aber noch eine Rolle gespielt. Der Dr. Uszkoreit sagte: „Überlegen Sie sich ’s! Wollen Sie das Schlagzeug in Funktion treten lassen, oder wollen Sie aufhören mit Ihren Aktivitäten?“ Ich hab gesagt: „Aber ich versuche doch, den Jazz marxistisch zu interpretieren, ich hab Ihnen doch Ausarbeitungen dazu übersandt!“ – „Das ist es ja gerade! Das wollen wir nicht, Sie machen den Jazz unangreifbar, und das ist nicht in unserem Interesse!“ Das war die Situation, in der ich mich befand.
Der Jazz sollte nach wie vor als „Musik vom Klassenfeind“ gelten?
Ja, und in gewisser Weise war er das ja auch. Es gab Veröffentlichungen aus dem Westen dazu. Der Jazz wurde in diesen Schriften zum besten Argument für die Jugend gegen die DDR erklärt.
Es gab allerdings auch im Westen viele Vorbehalte gegenüber dieser Musik, die von der älteren Generation als „Hottentottenmusik“ verunglimpft wurde …
Ja, aber das kam aus ’ner anderen Ecke.
Das war Borniertheit, Engstirnigkeit und Antiamerikanismus. Das hatte nicht unbedingt immer etwas mit links und rechts zu tun.
So ist es. Aber es gab eben offizielle amerikanische Propagandaschriften, die den Einsatz des Jazz zum besten Mittel erklärten, um das System im Osten aufzuweichen. Jedenfalls endete diese Aussprache, die vielleicht vier Stunden gedauert hatte, damit, dass ich sagte: „Ich beuge mich der Gewalt, nicht der Vernunft.“ – „Okay“, sagte der Dr. Uszkoreit. Also, ich weiß nicht, ob er „okay“ gesagt hat, vermutlich hat er „in Ordnung“ gesagt. So ging man auseinander. Später kam der Dr. Rebbe auf mich zu, gab mir seine Visitenkarte und sagte: „Wenn Sie sich irgendwo bewerben, zeigen Sie meine Karte vor und sagen denen, sie sollen mich anrufen.“ Das hab ich dann auch gemacht. Denn beim Eulenspiegel-Verlag stand ich damals kurz vor dem Rausschmiss, und kurz darauf haben wir ’nen Aufhebungsvertrag gemacht. (…)
Bei Amiga: „Bezahlen können wir Sie nicht, aber Sie machen das doch der Sache wegen!“
Merkwürdigerweise hatte auch Ernst Busch mit Hans-Georg Uszkoreit zu tun, allerdings zehn Jahre früher als Sie – das geht aus den Archivdokumenten über Busch und seine Auseinandersetzungen mit der Kunstkommission hervor. Das war Anfang der 50er Jahre, als es um die Verstaatlichung seines Musikverlags Lied der Zeit ging, damals war Uszkoreit Leiter der Abteilung Musik bei der Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten …
Das wusste ich damals natürlich alles nicht, aber heute fügt sich das für mich ganz logisch zusammen. Im Unterschied zu den Auseinandersetzungen mit Busch gibt es nur leider über meine Aussprache keine schriftlichen Unterlagen. Ich kann das also nicht beweisen, muss deswegen vorsichtig sein, um mir keine Prozesse an den Hals zu laden. Und Herr Reppe, der das Ganze bezeugen könnte, lebt nicht mehr. Übrigens ist mir Uszkoreit später wieder begegnet, und seine Haltung mir gegenüber hatte sich kein bisschen geändert. Ich fing dann bei Volk und Welt an und bekam einen Job als Lektor, nachdem man bei Herrn Reppe angerufen hatte, der ein gutes Wort für mich einlegte. Nach der Zusammenlegung mit dem Verlag Kultur und Fortschritt, das war der Verlag der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, wurde alles ’n bissl umorganisiert, und ich wechselte auf den Posten des Werbeleiters. Und bald wurde der Wunsch laut, irgendwelche Veranstaltungen zu machen, um für die Bücher des Verlags zu werben, und man fragte mich, ob ich ’ne Idee hätte. „Klar“, sage ich, „ich hab ’ne Idee!“ Ich dachte mir: Da kann ich doch Hobby und Beruf zusammenführen. So entstand 1964 die Veranstaltung „Jazz & Lyrik“. Weil das vom Verlag getragen war, konnte man mir die Beschäftigung mit dem Jazz auch nicht ankreiden.
Wie kam es dann zur erneuten Begegnung mit Dr. Uszkoreit?
Ich hab mich ganz gut verstanden mit dem damaligen Chef von Amiga, Wolfgang Kähne. Der besuchte mich zu Beginn der 60er und sagte: „Wir wollen gerne ’ne Jazzplatte rausbringen, aber wir verstehen nicht viel davon. Können Sie die nicht zusammenstellen?“ Ich sage: „Ja, kann ich“, und habe ’ne LP mit Aufnahmen von Ost-Interpreten zusammengestellt, die schon einzeln erschienen waren. Dann hab ich gefragt, wie es mit dem Text für die Rückseite aussieht, worauf mir Wolfgang Kähne sagte: „Das geht leider nicht, Sie wissen ja, dass Dr. Uszkoreit im Kulturministerium damit nicht einverstanden sein wird, wenn Sie das schreiben. Bezahlen können wir Sie übrigens auch nicht, aber Sie machen das doch der Sache wegen!“ – „Ja“, sage ich, „ich mache es der Sache wegen.“ Dann schrieb den Text für die Rückseite dieser ersten offiziellen Jazz-LP der DDR, die auch einfach nur „Jazz“ hieß, ein gewisser Jürgen Elsner. Er ist heute Vorsitzender des Freundeskreises Ernst Busch e.V. – über Kähne, den Amiga-Chef, hat Manfred Krug übrigens mal gesagt: „Kähne ist bloß sein Vorname, mit Nachnahmen heißt er Ahnung.“ (…) Dann kriegte ich ’nen neuen Auftrag: Ich sollte drei Platten mit amerikanischen Aufnahmen zusammenstellen, da hab ich mir viel Gedanken gemacht und habe mich dann entschieden für Louis Armstrong und verschiedene Oldtime-Jazz-Titel, für Duke Ellington und Django Reinhardt und Modern Jazz-Aufnahmen. (…) Ich kriegte in der Zeit riesige Kataloge von Westfirmen auf den Tisch und durfte daraus auswählen, und das wurde dann eingekauft. Das war traumhaft! Diese drei Platten sind dann auch erschienen, und da durfte ich auf einmal auch die Texte dazu schreiben. Als mir das der Kähne steckte, sagte ich: „Was sagt denn mein Intimfeind Uszkoreit dazu?“ – „Ja, wissen Sie das noch nicht? Der ist doch gestürzt, weil irgendwas gegen ihn vorlag.“ – „Ach“, sage ich, „der ist jetzt also richtig runtergekommen?“ – „Nein“, sagt der Kähne, „natürlich nicht, er ist sehr elegant gestürzt, er ist jetzt Rektor der Musikhochschule in Dresden.“ Dort ist er, aber das habe ich nur gerüchteweise gehört, auch wieder gestürzt. (…) Das Schlimme war, dass er anschließend eine leitende Position beim VEB Deutsche Schallplatten bekam …
…wo Sie ihn wieder getroffen haben …
So ist es. Als ich mal, das muss in der zweiten Hälfte der 60er Jahre gewesen sein, zu Amiga ging, weil ich Texte abgeben wollte, begegnete ich auf dem Flur Herrn Uszkoreit. Er blieb neben mir stehen, sagte nicht Guten Tag, sondern sagte nur: „Ihre Anwesenheit hier ist jetzt für lange Zeit gewesen!“ Da wusste ich: Es geht nicht mehr. Und ich kriegte auch keine Aufträge mehr. Aber ein, zwei Jahre später, wir sind immer noch in den 60ern, kriegte ich ’nen Anruf vom neuen Amiga-Chef, H.P. Hoffmann, der mich fragte, ob ich für drei Platten die Liner Notes schreiben könnte. Da sage ich: „Und was sagt mein Intimfeind Uszkoreit dazu?“ – „Wissen Sie das denn noch nicht?“, sagt er, „na, kommen Sie mal her.“ Also bin ich hingegangen, habe den Auftrag gekriegt und erfahren, dass Dr. Uszkoreit auf Dienstreise in München gewesen und dort geblieben ist. (…) So konnte ich da wieder als Texter einsteigen, was wichtig für mich war. Denn nach meinem Rausschmiss bei Volk und Welt 1965, diese Geschichte ist ja bekannt (Manfred Krug beschreibt die Solidaritäts-Aktion für Biermann im Vorwort zu Sellhorns DDR-Jazz-Diskografie; JV), habe ich mich recht und schlecht freiberuflich durchgeschlagen. Ich bin mit Bands gereist, habe Ansagen gemacht, habe zum Teil auch Management gemacht und hin und wieder Bücher herausgegeben. In den 70er Jahren habe ich immer mehr Schallplattenvorträge in den Vordergrund gestellt. Die letzten anderthalb Jahrzehnte der DDR-Zeit habe ich hauptsächlich von diesen Vorträgen gelebt, und ich habe gut davon gelebt: Manchmal hatte ich 30 Veranstaltungen in einem Monat, also auch mehrere an einem Tag. Es ging nicht nur um Jazz, auch ausgewählte Rock-Themen waren dabei: Bob Dylan, das Woodstock-Festival und solche Sachen. (…)
„Für mich war Busch die proletarische Ausgabe von Hans Albers.“
Lassen Sie uns über Ernst Busch sprechen: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie Busch schon als Schüler in Wittenberge für sich entdeckt haben. Er hat Sie an Hans Albers erinnert …
Ja, das war mein erster Eindruck, das war noch vor 1950. Ich war Oberschüler in Wittenberge und kaufte mir meine ersten Ernst-Busch-Platten, weil ich diese Lieder interessant fand. „Der singt ja so ähnlich wie Hans Albers!“, hab ich mir gesagt. Aber dann fand ich die Texte auch ganz toll. Die entsprachen ja meiner Weltanschauung: Ich war gerade in die Partei eingetreten, also Kandidat der SED geworden. Und was Busch sang, entsprach genau dieser politischen Motivation. Busch verkörperte den richtig verstandenen Sozialismus! Das war nicht dieser kastrierte Sozialismus, den die hier verbrochen haben.
Wissen Sie noch, wie Sie drauf gekommen sind? Man kauft sich doch nicht einfach ’ne Ernst-Busch-Platte, wenn man nicht weiß, wer das ist. Hatten Sie den bei Freunden gehört, oder hatten Sie den Namen irgendwo gelesen?
Ich bin in den Schallplattenladen in Wittenberge gegangen und hab gefragt: „Was gibt es an neuen Platten?“ Dann hat man mir die gezeigt, und ich hab gesagt: „Busch? Was ist denn das? Kann man das mal auflegen?“ Ich hab mir die Platte angehört und war begeistert: „Das ist gut! Busch kauf ich jetzt immer!“
Wissen Sie noch, was die ersten Lieder waren, die Sie gekauft haben?
Ich glaube, es waren Spanienlieder.
Was hat Ihnen daran gefallen? Das Hans-Albers-hafte?
Ja, dadurch hatte ich als geborener Hamburger ’nen besseren Zugang, das Norddeutsche war mir vertraut. Aber ich mochte auch das Verständliche des Textes, was übrigens auch Hans Albers in gewissem Sinne hat – er ist ja ’n singender Schauspieler und kein Sänger. Bei Busch ist der Text immer genau zu verstehen, anders als bei einem Opernsänger, wo du dasitzt und denkst: „Der singt wunderbar, aber ich versteh‘ kein Wort.“ Das ist bei Busch völlig anders. Für mich war er die proletarische Ausgabe von Hans Albers.
Ist Hans Albers nicht seine eigene proletarische Ausgabe gewesen?
In gewissem Sinne schon, aber bei Busch gab es ja noch eine zusätzliche proletarisch-revolutionäre Komponente, die Albers natürlich nicht hatte.
„Ernst Busch stand damals auf der Schwarzen Liste.“
Wie ging das weiter? Haben Sie den Busch mühelos unter einen Hut gekriegt mit Ihrer Jazz-Leidenschaft?
Ja. Ich kann mich sogar entsinnen, dass irgendwann mal jemand zu mir sagte, er hätte da ’ne Platte von Ernst Busch, die interessiere ihn gar nicht so sehr, und ob ich die nicht haben wollte. Da hab ich sofort Ja gesagt und hab eine meiner Jazzplatten gegen ’ne Platte von Ernst Busch eingetauscht. Also, der war mindestens gleichwertig und auf einer Ebene für mich! Später hab ich ’ne Reihe von Sendungen für die Jugendredaktion des Berliner Rundfunks gemacht, wo auch eine über Busch dabei war. Frech wie ich war hab ich, der ich ja kein Musikwissenschaftler bin, Sendungen über Mozart, Beethoven und alle möglichen Größen zusammengestellt. Und irgendwann hab ich denen vorgeschlagen, ’ne Ernst-Busch-Sendung zu machen. Da sagte der Redakteur: „Ja, machense mal!“ Dann hab ich ’ne Ernst-Busch-Sendung gemacht, die auch gelaufen ist, worauf der zuständige Redakteur rausgeschmissen wurde. Und ich durfte nie wieder für den Berliner Rundfunk Sendungen machen. Denn Busch stand damals auf der Schwarzen Liste, das muss ’58, ’59 gewesen sein. (…)
Noch mal zu Ihren musikalischen Vorlieben als Schüler: Was haben Sie im Plattenladen in Wittenberge sonst noch für sich entdeckt? West-Platten gab ’s ja nicht …
Nee, die gab ’s nicht. Aber es gab Schlager aller Art. Und natürlich das Alexandrow-Ensemble mit „Kalinka“, das war ungeheuer beliebt in der frühen DDR, hab ich mir natürlich auch gekauft. Schön war auch, wenn der Tenor Nikitin sang: „In einem kühlen Grunde stand meiner Cheimat Chaus“ (lacht). Diese Version von „Im schönsten Wiesengrunde“ war ein Hit damals. Also, man hat sich so ziemlich alles, was neu war, vorspielen lassen. Natürlich war es auch eine Frage des Geldbeutels, aber ich muss sagen: Ich hab mir sehr viele Platten damals gekauft.
Dass da einer über einen Ihnen unbekannten Krieg in Spanien sang, dass da Städtenamen vorkamen, die Sie noch nie gehört hatten, das alles hatte wahrscheinlich einen zusätzlichen Reiz beim Hören von Busch-Platten …
Das war so! Aber Busch sang ja nicht nur Spanienlieder. Ich hab das immer weiter verfolgt, was er machte, und hab als Student in Berlin auch manchmal für Freunde ’nen Ernst-Busch-Abend bei mir zu Hause gemacht. Da hab ich dann gesagt: „Wenn Ihr denkt, der singt nur Kampflieder, dann hört Euch mal das hier an …“ Und dann hab ich Beethoven aufgelegt oder ein Lied aus dem Theater. Da waren die alle ganz erstaunt und sagten: „Das is ja ’n Ding! Wir kennen den nur von seinen politischen Liedern.“
War Ihnen eigentlich bewusst, dass Busch der Chef der Schallplattenfirma war, deren Schellacks Sie damals kauften?
Nee, das hab ich erst später geschnallt. Er war ja auch nicht als Chef der Firma ausgewiesen auf den Platten. In meiner Wittenberger Zeit fiel mir höchstens auf, dass der da ’ne große Rolle spielen musste, weil ja viele Titel von ihm zu kaufen waren.
Hat Sie Busch auch als Schauspieler interessiert?
Es gibt keine Aufführung mit ihm im Berliner Ensemble und im Deutschen Theater, die ich nicht gesehen habe. Ich hab ja erzählt, dass ich mit der Stieftochter von Wolfgang Harich verheiratet war. Ihre Mutter war die Isot Kilian, die ’ne führende Stellung im Berliner Ensemble hatte, übrigens auch die letzte Geliebte von Bertolt Brecht war. Und da hab ich für jede Aufführung Freikarten gekriegt und hab alles gesehen, wo Ernst Busch mitspielte. Ins Deutsche Theater bin ich auch gegangen, dort musste ich mir allerdings die Karten selber kaufen. Kennengelernt hab ich Busch aber zuerst durch die Platten, verehrte also erst den Sänger, dann den Schauspieler. Leider hatte ich nie die Gelegenheit, mit ihm persönlich zu sprechen, ich bin ihm nie nahe gekommen. Vielleicht ist das ganz gut, denn er war ja kein bequemer Mensch.
„Das ist ’ne ganz eigene Liga, in der Ernst Busch singt.“
Hatte er ’ne Stimme, von der Sie sagen würden, sie hätte auch getaugt für andere Arten von Musik – vielleicht sogar für was Jazziges?
Nee, das ist ’ne ganz eigene Liga, in der er singt. Es gab noch andere, die auch so was versucht haben, die aber alle nicht so gut waren wie er. In der DDR hat man zum Beispiel einen Sänger gefördert, der so ’n bisschen in Busch-Manier röhrte, aber längst nicht so gut war: Hermann Hähnel. Der hat sich auch nicht durchgesetzt, das war in der Zeit, als Busch keine große Lust mehr hatte, in der DDR als Sänger aufzutreten und sich mehr der Sowjetunion zuwandte. Busch war nicht zu kopieren. Er war in Deutschland genauso einzigartig, wie in den USA ein Pete Seeger.
Wie würden Sie das Besondere beschreiben an seiner Stimme und seiner Art zu singen?
Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, weil ’s mir einfach gefallen hat: sowohl vom Inhalt, als auch von der Art der Gestaltung her … Besonders gefallen hat mir bei Ernst Busch immer, wenn er ironisch wurde. Mit dieser metallischen Stimme trotzdem noch so ’ne Ironie rauszuholen, dass sich die Nase kräuselt – das ist herrlich!
Haben Sie ein Lieblingslied von Ernst Busch?
Nee, das sind zu viele. „Erinnerung an die Marie A.“ ist auf jeden Fall unter den Top Five.
Sie haben gesagt, dass Sie als Student in Berlin manchmal Ernst-Busch-Abende für Freunde gemacht haben. Wie war das in Wittenberge um 1950? Hörte man in Ihrem Freundeskreis Buschplatten, oder waren Sie mit ihrer Entdeckung allein auf weiter Flur?
Ich weiß es nicht … So richtig beliebt war er nicht. Ich glaube, meinem Freundeskreis konnte ich so was nicht vorspielen. Das hab ich für mich allein gehört. In Berlin war das ’n bisschen anders, aber auch hier hieß es immer zuerst, wenn ich sagte „Soll ich mal was von Ernst Busch auflegen?“, „Och, nee, lass mal …“ Weil die alle nur ein- und dieselben Lieder kannten, die überall gespielt wurden, wenn Ernst Busch gespielt wurde, „Vorwärts, und nicht vergessen!“ und so. Aber wenn man dann sagte: „Nee, nee, ich hab hier was ganz anderes“, dann konnte man die Leute auch dafür begeistern. (…)
Was war das für ein Publikum, das Busch gehört hat, zu Beginn der 50er Jahre? War man in der SED als Busch-Hörer? Oder hatte das damit nichts zu tun?
Das hatte zwar miteinander zu tun, war aber keine zwingende Kombination. Linientreue SED-Leute hätten ebensogut hören können: „Bau auf, bau auf, Freie Deutsche Jugend, bau auf!“ Das hat Busch ja nicht gesungen. Aber diese Leute, ich gehörte ja auch zuerst dazu, mochten den Busch. Die waren dann natürlich ganz erstaunt, wenn man ihnen sagte: „Moment! Zwischen Busch und der DDR gibt es ganz schöne Auseinandersetzungen!“ Busch wurde in dieser Zeit auch von kritischen Leuten, von zurückhaltenden Intellektuellen, geschätzt. Das war das Besondere.
Der Kern der Busch-Fans um 1950 bestand aus …
… progressiven Intellektuellen, würde ich sagen. Da waren auch Leute darunter, die Busch noch kannten von den Demonstrationen der Weimarer Zeit. Da war ja Busch abgespielt und gesungen worden. Damals war Busch ein echter Star gewesen. Das war er dann in der Zeit um 1950 auch für mich, aber für die Allgemeinheit war er das nicht mehr. Leute, die viel ins Theater gingen und so, die waren fasziniert von ihm. Aber die Arbeiter hat Busch im großen Stil nicht mehr begeistern können. Die haben lieber „Tschiu, tschiu, tschiu, tschiu, tscho / Käse gibt es im HO“ gesungen. Das war ’ne Verballhornung eines amerikanischen Schlagers. Solche Sachen waren sehr beliebt. Wir haben damals auch gesungen „Stell dir vor, wir hätten nichts zu rauchen / Stell dir vor, wie schlimm das wär’“, das war eigentlich „Sentimental Journey“. Diese Swing-Stücke setzten sich sozusagen auf dem Umweg der Parodie durch, Sie kennen ja wahrscheinlich den „Kötzschenbroda-Expreß“ von Peter Rebhuhn und Bully Buhlan, das war im Original der „Chattanooga Choo Choo“ von Glenn Miller. (…)
„Dahinten stehen die ganzen Aurora-Platten. Ich war Ernst-Busch-mad!“
Haben Sie sich auch noch in den 60er Jahren für Busch interessiert, als er wieder anfing, Schallplatten zu machen?
Ich hab alles von Busch gekauft. Es gibt keine Platte, die ich nicht habe. Dahinten (zeigt in eine Ecke des Zimmers) stehen die ganzen kleinen Aurora-Platten. Ich war Ernst-Busch-mad!
Auch wenn er so gar nicht swingt …
Nein, nein, das hat mit Jazz nichts zu tun, das ist schon klar. Das ist nicht vergleichbar, auch wenn zum Beispiel Louis Armstrong und Ernst Busch beide den „Mackie Messer“ gesungen haben, jeder auf seine ganz eigene Weise. Man kann Armstrong und Busch zur gleichen Zeit lieben, das ist bei mir so, und das war in den 50er Jahren bei einer ganzen Reihe von Leuten so. Aber ich mag zum Beispiel auch Georg Kreisler sehr gerne, von dem hab ich an die 30 CDs. Ich bin nicht so auf Jazz festgelegt, wie Sie vielleicht denken.
Bei Ihnen kommt noch das Interesse an Sprache und Musik dazu, was man ja an Ihren „Lyrik–Jazz –Prosa“-Veranstaltungen sieht … Hatten Sie, was die Texte bei Busch betrifft, irgendwann in den 60er Jahren das Gefühl, dass da etwas fehlt, dass dem Busch die Texter ausgegangen waren?
Da ist schon was dran. Er hat ja selbst immer an den Texten gefummelt, nicht unbedingt immer genial, aber er hat sie singbar für sich gemacht. Später gab es auch schwächere Texte, aber seine großen Autoren waren eben einfach nicht mehr da. (…) Busch hat auch gerne, schon in den 40er Jahren, amerikanische Melodien genommen und neue Texte drauf gemacht oder machen lassen. Dafür hat er allerhand Prügel bezogen. Er ist mal mit Eisler im alten Friedrichsstadtpalast aufgetreten, worauf es harte Kritiken gab. Da hieß es, er würde amerikanische Musik verbreiten und so weiter. (…)
Sie haben 1968 ein Buch mit dem Titel „Protestsongs“ herausgebracht, in dem auch Ernst Busch mit einem Lied gegen den Vietnamkrieg vertreten ist. In der Vorbemerkung widmeten Sie das Buch auch den Mitgliedern des Berliner Oktoberklubs, die damals sozusagen die Speerspitze der FDJ-Singebewegung waren. Hat Busch für die Singebewegung noch eine Rolle gespielt?
Teilweise schon, aber Busch war ja in den späten 60ern schon ein alter Mann, sodass es da wenig direkte Einflüsse gab. Ich erinnere mich auch an Unstimmigkeiten. Als die FDJ im März 1967 eine ziemlich staatskonforme Veranstaltung unter dem Titel „Kommt und singt!“ in der Volksbühne machte, wurde ich von Ordnern daran gehindert, den Saal zu betreten. Ich hatte sozusagen Hausverbot und war überhaupt unerwünscht, weil ich als Veranstalter von „Jazz und Folksongs“ aufgefallen war. Jedenfalls erzählte mir dann einer der FDJ-Leute, dass Ernst Busch eigentlich auch für diesen Abend eingeladen gewesen wäre, dann aber sein Kommen abgesagt hätte. Das fand ich natürlich gut damals. (…) Für die Singebewegung war vor allem Pete Seeger ein großes Vorbild. Der wiederum war Busch-Fan. Ich erinnere mich an ein Konzert von Seeger, das 1967 in der Volksbühne stattfand. Im Publikum war auch Ernst Busch. Ihm zu Ehren sang Pete Seeger „Die Moorsoldaten“ und sagte dann zur Ehrenloge hinauf: „Ernst Busch, das ist der weltweit größte Sänger des 20. Jahrhunderts!“
Das hat er gesagt?
Ja, er hat Busch sehr verehrt. Busch war für Seeger sozusagen das Original, an dem man sich zu orientieren hatte. Aber für die jungen Leute in der DDR der späten 60er Jahre war das Original schon zu weit weg. (…)
Interview: Jochen Voit
Foto: Renée Yvel
(Textfassung autorisiert von Werner „Josh“ Sellhorn am 22. 7. 2008)

Karl Siebig
über den Versuch, klassenorientierte Filme zu drehen, die Bedeutung proletarischer Kultur im Westen und seine Beschäftigung mit Ernst Busch
„Manches damals hatte ja fast religiösen Charakter: unsere Vorstellungen von Revolution und diesem ganzen Krams, wozu eben diese Lieder so wie Kirchenlieder gehörten - mein Gott ...“
(Gespräch am 19. April 2004 in Kiel)
Wir sitzen im Arbeitszimmer des Filmemachers unterm Dach. Ich denke, dass es bestimmt komisch für ihn ist, selbst interviewt zu werden, wo er doch der Fachmann fürs Dokumentarische ist: Normalerweise stellt er die Fragen und versucht, die Biografien anderer Leute zu rekonstruieren. Ich zeige ihm eines der Fotos, die man mir im Archiv der Kieler Nachrichten fotokopiert hat. Auf dem Bild sieht man Siebig als jungen Mann gemeinsam mit seinen Kollegen aus der DFFB mit Busch beim Interview – irgendwo in Berlin auf der Straße.
JV: Wissen Sie noch, wo und wann das war?
Karl Siebig: Das waren die Dreharbeiten zu dem zweiten Film, den wir für das ZDF gemacht hatten. Und ich weiß, dass ich an dem Tag 40 Grad Fieber hatte und mich kaum auf den Beinen halten konnte. Und das war da, wo Piscator seine Bühne hatte …
… am Nollendorfplatz?
… in der Nähe des Nollendorfplatzes, da haben wir gedreht. Das kann allerdings auch gewesen sein, da wo der Knast ist in Berlin …
Moabit?
Ja, es kann auch in Moabit gewesen sein. Und wo waren wir noch? In der Knesebeckstraße, so irgendwie in dieser Ecke.
Also im Westen haben Sie auch gedreht …
Ja, das haben wir.
War das schwierig, Genehmigungen zu kriegen?
Im Westen zu drehen? (lacht)
Ich meine: Konnte Busch überall hin?
Ja, für den war das überhaupt kein Problem.
Und im Osten zu drehen?
Im Osten zu drehen war schwierig für uns, klar. Aber es war nicht nur schwierig im Osten zu drehen, es war auch schwierig, mit Busch zu drehen. Also bei dem zweiten Film war es richtig kompliziert, weil er da schon ziemlich krank war. Und wenn ich heute in der Situation wäre, in der ich damals war, 1978 war das, dann würde ich wahrscheinlich sagen: Komm, wir brechen ab und machen nicht weiter. Damals dachte ich: Das geht noch. Er war schon so krank… Ich weiß noch, dass wir einen Tag lang das gedreht haben, was wir später Lexikon nannten. Das heißt: Er musste, und das war wirklich makaber, Sätze sagen, aus denen wir eigentlich nur einzelne Worte brauchten. Wir brauchten ein „und“ oder ein „aber“ oder „ich bin“ oder „ich habe“ oder so etwas. Weil er nur noch ganz unvollständige Sätze gesprochen hat, die waren kaum mehr verwendbar.
Sie brauchten nur den Klang seiner Stimme als Material?
Wir brauchten vor allen Dingen diese Wörter, die fehlten. Es gab Wörter, die fehlten in seinen Sätzen, die waren einfach nicht da.
Die haben Sie ihm dann aufgeschrieben oder vorgesprochen?
Ich weiß nicht mehr genau, wie wir’s gemacht haben. Jedenfalls, das war ziemlich makaber, und eigentlich darf man so was gar nicht machen … Ich glaube, er hat’s nicht mal mehr gemerkt. Der war wirklich furchtbar krank und ist ja auch kurz darauf in die Klinik gekommen. Ja, das war nicht sehr nett. Ein Kieler Journalist (Siebig spricht das J wie in Jokus) hat, ich glaube: das war anlässlich unserer Geburtstagsgeschichte, die wir vor vier Jahren gemacht haben, also im Jahre 2000, hatte der geschrieben, dass wir nicht mal bekannt gemacht hätten, dass diese böse Staatsführung der DDR Busch in eine psychatrische Anstalt gesteckt hätte wegen seiner Aufsässigkeit. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn.
Weil er einfach krank war?
Ja, er war krank. Aber da kann man auch sehen, wie aus irgendwelchen aufgeschnappten Sachen sogenannte Journalisten etwas machen, das aber vollkommen daneben ist.
Da stand der Satz drin, dass er angeblich singend mit der Gitarre um den Hals durch Berlin gelaufen wäre und auf die Kommunisten geschimpft hätte oder so was. Wie kommt so was zustande? War er in der Zeit aggressiv gegenüber …
In welcher Zeit? Von welcher Zeit reden wir?
Von den späten 70er Jahren. Dass er damals sozusagen unangenehm aufgefallen wäre in der Öffentlichkeit?
In der Öffentlichkeit weiß ich nicht. Er hat mir jedenfalls, ich glaube: bestimmt 20 mal erzählt eine Situation, wo er aufgetreten ist. Ich meine auch, das Fernsehen der DDR hätte das irgendwie mal übertragen, oder zumindest einen Bericht darüber gemacht, wo er das „Lied vom Klassenfeind“ vorgetragen hat. Das muss also in 76, 77, 78 gewesen sein.
Bei der Einweihung der Akademie der Künste vielleicht …
Mag sein, mag sein. In der ersten Reihe saß dann also die DDR-Staatsführung, natürlich Honecker ganz vorne. Und Busch (lacht) hat also ewig erzählt, dass immer wenn er die Zeile sang „Mein Klassenfeind bist du“, wie er dann Erich Honecker immer in die Augen gesehen hat oder mit dem Zeigefinger auf ihn gezeigt hat. Also, ich hab keine Ahnung, ob’s stimmt. Ich glaube, dass bei vielen dieser Geschichten, und davon hat er immer ’nen ganzen Sack parat gehabt, sich etwas verdichtet hat – wir sprachen vorhin im Auto über Eva Kemlein und mangelndes Erinnerungsvermögen – zu etwas, was er vielleicht gern gewollt hätte, sozusagen zur Tatsache geworden ist im Gedächtnis. Ich glaube, das ist auch bei ihm so gewesen. Außerdem ist er zeit seines Lebens Schauspieler gewesen, und als Schauspieler spielt man eine Rolle, und die hat er gespielt.
Hat er gern den wilden Mann dargestellt oder den Unruhestifter?
Sicher nicht den wilden Mann, vielleicht den Unruhestifter, aber wirklich im positiven Sinn. Jemand, der nicht einfach „Ja“ sagt. Obwohl in dieser Zeit, von der wir gerade reden, also 76, 77, 78 … Ich weiß gar nicht mehr, wann war diese Biermann-Geschichte? Das war 76 glaub ich …
Ja.
Da hat er ja im Neuen Deutschland ganz oben, als einer der ersten eine Stellungnahme, übrigens auch ein Zitat aus dem Brechtschen „Klassenfeind“, reingesetzt oder unterschrieben oder so etwas. Er hat mir damals auch eine – ich krieg das heut auch gar nicht mehr zusammen, darf das also gar nicht erzählen – verworrene Geschichte über seine Bekanntschaft mit Biermann erzählt, der wohl irgendwann mal in früheren Jahren häufiger bei Busch war und Busch ihm wohl immer irgendwie mit Misstrauen begegnet war. Ich will das mal ganz vorsichtig sagen. Ich erinnere das nicht mehr genau.
Sehr geschätzt hat er ihn wohl nicht …
Kann ich nicht sagen. Also, ich kann’s wirklich nicht sagen. Das, was er mir gesagt hat, das war nach der Geschichte mit der Veröffentlichung nach der Ausweisung Biermanns, das klang natürlich alles andere als freundlich gegenüber Biermann.
Das liest sich im Nachhinein ein bisschen so, als hätte er jemandem, der gerade ausgebürgert wurde, noch einen mitgegeben …
Kann sein. Ich bin da auch nicht sehr eindeutig. Ich weiß nicht, was politische Überlegung oder individuelles Misstrauen oder Verachtung in dieser Geschichte gewesen ist. Ich glaube aber, dass Busch jemand war, der eine politische Hierarchie hatte. Und dass Dinge und sicherlich auch Bekanntschaften oder Beziehungen, die für ihn weniger wichtig waren als gewisse politische Ziele, dass er die dann auch so leicht öffentlich gemacht hat, wie er es eben in diesem Fall getan hat.
Können Sie noch mal schildern, wie es dazu kam, dass Sie die Filme gemacht haben? Sie sind ja damals von Kiel nach Berlin gegangen, um dort Film zu studieren und haben als erstes Projekt 1976 diesen Busch-Film gemacht …
Ich wollte eben keinen Film über Busch machen, sondern ich wollte einen Film über den Busch-Chor machen, der Mitte der 70er Jahre in Kiel gegründet worden war. Und meine Frage, die ich filmisch stellen wollte, war: Wie kommen junge Leute dazu, die waren damals 20, 25 Jahre alt, wie kommen solche Leute dazu, Lieder zu singen, die uralt sind? Die 50, 60, 70 Jahre alt sind und mit denen man eigentlich so ohne weiteres nichts zu tun hat, die aus einer Zeit stammen, mit der man eigentlich nichts zu tun hat. Wo viele von ihrem Herkommen her, sozusagen mit ihrer Klassenzugehörigkeit eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten mit dem, was sie da gesungen haben. Wie ist das eigentlich alles möglich? Das war sozusagen die große Frage, die mich bewog, zu dem Chor zu gehen und zu sagen: Kinners, ich möchte gern einen Film mit Euch machen! Und dann erzählten die mir, wie sie zu dem Namen „Ernst Busch“ gekommen sind. Nämlich indem sie nach Berlin gefahren sind und Ernst Busch höchstpersönlich gefragt haben: Dürfen wir deinen oder ihren Namen haben? Bei Busch gab’s übrigens nicht so ohne weiteres ein Du, auch unter Gleichgesinnten blieb es beim Sie. Auch Busch und Brecht übrigens haben sich soweit ich weiß immer nur gesiezt.
Hat er Sie auch gesiezt, der Busch?
Manchmal ja, manchmal nein. Und dann erzählten mir die Chor-Leute, dass sie eben von Busch die Genehmigung eingeholt hatten. Und da hab ich, das muss ich eben zu meiner Schande gestehen, überhaupt erst erfahren, dass der Busch noch lebt. Für mich lebte er längst nicht mehr. Für mich war das eine proletarische Legende, die ganz weit weg war. Legenden pflegen eben nicht zu leben. Spanischer Bürgerkrieg! Oder die Lieder des Spanischen Bürgerkrieges, die wir an den Lagerfeuern sozusagen grölten (lacht) … Das war so weit weg …
Sie haben also diese Lieder früher selber gesungen?
(versonnen) Ja, wir haben hin und wieder, da und dort (lacht) das ein oder andere … gesungen würd ich nicht sagen, gebölkt, ja.
Weil Sie Kieler sind und wussten, der ist auch von hier oder weil die Lieder …
Also, diese Beziehung: Busch und Kiel, die war mir so was von gleichgültig.
Wie kamen Sie denn in Kontakt mit diesen Liedern?
Das war eher, weil ich mich in einem politischen Umfeld bewegte, in dem man sowas sang.
In Ihrem Freundeskreis hörte man Busch-Platten?
Ja. Also, ich war jahrelang bei den Jungsozialisten, bei dieser Jugendorganisation der SPD, die zu der Zeit (lacht), als ich dazu stieß, natürlich über bewaffneten Kampf und solche Mätzchen redete. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, das war nicht etwa so, dass es – so wie heute – darum ging Plakate zu kleben oder irgend so’n Kram. Da ging’s also wirklich um gewaltige Fragen der Veränderung. Dachten wir!
Wann war das?
Das war schon Ende der 60er. Da bin ich damit in Berührung gekommen, und das war auch alles so in Ordnung. Da wurden natürlich Busch-Lieder gesungen. Weil alles, was über 30 war oder so, war für uns vom Lebensalter her nicht mehr maßgebend. Alles, was die redeten, war Quatsch. Wir standen quasi kurz vor der Revolution. Es mussten nur noch ’n paar kleine Anstöße gegeben werden. Also war die Frage natürlich durchaus nahe liegend, wie man sich bewaffnet und solche Sachen, klar. Und welche Lieder man hatte. Es gab ja keine anderen als die, die von diesem Sänger Busch sozusagen zur Verfügung gestellt worden sind.
Wie wurden die kombiniert, mit welchen anderen Liedern? Mit angloamerikanischen Sachen wahrscheinlich …
Also, „We Shall Overcome“ wurde, glaube ich, nur im Bündnis mit irgendwelchen Christen gesungen. Aber (lacht) sonst nicht …
Es war doch sicher nicht nur Busch, oder? War das so eine Mischung, wie man sich das heute vorstellt: Busch und die Stones?
(lacht) Merkwürdig, ja. Also, ich hab da eigentlich nie so richtig drüber nachgedacht. Also, Busch war nicht die Musik, die wir gerne hörten. Es kam auf die Texte an. Aber natürlich waren die Stones tausendmal interessanter. Logisch. Klar. Wenn man in einem Alter ist, in dem man ja nicht nur sich zu orientieren versucht in der Welt, sondern sich auch hinsichtlich des anderen Geschlechts zu orientieren versucht, ist natürlich das, was er aus Spanien singend zu berichten hatte, eigentlich nicht so ganz das (lacht), was man sich erträumt.
Frauen sind mit dieser Musik wohl auch schwer zu gewinnen …
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann mich überhaupt nicht entsinnen, dass wir mit Frauen da mal …, na ja …
Aber Busch war jedenfalls präsent, zuerst vor allem offenbar durch die Lieder …
Ja, nur. Ausschließlich durch die Lieder. Der Schauspieler Busch und auch der Kabarettist Busch, der schon gar nicht, waren nicht präsent. Das betrifft jedenfalls das Umfeld, in dem ich war. Bei mir war das dann relativ schnell ein bisschen anders, weil ich mich mit bestimmten Sachen beschäftigte und dann wusste, dass er ein wichtiger Schauspieler war, das war für mich zunächst alles nur Vergangenheit.
Haben Sie dann auch Filme geguckt von ihm?
Ja, ja. Also, „Kuhle Wampe“ war natürlich sozusagen der Film, aus dem man eigentlich alles lernen konnte, was man lernen musste, wenn man sozusagen klassenorientierte Filme machen wollte, natürlich.
War das Ihre Vorstellung: klassenorientierte Filme zu machen?
Es gab ja nichts anderes. Die Idee war: Alles, was man macht, muss politisch irgendwie sinnvoll sein. Und politisch sinnvoll ist nur das, was die Welt verändert und zwar mächtig verändert, möglichst revolutionär verändert, natürlich. Das war das Ding damals, oder mein Ding jedenfalls.
Haben Sie selbst einen proletarischen Hintergrund?
Ja.
Daher war Ihnen Klassenbewusstsein …
… das war mir nicht fremd. Das musste ich mir nicht anlesen oder so.
Wie war dann die Begegnung mit Busch selbst?
Ich habe das, glaube ich, in diesem Büchlein da auch mal aufgeschrieben („Ich geh mit dem Jahrhundert mit“ bei Rowohlt, JV). Es war irgendwie, jedenfalls im Nachhinein, ziemlich merkwürdig. Ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen merkwürdig. Ich glaube: viel merkwürdiger als lustig. Dass er eben da draußen war und ich überhaupt keine Vorstellung hatte, wie dieser Mensch eigentlich aussieht. Weil er für mich ja eigentlich nicht mehr unter den Lebenden war. Und ich glaube, ich hatte telefoniert vorher.
Er lebte damals in Pankow in der Leonard-Frank-Straße …
Genau, hinter dem Garten war der Friedhof. Auf die Mauer ist er auch gerne gestiegen, da habe ich auch ’n paar Fotos gemacht, wie er da auf irgend so ’ne Leiter gestiegen ist und über die Mauer zum Friedhof rübergeguckt und gesagt hat: Da werd ich irgendwann mal liegen … Der war vor dem Haus und hat Laub zusammengekehrt oder irgend so’n Quatsch gemacht. Und ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie der aussah. Vermutlich hab ich den zuerst für so ’ne Art Gärtner gehalten und hab dann gefragt, wo ein gewisser Ernst Busch wohnt. Und dann hat er gesagt: Ja, da müssense da rein gehen. Dann hab ich geklingelt, und seine Frau hat aufgemacht. Und er ist dann irgendwie außenrum und von der Hintertür, weiß der Teufel, jedenfalls kam eben der Nämliche mir dann in der Wohnung auch selbst entgegen. War superfreundlich, weil er eben wusste, ich komm aus Kiel. Und das war der eigentliche Schlüssel: Da kommt jemand aus seiner geliebten Heimatstadt. Ich glaube, dass er zeit seines Lebens … ja schlicht Heimweh hatte. Er liebte diese Stadt. Und wenn er Berlin, Ost-Berlin zu DDR-Zeiten, verlassen hat und dann nach Hiddensee gefahren ist …
Hat er versucht, auf Hiddensee ein Stück Kiel wieder zu finden?
Ich glaube, ja, Das war ziemlich wichtig für ihn. Ich glaube, dass er wirklich gelitten hat. Dass er nicht jeden Tag und wann immer er wollte sagen kann: Okay, ich geh hier mal eben an die Hörn oder so etwas.
Eine Zeit lang hat er wohl ja versucht Kontakt zu halten zur Stadt. Er hatte zum Beispiel auch Geld hier auf der Sparkasse. Und früher gab es ja auch Verwandtschaft. Sind seine Geschwister Erna und Willi eigentlich schon lange tot?
Der Willi ist, glaub ich, schon ewig tot. Die Erna hab ich Mitte der 70er Jahre einmal kurz gesehen. (…) Ich hab mich aber dann nicht weiter um die Verwandtschaft gekümmert, weil offenbar deren Kinder auch kein wirkliches Interesse an dem hatten, was Busch eigentlich ausmacht.
Ihr eigenes Interesse an Busch scheint jedenfalls groß gewesen zu sein. Nach Ihrem ersten Film über Busch kam rasch der zweite …
Nee. Nee, nee. Das wollte ich gar nicht. Ich dachte nach dem ersten Film, hab das übrigens immer gedacht bei Sachen, die ich gemacht habe: Jetzt ist Feierabend. Man darf auch nicht zu viel darüber machen, muss sich auch wieder anderen Dingen zuwenden. Aber dann kommen immer Leute und sagen: Sag mal, kannst du nich‘ für uns …, damals war es das ZDF, kannst du nicht für uns was machen? Wir würden das auch gerne haben. Und deswegen ging das dann weiter. Ich würd’s heute nicht mehr machen.
Keinen zweiten Film über Busch? Warum?
Erstens wegen dieser schrecklichen gesundheitlichen Situation und zweitens weil ich wirklich glaube, dass man sich so einem „Gegenstand“ nur einmal wirklich nähern sollte und dann wieder weggehen. Man hat, wenn man viel über einen Protagonisten weiß, keine richtigen Fragen mehr. Auch das, was da so aufgeschrieben ist, das hätte ich besser gelassen.
Warum?
Aus dem gleichen Grund. Ich glaube nicht, dass es gut ist.
Ist Ihnen das Buch unangenehm?
Ja. Es gibt manche Sachen, die mir darin unangenehm sind.
Weil Sie zu sehr seinem Charme verfallen sind?
(ungläubig) Charme?
Oder was auch immer …
Busch und Charme? (lacht) Nee, das passt nicht!
Gut, seiner Ausstrahlung oder …
(lacht) Nein, nein. Ich will mal andersherum sagen: Irene Busch, seine Frau, hatte ja immer ein sehr wachsames Auge auf ihn – jedenfalls solange ich mit ihm zu tun hatte. Und ich wage fast zu sagen, dass wir ein bisschen befreundet waren, weil sie auch, als er dann längst in der Klinik war und sie krank wurde, immer wenn da irgendwas war, nach mir gerufen hat, also auch die Probleme mit dem Sohn mit mir besprochen hat. Sie hat immer gemeint, dass Busch zu mir ein besonders gutes Verhältnis gehabt hätte. Sie hat sich immer gewundert darüber, wie bereitwillig er Auskunft gegeben hat, das hätte er sonst nie getan. Ich fand, dass seine Auskünfte entweder ziemlich ich-bezogen waren: „Ich habe …“ – und alle andern haben sozusagen nachgemacht, das heißt: eigentlich sind sie nicht so rasend glaubwürdig, fand ich immer. Und das sind Dinge, die mich immer gestört haben. Auch als ich ganz bescheiden mit diesen Schreibereien angefangen habe … auch völlig ungeübt und ohne die geringste Ahnung, wie man so was macht. Ist ja auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Auch da hat jemand gesagt: Schreib das doch auf, wir verlegen das!
Sie sprechen vom Rowohlt-Verlag?
Ja, ich kannte über die Akademie jemanden, der da irgendwelche Verbindungen hatte, der sagte: Mensch, du hast da ’nen feinen Film gemacht, schreib das mal alles auf, das ist ja alles wunderbar und so. Im Westen gebe es so was nicht, ich solle das mal machen. So, dann habe ich das eben gemacht und das ist … ich weiß gar nicht, wann war das eigentlich?
Das war 1980.
80, na, guck das ist ja auch fast 25 Jahre her, auch schon ’ne Ewigkeit.
Aber das Buch ist doch ’ne runde Sache geworden.
Ja, na ja. Ich würde so was heute nicht mehr machen. Ganz schlicht. In der Form schon gar nicht.
Nun ist es ja bemerkenswert, dass da jemand aus dem Westen kam, einen Film über Busch machte und damit auch im Osten offenbar wieder ein neues Interesse an diesem Künstler weckte.
Wir waren ja im gleichen Jahr, also noch 76 oder 77, in Leipzig auf der Dok-Filmwoche, Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche hieß das, die ja wirklich ein bedeutendes Dokumentarfilm-Festival war, also weltweit würde ich mal sagen, wo wir auch gerne hingegangen sind mit unserm Film, die wir politisch ja immer ’n bisschen was bewegen wollten. Da merkte ich, der Film wurde dazu eingeladen, aber es wurde mir gleich gesagt: Der läuft so irgendwie nebenher, wir wollen da keine große Geschichte draus machen. Da dachte ich: Komisch, nich, ich war ganz unbefangen zu der Zeit, das ist ja irgendwie sehr merkwürdig. Und hinterher war’s eigentlich noch viel schlimmer: Es gab nicht ein einziges Interview mit dem DDR-Rundfunk; es gab nichts mit dem DDR-Fernsehen, obwohl die sonst hinter jedem Pups hergelaufen sind, der aus’m Westen gelassen wurde – Hauptsache, er lief in Leipzig. Und nun ausgerechnet mit jemandem, der als Ikone in der DDR nun wirklich ’nen Namen hatte und nach dieser Figur, weiß der Deubel, irgendwelche Schulen oder Regimenter oder irgend so’n Krams benannt worden sind … Aber es war nichts! Es war einfach nichts. So, und dann kam Konrad Wolf irgendwann zu mir und sagte: Also, hör zu, so und so is das. Es kann eigentlich nicht sein, dass irgend so’n Knabe, völlig unbekanntes Wesen aus’m Westen, kommt und unsern Busch da porträtiert.
Aber das hat er nicht so gesagt, oder?
So ähnlich, doch. Also, er meinte es natürlich positiv, er war superfreundlich und hat das nicht anklagend gesagt, sondern als Erklärung, weshalb diese offiziellen Leute so merkwürdig mit dieser Tatsache umgegangen sind.
Wollte er sich da auch schon filmisch mit dem Thema beschäftigen?
Nee, nee, aber das kam dann ja kurz darauf. Und ich bin dann ja auch in dieses Redaktionsteam mitgekommen, obwohl offiziell auch nie. Ich glaube, mein Name taucht auch nirgendwo auf. Aber er hatte da so ’ne Gruppe gegründet, und die saß dann irgendwo, das war auch ziemlich merkwürdig, in einer ganz maroden Wohngegend in Ost-Berlin. Da saßen aber zum Teil wirklich gute Leute. Also, der Peter Voigt zum Beispiel, den ich super finde, den ich sehr schätze, ganz hervorragender Kollege, der, ich glaube, den ersten Film oder zwei dieser Filme von Konrad Wolf gemacht hat.
Er hat auch einen Film zum 100. Geburtstag von Busch gemacht, der 2000 im Fernsehen lief.
Ah ja, kenn ich gar nicht.
Waren Sie regelmäßig bei diesen Redaktionstreffen dabei?
Regelmäßig nicht, vier-, fünfmal vielleicht.
Fanden Sie den Ansatz gut, der da verfolgt wurde? Also Geschichte darzustellen anhand der Busch-Lieder?
Das fand ich phänomenal. Ich fand die Lieder nämlich nicht so bedeutend. Und dass dann jemand wie Konrad Wolf hergeht und sagt: Das ist für uns der Ausgangspunkt und danach wollen wir diese Filme machen – das fand ich schon grandios. Das hätt ich mich nie im Leben getraut!
Und haben Ihnen die Filme dann gefallen?
Nee, nicht alle. Ich erinnere, ich glaube, den ersten, den Peter Voigt gemacht hat. Weil das so eine Form von Montage war, so eine Collagenform war, die mir sehr imponiert hat. Die fand ich sowohl filmisch als auch intellektuell ziemlich gut. Ich fand diese Dinge da aus Spanien, die fand ich einfach langweilig.
Die Szene mit dem Mann, der auf dem Hügel steht und dem eine Platte vorgespielt wird …
Ich kann mich so rasend genau jetzt nicht erinnern. Ich weiß nur: Ich fand’s damals ziemlich langweilig.
Haben die denn auch Material von Ihnen verwendet, was Sie vorher schon gedreht hatten?
Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nur eins, nämlich dass Konrad Wolf in irgendeinem dieser Filme mit diesem kleinen Rowohlt-Büchlein auftaucht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch drin ist. Jedenfalls gab’s das in der Fassung, die dann in Leipzig irgendwann lief, also bei der Uraufführung oder so. Oder in der Akademie der Künste, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und hat mit diesem kleinen Büchlein vor der Kamera gestanden und hat daraus irgendwas zitiert. Sozusagen: „Hieraus haben wir das.“ Das fand ich ja ziemlich nett und freundlich (lacht). Aber das hat dann wohl auch dazu geführt, dass es wieder so ’n paar Probleme gab.
Wurde die Szene dann rausgenommen?
Ich weiß es nicht. Ich hab das vielleicht zweimal gesehen.
Hat sie diese Behandlung gekränkt?
(lange Pause) Nee, ich glaube nicht gekränkt. Aber es führte ein bisschen dazu, dass ich dachte, dass meine Vorstellungen von einem politischen System, das Sozialismus heißt, weit offener sind als das, was da praktiziert wurde. Wenn Sozialismus sozusagen eine gesellschaftlich höhere Stufe dessen sein soll, was wir haben, dann muss auch mehr möglich sein und nicht weniger. Und das fand ich also niederträchtig. Nicht gekränkt, niederträchtig. So was macht man nicht. Also wenn man etwas nimmt von anderen, dann sagt man, woher das ist. Ganz einfach. So wie das überall auf der Welt üblich ist. Und wenn man die Dinge verschämt verschweigt, und da war die DDR ja irgendwie Meister drin … also auch ohne verschämt zu sein, nur im Verschweigen, das konnte sie ja ziemlich gut.
Was mir auffällt: Vorhin im Auto haben Sie gesagt, dass Sie 15 Jahre in Berlin gelebt haben. Wenn man sich das nun ausrechnet, 76 haben Sie angefangen, dann standen Ihre 15 Jahre Berlin ja ganz im Zeichen von Ernst Busch …
Nein!
Na ja, Sie haben zwei Filme über Busch unter eigenem Namen gemacht, ein Buch geschrieben, am sechsteiligen Film-Zyklus von Wolf mitgearbeitet und anschließend gemeinsam mit Hoffmann einen aufwändig gestalteten Bildband zu Busch herausgegeben. Man kann also nicht sagen, dass Sie die Nase voll gehabt hätten nach dem Wolf-Projekt …
Doch, eigentlich schon. Jedesmal dachte ich mir, schon nach dem ersten Film: Schluss damit! Da kam dieser nette, freundliche Kulturchef des ZDF, Walter Schmieding, der, wenn wir ihm irgendwelche Sachen zeigten, die wir gedreht und geschnitten hatten, regelmäßig einschlief (Lachen). Und wir dachten immer: Oh, prima, prima, prima, das geht alles durch! Kamen überhaupt nicht auf die Idee, dass das einfach langweilig war, was wir da gemacht hatten. Jedenfalls, der kam und sagte: Machen wir. Dann diese Geschichte mit diesem Rowohlt-Bändchen, das ich auch nicht unbedingt wollte, was auch durch jemand anderen zustande kam, der gesagt hat: Mach das mal. Und diese DDR-Buch-Geschichte, das war …
Erschienen ist es 1987 …
Ja. Ich bin bestimmt mindestens ’n Jahr da jeden Tag hin und hergefahren.
Deswegen meine ich: Der Busch war in Ihrem Leben doch sehr präsent.
Das war sehr zeitaufwändig. Und ich kann auch nicht sagen, weshalb ich das gemacht habe. Es war jedenfall nicht so, dass diese Zeit durch Busch geprägt war. Das war sie ganz bestimmt nicht. Also dafür waren dann diese Zeitabschnitte auch zu hermetisch, nicht wahr. Danach und dazwischen hab ich ja nun weiß Gott andere Sachen gemacht – Gott sei Dank.
Hermetisch heißt, dass Sie immer für kurze Zeit „Busch total“ gemacht haben und dann wieder etwas anderes?
Na ja, „Busch total“ eben auch nicht.
Na, zum Beispiel dieses eine Jahr, in dem Sie jeden Tag hin- und hergefahren sind …
Na ja, aber „Busch total“ … Ist ja auch nicht so, dass mich das nun unentwegt von morgens bis abends beschäftigt hätte. Also, ich will jetzt hier dem jungen Kollegen (lacht) nicht die Leidenschaft oder die Begeisterung nehmen. Aber es gab eben eine Zeit, wo ich vermutet habe, meinen Gegenstand allmählich in- und auswendig zu kennen. Wie es auch eine Zeit gab, in der ich dachte, man müsse über den Gegenstand, über den man Filme macht, besser Bescheid wissen als der Gegenstand über sich selbst Bescheid weiß …
Und das ist nicht so?
Das ist nicht so. Nein, das ist überhaupt nicht so. (…)
(Exkurs zur Arbeit des Filmemachers und zum Genre des Dokumentarfilms, Siebig erzählt von sich und dem Kollegen Johann Feindt und über die notwendige Neugierde beim Recherchieren, die man sich erhalten müsse durch echte Lücken in der den Film vorbereitenden Recherche, die dazu führten, dass aus echtem Interesse Fragen gestellt würden: „Man darf nicht alles recherchieren!“, sagt er, und: „Man muss die Neugierde sich erhalten!“ Man dürfe eben nicht mit dem Drehen des Films anfangen und schon alles wissen – so ähnlich nachzulesen in Siebigs Leitfaden für Filmstudenten „Film und Fernsehen“)
Sie haben erzählt, dass Sie an Konrad Wolfs Filmprojekt „Busch singt“ mitgearbeitet haben, wenn auch nicht genannt wurden …
Auch nicht jeden Tag. Und auch nicht mal an einzelnen Filmen, sondern nur in diesen Besprechungen, in denen es um das Gesamtkonzept und solche Dinge ging. Ich weiß nicht mal mehr, wie oft ich dabei war.
Wie würden Sie Ihr Verhältnis beschreiben zu diesen doch recht prominenten DDR-Kulturschaffenden zu dieser Zeit? Sie hatten bis dahin zwei Filme über Busch gedreht, ein Buch veröffentlicht. Sie waren ja kein Nobody, Sie waren nicht mehr der dahergelaufene Westler.
Doch. Das war ich und das blieb ich.
Es kam doch dann die Anfrage, diesen Bildband zu machen …
Aber das war doch deutlich später. (…) Es war so, dass der Ludwig Hofmann mich irgendwann anrief und fragte, ob ich Lust hätte, das zu machen.
Kannten Sie den vorher?
Nee. Also nur als Autor zahlreicher wichtiger Bücher über Arbeitertheater und all diese Dinge. Ich kannte ihn aber persönlich überhaupt nicht. Dann haben wir uns in der Akademie getroffen. Und damals war für mich die Frage: Ja, ich will das ja gerne tun, aber wie soll ich mein Überleben sichern? Das eine findet in der DDR statt, ich leb’ aber in West-Berlin und brauche D-Mark. Die Frage wurde dann relativ schnell geklärt: Ja gut, dann zahlen wir D-Mark, das schien überhaupt kein Problem zu sein. Und Co-Autorin sollte eine DDR-Kollegin sein. (…) Es war so, wie teutonische Angestellte eben arbeiten: Morgens um neun geht man in irgendso’n merkwürdiges Büro … (lacht) in der Akademie der Künste der DDR mit merkwürdigen Blümchentapeten und grauen Türen und diesem ewigen DDR-Lysol-Geruch, oder ich weiß nicht, irgendso’n antiseptisches Zeug (lacht), was die da überall versprüht oder verwischt haben.
Da haben Sie sich dann immer zu dritt getroffen?
Zu zweit. Die Kollegin und ich. Wir beide sollten das machen.
Ohne Hoffmann?
Ja, ja. Der war der Chef der Abteilung, und das war’s. Aber mit der Frau klappte das nicht so recht, das war relativ schnell klar. (…) Die Recherchen selbst waren durch. Ich glaub, ich bin nur noch in Mainz gewesen im Kabarett-Museum. Und bei Eva Busch in München.
War das ergiebig?
Ja. Das fand ich oberspannend. Das war eine total andere Frau, ich kannte ja bis dahin nur Irene Busch.
Die hatte nicht ganz so viel Glamour?
(lacht) Nee, das kann man nicht sagen. Das war so’n graues DDR-Mäuschen, passte in diese Atmosphäre der Akademie der Künste mit Blümchentapeten und grauen Türen und diesem komischen Geruch.
Eva war dagegen eine Diva?
Ja. (…) Sie hat mir auch gerne Auskunft gegeben. Das war klasse, da mochte ich auch gerne sein. Fragen Sie mich jetzt nicht nach Einzelheiten, die weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich superhappy war, als ich da weggefahren bin und dachte :’ne ganz andere Seite von Busch! Also ‚’ne klasse Seite, ’ne lustvolle Seite. Das war ja ’ne Frau, die das Leben mochte und die nicht hinter jedem Baum den Klassenfeind oder sonst was vermutet hat. (…)
(Ende von Seite 1, Kassette 1)
Wie ging es dann weiter mit dem Buch, nachdem es mit der Kollegin nicht geklappt hatte?
Allein war das nicht zu machen bei dem wahnsinnigen Wust von Material. Ich hatte ja nun unmittelbar und ständig Zugriff auf das Archiv . Das war ja vorher bei meiner Arbeit an den Filmen nicht so gewesen. Da bin ich ja immer zu Busch gelatscht und hab gefragt: Habt ihr nicht mal dieses oder habt ihr nicht mal jenes? Das heißt: Ich musste von anderer Stelle erst mal erfahren, dass es so etwas gibt, bevor ich danach fragen konnte.
Wo war dieses Archiv gewesen?
Na, in seinem Haus: Seine tausend Ordner, seine Wahnsinnskästen mit Fotografien oder Briefdokumenten oder weiß der Deubel was. Und das war natürlich nicht gerade super geordnet, sondern alles relativ durcheinander.
Wer hat Ihnen die Sachen bereitgestellt, Irene Busch?
Ja. Die hat dann so ’n Kasten auf den Tisch gestellt, und wir haben dann drin rumgewühlt, Busch zuallererst, und so chaotisch, wie diese Kästen zusammengestellt waren, so lag das dann alles da. Das heißt: Ich musste wirklich gezielt nach Dingen, wenn ich sie haben wollte, fragen. Das setzt aber voraus, dass man von der Existenz dieser Dinge weiß. Und das spielte nun in der Akademie keine Rolle mehr, weil mir die Dinge von morgens bis abends zugänglich waren. Und wenn sie nicht im Original da waren, dann waren sie als Fotokopien da. Und ich meine Foto-Kopien. Die waren richtig fotografiert, die Dinger. Da gab es einen Fotografen, der das alles, hundert oder tausend Briefe und weiß der Deubel was, fotografiert hat. Ich hab ja heute noch tonnenweise Negative davon, tonnenweise. (…) Unglaubliche Mengen – für mich war das einfach viel zu viel. Und ich hatte auch keine Lust, mich um jeden Winkel seines Lebens zu kümmern.
Gab es Leute, die Ihnen geholfen haben?
Ja, da war so ’ne ältere Frau, von der ich absolut und von Anfang an sicher war, dass sie in erster Linie ’ne Stasi-Frau war (lacht), die wahrscheinlich jeden Abend aufgeschrieben hat, was der Siebig wieder für blöde Fragen gestellt hat oder so. Die hat jedenfalls die Büroarbeit gemacht, der konnte ich Sachen diktieren oder konnte sagen – also wir haben uns natürlich geduzt: Schreib mir bitte mal das und das auf. Aber es war natürlich klar, dass da noch jemand her musste. Und zwar jemand, der vom Theater etwas versteht, wovon ich ja überhaupt nie etwas verstanden habe. Das, was ich davon wusste, habe ich, bezogen auf Busch jedenfalls, von Theaterleuten aus Berlin/Ost oder Berlin/West unmittelbar erfahren. Und da ich auch nie Theaterwissenschaft oder Theatergeschichte studiert hatte, waren das alles nur Winzigkeiten, die ich da wusste. Und Ludwig (Hoffmann, JV) war natürlich ein absoluter Experte auf diesem Gebiet. Deswegen war von vornherein klar, ohne dass wir uns groß absprechen mussten, dass er sich um die Theatersachen kümmert, die in der DDR stattgefunden haben. Aber bis dahin habe ich, glaube ich, den ganzen Krams geschrieben. Na ja… (…)
Wie wurde das Buch aufgenommen?
Da gab es eine richtig offizielle Buchpräsentation. Und das angeblich erste Exemplar wurde dem Honecker überreicht. Weiß aber nicht mehr, wo das war. Ich erinnere mich nur noch: Die erste Lesung, also eigentlich war es keine Lesung, fand bei der Nationalen Volksarmee statt.
Vor Leuten in Uniform?
Ja, natürlich. Das war etwas außerhalb von Berlin, da hatten die, ich weiß nicht, ob es das Hauptquartier war, so ’ne wichtige militärische Stelle, wo so ’n paar goldbeträsste Herrschaften rumsaßen. (…) Und da waren wir, der Hoffmann und ich. Das sollte ’ne Lesung sein, aber es war natürlich keine, weil nur Reden geschwungen wurden über Gott weiß was, alles Mögliche, was die Leute ja jeden Tag hörten und lasen oder eben nicht hörten und lasen oder was jeden Tag verlautbart wurde, also immer derselbe Krams, derselbe langweilige Krams – das ging Stunden, dieses Zeugs. Und dann gab’s was zu Essen. So war das. Und zu Saufen. So, und dann klatschten alle in die Hände und sagten: Ham wir prima gemacht! Und die Leute haben die Bücher gekauft wie die Wahnsinnigen, echt. Ich weiß nicht, wie das Buch insgesamt ging, aber bei dieser Veranstaltung ist beinahe jeder mit so ‚m Buch nach Hause gegangen. (…)
(Exkurs über den Alltag in der DDR, wie ihn Siebig erlebte)
Gab es Textpassagen in dem Buch, mit denen Sie angeeckt sind?
Ich erinnere noch gut, dass es eine Auseinandersetzung mit einem Lektor gab, dessen Namen ich völlig vergessen habe, der ein Kapitel beanstandete,was ich zum Spanienteil geschrieben hatte, wo es um Gustav Regler und diese Leute ging, mit denen Busch ja durchaus freundschaftlich zu tun hatte. Regler war sozusagen als Renegat Unperson in der DDR, das durfte nicht sein. Ich erinnere noch, dass mich eine DDR-Schriftstellerin anrief, die davon Wind bekommen hatte, dass man diese Sachen nicht im Buch haben wollte, irgendjemand hatte ihr das erzählt, und sagte: Kämpfen Sie dafür, dass das drinbleibt! Da hab ich gesagt: Das will ich gerne tun. Nur wenn die das nicht wollen, kann ich auch nichts machen. Ich habe mir dann vorgestellt: Was ist eigentlich, wenn sich die Situation mal verändert und ich treffe diesen Lektor auf der Straße wieder? Und ich frage ihn: Was hast du damals mit dem Kapitel gemacht? Ein paar Jahre später wäre es ja so weit gewesen, aber ich habe ihn nie wieder getroffen. (…)
Erstaunlich freimütig geschrieben finde ich die Passage (S. 287) zu Buschs Problemen mit der Partei um 1953. Die ist ja von Ihnen …
Ja. Mich wundert das heute auch. (…) Ich glaube, dass diese Sache nur möglich war, weil es diesen letzten Satz gegeben hat, der besagt, dass ihm auf Honeckers Veranlassung nach dem VIII. Parteitag der SED ein neues Parteibuch ausgehändigt wurde.
Ist das belegt?
Völliger Blödsinn. Ja, doch. Formal stimmt es wohl. Busch hat mir das erzählt. Aber vielleicht stammt es, wie manches bei ihm, aus der Abteilung Ich-hätte-mir-gewünscht-dass-es-so-wäre.
Wie fanden Sie denn den Busch?
Wie ich ihn menschlich fand? Ich mochte ihn, ich mochte ihn. Ich bin ja auch nach dieser ersten Geschichte, die wir 76 begonnen haben, privat ziemlich oft da gewesen, also zu Geburtstagen und so immer eingeladen worden, und habe auch erlebt, dass die Creme der DDR-Kultur, jedenfalls der altenDDR-Kultur, da auftauchte, und natürlich auch Leute aus der Politik, die was zu sagen hatten, da auftauchten. Und ich hatte angesichts dieser wichtigen Leute, die bei solchen Anlässen da waren, nie das Gefühl, dass der Busch damit gespielt hätte oder sich anders verhalten hätte. Sondern er hat den Zeitungsverkäufer genauso freundlich und menschlich begrüßt wie die Parteisekretärin der Weiß-derTeufel-was oder die Verantwortliche im ZK für die Frage „Warum hat der Kommunismus die Welt immer noch nicht erobert?“ oder so was. Jedenfalls: Ich fand den Busch immer ziemlich menschlich, was solche Dinge anging. Ich habe ja damals auch die alten „Kuhle Wampe“-Darsteller zu ihm eingeladen.
Das ist eine schöne Stelle in Ihrem Film, finde ich.
Das ist eine der ganz wenigen schönen Stellen (lacht). Sonst ist es ja eher ein politisches Pamphlet.
Sie lassen die Darsteller einfach über die gute alte Zeit reden, das wirkt lebendig.
Auch da versuchte er nicht zu sagen: Ich bin hier der große Busch – und wer seid ihr eigentlich?
Vorhin haben Sie gesagt, bei ihm hätte es immer „ich, ich, ich“ geheißen.
Ja, ja, natürlich auch. Bei Schauspielern, glaube ich, gibt es beide Phasen. Sobald ich als Schauspieler das Gefühl habe „Mein Gegenüber weiß nicht so recht, wer ich eigentlich bin und wie wichtig ich bin“, muss ich ihm erst mal sagen, dass ich überhaupt das Wichtigste unter Gottes Sonne bin. Und wenn er das kapiert hat, kann ich auch mal über andere reden. Zu der Kategorie gehörte Busch ganz sicher auch. Aber wenn das erst mal klar war, dann war er nett. Ich fand ihn richtig nett. Ich habe nie verstanden, weshalb Leute gesagt haben, er sei ein kratzbürstiger Nörgler, ein Stachelkaktus oder Weiß-der-Teufel was für Merkwürdigkeiten man ihm nachsagte. (…)
War Busch ein Frauentyp?
Ich glaube, dass er als junger Mann durchaus bei der Weiblichkeit begehrt war. (…) Ich glaube wirklich, dass er von den Mädels gern gemocht wurde.
Er sah gut aus, dann die Stimme und die Präsenz …
Ich meine: Er war Filmschauspieler. Er war ja wirklich bis 33 auf dem Weg, nicht nur in der proletarischen Situation, sondern auch darüber hinaus, zu einem richtigen Star zu werden.
Was war, Ihrer Meinung nach, seine größte Zeit als Künstler?
Ich glaube, die Zeit, in der er die ersten Brecht-Sachen gemacht hat, also von 1929 bis 1933: diese Wahnsinnsauftritte in den Kabaretts, diese Wahnsinnsauftritte vor Tausenden von Proleten. Dann hat er einen Film nach dem andern gemacht, hat richtig Kohle verdient. Die allermeisten, die so im proletarischen Bereich tätig waren, die hatten nichts – und er hatte immer Geld. Das war übrigens auch ein Kennzeichen zeit seines Lebens: Der hat immer Geld verdient. Und er war jemand, der, sobald er gesehen hat: einer hat nichts, dem ohne mit der Wimper zu zucken etwas gegeben hat.
Er war freigiebig.
Das ist, glaube ich, nicht das richtige Wort dafür. Wenn er gesehen hat, dass da jemand Not leidet, hat er ohne nachzufragen, „Wann krieg ich’s wieder?“ oder „Warum bist du überhaupt in diese Situation gekommen?“, ohne nachzufragen gegeben. Da ist jemand, dem muss geholfen werden – also helfe ich, so einer war das.
Wie ist er mit Ihnen umgegangen? Sie haben von Ihrem Kiel-Bonus erzählt, aber darüber hinaus?
In der Nachfolgezeit war das irgendwie selbstverständlich, wenn ich da auftauchte.
Wie hat er denn auf Ihren ersten Film reagiert?
Wir haben uns den mit ein paar Leuten in der West-Berliner Film- und Fernsehakademie angeguckt, wo ich ja Student war. Und da war er ziemlich happy, das gefiel ihm. Ich finde den auch für einen Erstlingsfilm nicht schlecht, weil er auch menschliche Momente hat – von Otto Presslers politischen Einschätzungen mal ein bisschen abgesehen. Obwohl, das geht ja auch noch …
Wie sind Sie an den Gewerkschaftler Otto Pressler (der im Film als Zeitzeuge auftritt) rangekommen?
Den kannte ich hier aus Kiel.
Es gibt ein Foto, auf dem Otto Pressler zusammen mit Irene Busch bei einer Ausstellung in Kiel zu sehen ist …
Ach ja, die hab ich ja auch noch gemacht. Das stimmt ja überhaupt (lacht).
Sie haben doch eine ganze Menge zu Busch gemacht …
Das stimmt. Aber es kommt mir alles so weit weg vor. (blättert in seinem Busch-Bildband) Den hier fand ich auch klasse: Leopold Lindtberg. Ein Regisseur, den ich damals für den zweiten Film, ich glaube, in Dänemark getroffen habe. Er hat Ende der 20er Jahre mit Busch proletarisches Theater gemacht und war später lange Jahre Regisseur in Zürich. Klasse-Typ… Mir ist das alles weit, weit weg. Ich hab in den letzten 20 Jahren dermaßen viel andere Dinge gemacht, die mir zum Teil auch viel, viel näher sind, dass mir das hier alles so weit weg erscheint. Aber die Ausstellung habe ich auch gemacht, das stimmt. Auch da habe ich übrigens nicht gesagt: Ich möchte ’ne Ausstellung machen. Sondern der damalige Kieler Kultur-Amtsleiter oder so, Dieter Opper, der leider auch nicht mehr lebt, der, nachdem er Kiel verlassen hatte, nach Bremen gegangen war und dort auch sehr gute Kulturarbeit gemacht hat, der kam mit einem sehr bekannten Kieler Kunstsammler eines schönen Tages nach Berlin zu mir und fragte, ob ich nicht mithelfen würde, in Kiel eine Busch-Ausstellung zu machen. Die Idee war, Busch in seiner Heimatstadt wieder bekannt zu machen, damit der endlich den Kulturpreis kriegt. Das heißt: diese Ausstellung als Vehikel zu benutzen, um diesen Leuten, die in irgendwelchen Kommissionen über so was abstimmen, überhaupt mal zu zeigen, wen sie da als Sohn der Stadt haben. Das haben wir gemacht. Und da hat Irene Busch auch wirklich klasse Dinge zur Verfügung gestellt.
Wann war das?
In der Zeit nach dem zweiten Film. (…) Irene war da, Busch selbst war nicht da. Die Ausstellung war im Opernhaus. Das heißt, alle Opernbesucher haben über mehrere Wochen jeden Tag auf einen proletarischen Sänger stieren müssen, der ihnen wahrscheinlich, wenn er den Mund hätte aufmachen können, gesagt hätte: „Gebt mal eure Colliers an der Kasse ab!“. Ich glaube, das war schon ’ne kleine Provokation.
Aber den Kulturpreis hat er nicht bekommen.
Stimmt, den Preis hat er nicht bekommen. Weil es nicht angehen konnte, dass jemand, der es ganz offensichtlich mit den Kommunisten hat, den Kulturpreis der Stadt Kiel bekommt.
Es gibt auch bis heute keine Ernst Busch-Straße in Kiel, auch keinen Ernst Busch-Platz. Der Taxifahrer kannte ihn nicht, in der Touristen-Information kannten sie ihn auch nicht …
Es gibt keine Straße, es gibt nichts. Ich finde das nicht so bedeutend, dass es keine Straße gibt. Aber man wundert sich halt, dass es so viele Straßen, Häuser und Plätze gibt, die nach Leuten benannt sind, die etwas zweifelhaft sind. (…)
Ist in Kiel etwas nach Gründgens benannt?
Nein, aber das ist ja auch nur eine Episode gewesen. Das muss ja auch nicht sein, dass überall, wo Gründgens aufgetaucht ist, irgendein Platz nach ihm benannt wird. (…) Die beiden haben sich aber wirklich geschätzt. Ich weiß, dass ich Busch mehrfach auf diese Geschichte angesprochen hab: Gründgens hatte ihm mal textlich ausgeholfen oder ihn getröstet oder so. Busch schenkte Gründgens darauf, das war 1921, ein Büchlein mit der Widmung „Für gute Worte – Ernst Busch“. Und dieses Büchlein hat Gründgens Busch nach 1945 zurückgeschenkt. Das fand ich ziemlich nett. Eigentlich stand ich dieser ganzen Rettungsaktion Gründgens-Busch ja immer skeptisch gegenüber und dachte: Das kann doch alles irgendwie nicht sein. Wenn man Klaus Mann („Mephisto“, JV) gelesen hat, kann man das kaum glauben. Aber es war ganz offensichtlich so. So eindimensional wie Klein-Fritzchen sich das manchmal vorstellt, sind diese Persönlichkeiten eben doch nicht. (…)
Und umgekehrt hat ja auch Busch dann nach 45 etwas für Gründgens getan und ein gutes Wort für ihn eingelegt.
Allerdings, ja. Das ist auch so ’ne Geschichte, wo ich immer dachte: Mein Gott noch mal! Es gibt Momente, da kehrst du, Busch, dein Links-Sein, dein Sozialist-Sein, dein Kommunist-Sein, obwohl ich das Wort Kommunismus bezogen auf Busch nicht so passend gefunden habe und nach wie vor glaube, dass das nicht so recht passt, aber dein Sozialist-Sein, das kehrst du immer bei verschiedensten Gelegenheiten so sehr raus, mitunter in manchen Punkten Stalinsche Härte geradezu – und ausgerechnet bei dem eben nicht. Da muss wohl viel, viel mehr mitgeschwungen haben an Menschlichkeit, als das so aus den reinen Fakten heraus ersichtlich ist. Viel, viel mehr. Ich glaube, dass das bei Busch eben auch so war, dass er ein sehr menschlicher Typ war, dem auch Sachen nahegegangen sind. Diese Rauheit , die ihm viele Leute unterstellt haben, dieses Abbügeln, was er sicherlich auch konnte, das war, glaube ich, nicht die wahre Seele. (…)
Spielte Gründgens’ Schwul-Sein für ihn eine Rolle?
Busch ist am Theater groß geworden und dass es da von Schwulen nur so wimmelte, ist völlig klar. Das war nichts Besonderes.
Ich frage, weil Busch in einem Lied, dem „Marsch ins Dritte Reich“, Röhm lächerlich macht, indem er sich an einer Stelle betont schwul gibt im Gesang …
Okay, wenn er damit den verhassten politischen Gegner niedermachen konnte, war das für ihn interessant – aber sonst nicht.
Paradoxerweise verkörperte Busch von seinem Erscheinungsbild her ja durchaus das Nordische, Deutsche, Blonde. Er war als Typ nicht nur für die Kommunisten interessant, sondern auch für die Nationalsozialisten. Für wie realistisch halten Sie die Geschichte, die Eva Busch in ihren Memoiren erzählt, dass um 1932 ein SA-Mann vor der Wohnungstür stand und gesagt hat: „Mensch, Busch, komm doch zu uns, bei uns kannste auch singen!“
Ja, das halte ich für realistisch. (…) Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen muss, dass da wirklich jemand hingeht (lacht) und an der Tür klingelt und sagt: „Komm zu uns!“. (…) Aber wenn man sich die Situation etwa auf der Straße vorstellt, dass ihn da jemand angesprochen hat: „Hallo Busch!“ oder so – das halte ich durchaus für möglich. Sie wissen ja, dass viele Proleten die SA-Uniform angezogen haben, das heißt: ihn möglicherweise oder ganz sicher auch von Veranstaltungen kannten, auf denen sie selbst mal rumgebölkt haben. Und dass die Nazis gerne das übernommen haben, was sie selbst nicht leisten konnten, wissen wir auch. (…)
Ich würde gerne etwas zu Ihrer Arbeitsweise als Autor fragen. In Ihrem ersten Buch schreiben Sie am Anfang: „Ich verfolge ausschließlich dokumentarische Absichten“. Das klingt so, als würden sie lediglich Dokumente sprechen lassen, ohne sie kommentieren zu wollen …
Das stimmt, das war so. Ich erinnere, dass ich, als ich ein paar Seiten geschrieben hatte, plötzlich eine Höllenangst bekam.
Vor dem eigenen Schreiben?
Ja. Ich hatte ’n Wahnsinns-Schiss und dachte: Um Gottes willen! Du machst hier etwas, was du gar nicht kannst. Das hast du nie gelernt! Du weißt gar nicht, wie das geht. Die Dinge hier werden dann veröffentlicht und dann wird man sagen: „Um Gottes willen, was hat der denn da gemacht? Das kann doch alles nicht wahr sein!“ Und damals war Erika Runge an der Akademie, und die mochte ich ziemlich gern. Erika hatte ja auch dokumentarische Literatur veröffentlicht. Es gab ja zu dieser Zeit die schreibenden Arbeiter und alle möglichen Sachen, irgendwelche Verlage hatten da extra Reihen für gemacht. Und sie hat dokumentarische Theaterstücke geschrieben, dokumentarisch in Anführungszeichen. Es war wenig lustvolles Theater, würde ich heute sagen. Es war eben damals so. Und ich erinnere noch, dass ich zu Erika Runge gegangen bin und gesagt habe: „Erika, ich trau mir das alles gar nicht zu, ich find das furchtbar, ich quäle mich. Ich kann das auch gar nicht, woher soll ich das auch können?“ Und sie sagt: „Mach mal, schreib mal, scheißegal …“ Ganz so hat sie’s nicht gesagt, sie war schon ’n bisschen freundlicher und hat mir Mut gemacht. Ja, dann hab ich’s gemacht und habe wohl deswegen diesen Satz da reingeschrieben, weil ich einfach Sorge hatte. Und ich kann mich nur wiederholen: Wenn ich heute vor der gleichen Situation stehen würde …na, heute würde ich es natürlich anders machen, aber … Ich hätte es besser gelassen.
Ich finde den Satz völlig in Ordnung. Ich frage mich nur, ob er nicht ein bisschen im Widerspruch steht zu dem, was Sie vorhin gesagt haben: dass es Ihnen in dieser Zeit darum ging, politisch was zu bewegen. Haben Sie nicht mehr verfolgt als nur dokumentarische Absichten? Der Tonfall im Buch ist sehr engagiert, über Busch wird ja nicht nüchtern und leidenschaftslos berichtet …
(…) Also erstens empfand ich mich als Entdecker. Und zwar weil ich, Wiederholung, weil ich ja selbst nicht wusste, dass dieser Mensch überhaupt noch lebt. Nun entdecke ich ihn. Das war wirklich für mich eine Entdeckung – so als würde man ein fremdes Land betreten. So habe ich mich in dieser Situation empfunden, mit einer Sprache konfrontiert, die man eigentlich nicht beherrscht. Es kam mir auch alles irgendwie antik vor, das muss ich auch dazu sagen. Es kam mir so vor, als würden wir, Busch und ich, über eine Zeit reden, die längst vorbei ist. Obwohl wir ganz oft auch über die Gegenwart gesprochen haben, auch da kam es mir immer vor, als sei es eine Zeit, die längst vorbei ist.
Lag es an dem Vokabular, das er benutzt hat?
Weiß der Deubel! Es lag ganz bestimmt daran, dass er für mich ein Wesen war, was in die Mitte der 70er Jahre eigentlich nicht mehr reingehörte – also eher in die 70er Jahre des vorherigen Jahrhunderts …
Wie hat er sich angezogen, wie sah er aus?
Ach, das war es nicht. So was hat für mich nie ’ne Rolle gespielt, wie jemand angezogen ist. Nein: wie er war. Aber ich glaube, es lag mehr an meinem eigenen Bewusstsein von Busch als an ihm selbst. Ich glaube, das lag mehr daran. Dass er für mich so eine Reliquie oder so was war, das klingt ziemlich böse. (…) Manches, von dem, was da gemacht wurde, hatte ja fast religiösen Charakter: unsere Vorstellungen von Revolution und diesem ganzen Krams, wozu eben diese Lieder so wie Kirchenlieder auch gehören. Mein Gott …
(Ende Kassette 1)
War Ihre Arbeit auch ein Stück Denkmalpflege?
Ein Kollege hat damals einen Film gemacht über Brecht im Exil in den USA. In Kalifornien und in New York, glaube ich, war er und hat da auch gedreht. Und ich empfand es damals ein bisschen so, dass wir, also unsere Generation, irgendwie dafür sorgen müssten, dass diese ollen Leute, die ihre Orientierung nach 1945, also in einer Zeit, wo wir eben gerade geboren worden sind, alle in der DDR oder im Osten gesucht haben und vom Westen nicht allzu viel gehalten haben – bis auf das Geld, siehe Brecht – (kichert), dass wir diejenigen sein müssten, die über diese Leute unsere Gesellschaft ein bisschen unterrichten.
Haben Sie sich in einer bestimmten Verantwortung gesehen?
Diesen Gedanken gab es damals tatsächlich.
Es gab ja auch eine Rennaissance alter linker Formen des Theaters und des Songs in dieser Zeit …
Ja, zum Beispiel diese Chöre. Unentwegt Eisler und Busch und was-weiß-ich. Einen Brecht-Chor gab es, in Essen gab es auch so was, in Bremen auch …
Heiner Goebbels kam mit seinem Linksradikalen Blasorchester …
Alles Mögliche tauchte plötzlich wieder auf. Und alle beschäftigten sich auch mit Proletkult und diesen Dingen.
Haben Sie sich als Teil einer Bewegung gefühlt?
Ich glaube: ja. Irgendwann kam dieser Gedanke: Das ist ja wohl so, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen müssen, damit das auch hier präsent ist und nicht verloren geht. In der DDR, und das hat, glaube ich, alle immer gestört, wurden diese Leute dermaßen ikonisiert, so einzementiert, dass sie ganz unbeweglich waren. Sie waren keine Menschen mehr, sondern es waren irgendwie so Zementstatuen, die man irgendwo hinstellte und „Bravo, bravo!“ rief, aber weder hörten die, noch konnten sie Laut geben, weil sie versteinert waren, das ging nicht mehr. Diese Lebendigkeit fehlte, die bei uns, glaube ich, da war. Ich glaube, wir waren ziemlich lebendige Leute in der Zeit (lacht) … allmählich sind wir alle alte Knacker …
Haben Sie mit Busch mal darüber gesprochen, über das, was Sie gerade sagen, das mit dem Einzementiert-Sein?
Nein, das habe ich mich nicht getraut.
Vorhin sagten Sie, Sie haben auch manchmal mit ihm über die Gegenwart gesprochen. Hat er mal durchblicken lassen, dass nicht alles eitel Sonnenschein ist im Sozialismus?
Ja natürlich. Ja, klar. In dem kleinen Büchlein gibt es irgendwo den Hinweis auf so’n winzigkleines Interview, was er mal irgendso’ner Kieler Schülerzeitung gegeben hat. Und das ist so schlicht und so einfach, aber ich glaube: auch so wahr, was seine Haltung angeht. Das halte ich für eine zentrale Aussage. (…) Er reduziert sozusagen den Sozialismus auf ein, zwei mini-kleine Formeln und denkt: Das isses. Also Acht-Stundentag oder solche Dinge. (…) Mir ist das nicht fremd, weil ich ja sozusagen aus dem gleichen Milieu komme, und großartige Möglichkeiten materieller Art gab’s bei uns zu Hause eben nicht.
Was haben Ihre Eltern gemacht?
Mein Vadder war auf’m Bau. Und meine Mutter war Hausfrau, wie das so war (lacht). Und dass dann jemand sagt: „Komm mir nicht mit Selbstverwirklichung oder so’m Scheiß! Hier geht’s um knochenharte Sachen: Acht Stunden, fünf Tage oder so was, Mindestlohn, so ganz konkrete Dinge“ – da hab ich mir gedacht: Ja, wahrscheinlich stimmt das. Aber diese Dinge sind im Kapitalismus ja durchaus erreichbar und sind erreicht worden. Also, was faselt ihr hier von Sozialismus? Es muss ja dann doch etwas ganz anderes sein, es muss ja eine vollkommen andere Qualität sein. Die Antwort ist Busch, finde ich, schuldig geblieben.
Und sein Leben zeigt eigentlich, dass er selbst nicht der Typ war, der sich ideal in eine Gemeinschaft einfügte, er ließ es sich auch nicht schlecht gehen …
Das fand ich übrigens an ihm positiv, das mochte ich sehr. Also auf den Fotos … So wie ich ihn kennengelernt hab, hat er nun auf sein Äußeres nicht mehr allzu viel geachtet. Aber auf den Fotos, fand ich auch immer, hatte er für seine Zeit ordentliche Klamotten an. (…) Dass jemand sagt: „Ich bin Sozialist!“, und läuft nicht in Sack und Asche rum, fand ich schon mal ganz gut. Und dass jemand sagt: „Ich bin Sozialist!“, und muss nicht jeden Tag Frikadellen futtern oder so, fand ich auch gut. Sondern dass das Leben überhaupt ganz angenehm sein kann oder das man es sich so machen kann. Dass man nicht zu jedem Scheiß Ja und Amen sagt, das waren alles Dinge, die ich an ihm ziemlich klasse fand. Und was ich künstlerisch an ihm gut fand, ich bin ja auch zu Proben und Schallplatten aufnahmen ab und an mal mit gewesen, er hat ja damals Gott sei Dank noch was gemacht, sodass ich das noch erleben konnte, ich habe es ja leider nie erlebt, wie er so auf der Bühne war, außer was filmisch durch die kleinen übriggebliebenen Schnipsel noch zu sehen ist. Aber ich hab eben erlebt, wie er da diese Aufnahmen machte und habe gesehen, dass jemand, der gut sein will, in jedem Detail versucht, gut sein zu müssen. Und das ist etwas, was ich mir ein bisschen zu Herzen genommen habe. Was ich versuche, bei dem bisschen Zeugs, was ich so mache, auch zu machen. Und nicht zu sagen: „Ach komm, es versendet sich, das lassen wir mal so“. Solange man einen Fehler erkennt, den auch so zu benennen und zu sagen: „Wir machen ihn weg!“, bevor wir’s in die Welt schaffen.
Ein Perfektionist war er bestimmt.
Ich weiß nicht, ob man das Perfektionist nennen kann. Jedenfalls jemand, der seine Sache so gut machen wollte, wie er es eben konnte. Und das finde ich etwas, was man, wenn man so privilegiert arbeiten kann wie wir, sozusagen denjenigen, die das bezahlen, schuldig ist. Und das ist etwas, was ich gerne von dem angenommen hab. (…)
Hat Busch eigentlich in Ihrem Beisein Alkohol getrunken?
Während wir gedreht haben: nie. Kaffee haben wir immer getrunken.
Es gibt einige Leute, die sagen, dass er zeitweise ein Alkoholproblem gehabt hätte …
Das hatte er auch mal, glaube ich.
Eva Busch wiederum schreibt in ihren Memoiren, er hätte Alkohol nie angerührt, hätte immer nur Milch getrunken, was sie immer unmöglich gefunden hätte …
Ach Quatsch! Also, ganz am Anfang mag das so gewesen sein: Ich hab Leute kennengelernt, die mit ihm hier in der Arbeiterjugend umgegangen sind, und da war das ja verpönt. Alkohol und Nikotin waren verpönt. Kein Stück! Wer Alkohol gesoffen hat, der konnte zu irgendwelchen Trulala-Truppen gehen, aber nicht in die Arbeiterjugend. Der wurde ausgelacht (lacht). Und dann hat er, glaube ich, aber auch eine Phase gehabt, ich meine, dass das in den ersten DDR-Jahren gewesen sein muss, wo er so’n bisschen gesoffen hat, ich glaube, ja. Aber das kann ich nicht genau sagen. Ich habe ihn saufend jedenfalls nicht erlebt. An seinen Geburtstagen hat er an den Gläsern nur genippt.
Eva Kemlein sagt, dass er ein sehr treuer Mensch war: verflossenen Liebschaften oder alten Freunden gegenüber …
Bestimmt. Er hat bestimmt nie jemanden verraten oder gesagt: Den kenn ich nicht, oder so.
Und er hat auch immer Kontakt gehalten zu seiner ersten Frau Eva Busch, als sie längst in Paris mit einer Frau zusammen lebte. War das eine Art von Harmoniebedürfnis?
Nein, ich glaube, das gehört in die Abteilung „Treue Seele“. Wen er einmal in sein Herz geschlossen hatte, der blieb da drin.
Galt das auch umgekehrt? Wenn einer bei ihm mal richtig unten durch war, dann blieb das so …
Das vermute ich, das weiß ich nicht so genau.
Ich dachte jetzt an sein Verhältnis zu Honecker, das ja von Anfang an nicht besonders harmonisch war …
Ich glaube, dass er den Honecker ziemlich lächerlich fand.
Das hätte er Ihnen gegenüber aber nicht gesagt, oder?
Nein!
Hat er sich überhaupt mal DDR-kritisch geäußert Ihnen gegenüber?
Ich erinnere einen Spaziergang, den wir beide mal in seiner Wohngegend gemacht haben, wo ich den Eindruck hatte, dass er sagen wollte: „Eigentlich finde ich das ziemlich lächerlich, dieses ganze Theater, was hier ständig veranstaltet wird“. Das, was die DDR sich da als äußeren Rahmen ständig geben musste oder glaubte, sich geben zu müssen: dieser ganze Blödsinn, den sie da veranstaltet haben, ich glaube, dass das etwas war, was er einfach lächerlich fand und dementsprechend auch die agierenden Figuren lächerlich fand, also dieses ganze komische Politbüro. Ich hatte nie das Gefühl, dass er die besonders ernst genommen hat.
Er ist ja dennoch bei offiziellen Veranstaltungen immer wieder aufgetreten. Warum hat er das gemacht? Hat er nur noch in solchen Runden seine Kunst zeigen können?
Das ist bestimmt ein Teil der Erklärung: dass er keine anderen Auftrittsmöglichkeiten mehr hatte … Obwohl, ich kann mich erinnern, dass es diesen Auftritt gab, von dem er Wochen vorher ständig gesprochen hatte mit diesem „Lied vom Klassenfeind“.
Das muss einer der letzten öffentlichen Auftritte gewesen sein. Das war in der Akademie der Künste 1977.
Ich erinnere mich, dass er wahnsinnig nervös war. Unglaublich! Und da dachte ich noch: „Mein Gott, du bist doch ’n abgeklärter Heini, du hast doch wirklich vor größeren Leuten geschauspielert und so.“ (…) (wir nehmen den Bildband zur Hand und blättern zu der Stelle mit dem Bild von besagtem Auftritt und kommen auf Siebigs Fotos zu sprechen)
Die Fotos, die ihn privat in seinem Garten zeigen, sind sehr schön: Busch mit Lederjacke und seinem französischen Käppi. Ich finde ja schon, dass Kleidung eine Menge aussagt darüber, wie jemand gesehen werden will. Auch wenn Sie sagen, Kleidung hätte Sie nie besonders interessiert. Brecht hat ja auch diese Fotos machen lassen, wo er mit Lederjacke und Zigarre posiert. Es gibt so ’ne gewisse linke Ästhetik, so ’n linker Revoluzzer-Chic, der sich durchzieht und der Einfluss hatte auf verschiedene Subkulturen. Und Busch mit seiner Jacke und seinem Käppi passt da schon rein …
Also mit dem Käppi hat er immer so rumgespielt: also bisschen weiter rein ins Gesicht und wieder zurückgeschoben und so. Das hat er irgendwie als Clowns-Kappe genutzt. Ob diese Lederjacke sozusagen Ausdruck eines irgendwie gearteten proletarischen Chics sein sollte (lacht), weiß ich nicht. Ich vermute eher, dass Irene für solche Dinge zuständig war.
In einem Brief habe ich gelesen, dass Eva Busch ab und an modische Dinge aus Paris rübergeschickt hat …
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass er, wenn er solche Geschenke je zu Gesicht bekommen hat, wahrscheinlich gelächelt hat … Ja, ein netter Mensch, das war er. Großer Künstler.
Können Sie die Lieder noch hören?
Nee. Ich hab, glaub ich, seit Jahren nichts mehr gehört. Also die Lieder find ich … bis auf manches … Es gibt da eine Platte mit Liedern, die erst ganz, ganz spät in der DDR erschienen ist …
Haben Sie sich die CDs gekauft?
Nein. Das interessiert mich auch wirklich überhaupt nicht mehr. Ich hab übrigens auch vieles weggegeben. Als ich hier einzog, war hier alles voller Bücher und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich hab dann hier einen befreundeten Antiquar angerufen und hab gesagt: „Du kannst mit dem größten Auto kommen, das du hast und kannst einpacken, was du willst“. Und das hat er natürlich auch gemacht (lacht). Und wenn ich nicht ’n paar Platten hätte, wo Busch mir ’n bisschen was reingeschrieben hat, dann wären die auch weg.
Und Ihre Arbeitsmaterialien? Haben Sie die auch ins Archiv nach Schleswig gegeben?
Von den Filmen hab ich ’ne ganze Menge nach Schleswig gegeben: also sogenannte Schnittreste, aber auch Dinge, die wir aus Verständlichkeitsgründen gar nicht nutzen konnten. Das mit Werner Finck hatte ich Ihnen ja mal erzählt: Der hatte gerade diese Kiefernoperation gehabt und gab so’n kauderwelschiges Zeug von sich (imitiert Finck).
Wäre es interessant gewesen, wenn man es verstanden hätte?
Ich glaube, das sind all die Dinge, die er in diversesten Büchern auch schon mal beschrieben hat.
Meinen Sie, es lohnt sich, die Materialien in Schleswig einzusehen?
Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Ich hab zum Beispiel keine Vorstellung mehr, was Mehring noch erzählt hat, mit dem haben wir ja auch gesprochen …
Das ist auch in Schleswig?
Ja, ja. Das habe ich alles dem Filmarchiv dort geschenkt. (…) Da es ja keine fertigen Sachen sind, sondern eben tonnenweise Filmreste in Kisten oder Filmbüchsen, bedeutet das, dass die mindestens zweistreifig sind, das heißt: Ton und Bild sind getrennt und sind auf so kleinen Röllchen drauf.
Das ist mühselig.
Das ist super-mühselig! Was mich heute noch daran interessieren würde, wäre: Was hat Mehring eigentlich alles erzählt? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Was hat Leopold Lindtberg, den ich, wie gesagt, sehr schätze, was hat der eigentlich noch erzählt? Über das hinaus, was im Film drin ist – und das ist ja nicht allzu viel. Das sind all die Sachen, die zum zweiten Film gemacht worden sind. Mit wem haben wir denn da noch geschnackt?
Um das mal klar zu kriegen: In Schleswig findet man Reste des ersten und zweiten Films auf 16mm-Material?
Ja, wahrscheinlich auch vom ersten Film. Die haben einen Schneidetisch da. Das bedeutet in jedem Fall, dass da jemand an den Schneidetisch mit ran muss (…) und das kostet bestimmt, das werden die mit Sicherheit nicht umsonst machen. Und ich hab keinerlei Aufzeichnungen darüber. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hab irgendwann, als ich eine Wohnung räumen musste und der ganze Keller voll war mit Filmdosen und ich dachte, ich kann das ganze Zeug nicht dauernd mit mir rumschleppen, gesagt: „Schleswig, wenn ihr wollt, könnt Ihr ’s haben“. Dann ham die gesagt: „Okay, wir nehmen ’s.“ (…) Ich hab auch noch so ’n Umzugskarton voll, mindestens einen, wenn nicht zwei, mit Fotos und irgendwelchen Unterlagen, die ich dem Stadtarchiv in Kiel überlassen wollte. Und die haben gesagt: Ach, lassense mal … Deswegen hab ich das noch.
Darf ich da mal reingucken?
Puh, das steht im Keller. Das ist ein riesengroßer Papierkorb.
Sie wollten doch Platz schaffen, dachte ich …
Also, nicht im Sinne von: Bedien dich mal …
Nein, natürlich nicht. Aber wenn Sie bei Gelegenheit vielleicht den Keller sowieso umräumen, dann würde ich ja gerne mal reingucken …
Es sind sicher keine Dinge, die überraschend neu wären, das sicher nicht. Keine Sensatiönchen: dass da irgendwo ein Brief gefunden wird, in dem Busch sagt: „Honecker, das Schwein muss man …“, oder so was. (…) Wenn Sie so weit sind (mit der Veröffentlichung, JV) und sagen: „Ich möchte dieses oder jenes Foto haben“, bei dem ich die Rechte oder die Urheberschaft habe, dann sagen sie ’s, und dann kriegen Sie ’s.
Aber in diesem Karton sind jetzt keine Fotos, die noch nicht in Ihren Büchern vorkommen?
Doch. Ich hab mal so ’n Mittelformat fotografiert, mit ’ner Hasselblad: Busch in Farbe in so ’nem Tonstudio. Da müsste es ’ne ganze Menge geben, bestimmt 30, 40, 50 Stück.
Das klingt ziemlich interessant.
Wenn ich da was finde, dann kriegen Sie ’s.
Das freut mich. Es ist ja nicht so, dass ich die absolute Vollständigkeit anstrebe. Ich glaube auch, wie Sie gesagt haben, dass es die gar nicht gibt …
Interessant finde ich, was Sie mir heute Vormittag, als wir in die Stadt reinfuhren, sagten. Dass Sie die künstlerische und die propagandistische Seite dieser Sachen untersuchen wollen. Das finde ich wirklich ein spannendes Thema, weil das eben auch unabhängig von dieser Figur Busch grundsätzlich spannend ist: wie kreative Menschen mit dem einen und dem andern umgehen. Das finde ich schon ’ne wichtige Frage. (…) Bei Busch kommt hinzu, dass er ja auch selbst zur Feder gegriffen hat, manchmal hätte er es besser bleiben lassen, aber er hat ’s ja nun mal getan. Ich glaube, eine seiner Leistungen besteht darin, von Interpretation mal ganz abgesehen und einem solchen Zusammenhang, mit dem, was man Propaganda nennen kann, dass er Texter und Musiker zusammengebracht hat. Dass es ihm gelungen ist zu sagen: „Du schreibst jetzt den Text und du machst dazu die Musik“. Eine Konstellation, die manche vorzügliche Sache hervorgebracht hat. Das ist eine seiner wichtigen Leistungen – unabhängig von dieser Frage der Propaganda.
„Antreiber“ nennen Sie ihn in Ihrem zweiten Buch.
Ja, ja, so hat er sich auch selbst gerne gesehen, vielleicht auch ein bisschen sehr Ich-bezogen. Ich glaube, der Eisler hätte es auch ohne Busch gemacht. Aber Busch war eben derjenige, der sagte: „Hier haste 50 Mark und jetzt mach das!“ Ich glaube, dass das keine Legende ist. Ich glaube, dass das wirklich so gewesen ist. Ich glaube wirklich, dass dieses arme Schwein Eisler so weit war, dass er sagte: „Okay, pro Note oder Takt ’ne Mark“ (Lachen). Das ist das, was bleibt. Und dieses Zeugs, was er da zum Teil dazugedichtet hat, das ist ein Nichts. Also, ich meine, mit welcher Unbefangenheit er auch Brecht-Texte umgemodelt hat, das war schon erstaunlich.
Dieses Anpassen an politische Situationen, das war ja auch eine Brechtsche Eigenart.
Ja, ja. Brecht hat ihm das offensichtlich nicht allzu übel genommen. Ich glaub, Busch hat mir sogar irgendwann so ’n Zettel gezeigt, auf dem Brecht geschrieben hatte: „Du darfst“. Auch Tucholsky fand das in Ordnung. Darauf war Busch immer ziemlich stolz. Wie ein Kind, das Spielzeug vorzeigt. Guck mal, ich hab noch ’nen Karton gefunden. Oder schau mal, der hat geschrieben: Ich darf das alles … Er fühlte sich geehrt dadurch. (…)
Bereits in der Weimarer Republik hatte er verschiedene mehr oder wenige schmeichelhafte Beinamen. „Barrikaden-Tauber“ ist der bekannteste. War Busch auch ein Selbstvermarktungsgenie?
Stimmt, ja. Und er hat auch mit Sicherheit nie gesagt: „Ach komm, ihr habt kein Geld, dann trete ich halt umsonst auf“. Während viele andere, nur um überhaupt mal irgendwo im Rampenlicht stehen zu dürfen, gesagt haben: „Ich mach das umsonst“. Albert Venohr fällt mir da ein, der schon lange nicht mehr lebt und bestimmt ein vorzüglicher Schauspieler gewesen ist. Der lebte auch in diesem Künstlerviertel am Laubenheimer Platz, da hab ich den mal besucht, da war der schon uralt. Und der gehörte zu denjenigen, die gesagt haben: „Och, wenn ihr mich so fragt, dann komm ich auch gerne mal umsonst“. Das hat er mit Sicherheit gemacht. Busch nie, da bin ich ganz sicher. (…)
Lassen Sie uns noch kurz über die Zeit unmittelbar nach 1945 reden. Eva Kemlein sagt, es sei sonnenklar gewesen für Busch, in die SBZ/DDR zu gehen. War der Westen für ihn nicht interessant?
Das wichtigste war: Schauspieler zu sein. Der Gesang war da nicht so bedeutend. Das wichtigste war, Schauspieler zu sein. Das heißt, wenn es geht, die Zusammenarbeit mit den für ihn wichtigen Leuten fortzusetzen. Die war ja 33 abrupt abgeschnitten worden. Dass Brecht dann die Möglichkeit hatte, in der DDR seine Bühne aufzubauen und irgendwann der Eisler angerollt kam, das war dann alles wunderbar. Das war das Wichtige: Schauspielerei. (…)
In Ihrem Buch erwähnen Sie einen Italien-Aufenthalt Buschs von Kiel aus mit Walter Poller. Der sagt mir gar nichts. Sie schreiben, dass er Autor einer Publikation ist: „Arztschreiber in Buchenwald“ …
Das ist so ein Büchlein über seine KZ-Haft. Da war noch jemand dabei, Karl Martens. Das ist übrigens eine interessante Figur. Lebt längst nicht mehr. Lotte Martens, die hab ich mal in Geestacht aufgesucht, die war damals auch schon um die 70. Dieser Martens war ein lebenslustiger, sehr intelligenter und wissensdurstiger Mensch. Der hat, glaub ich, mit Mao Tse Tung den langen Marsch mitgemacht. Der war dann in China so ’n bisschen Regierungsberater in manchen Phasen. Hat also wirklich ’ne Menge erlebt.
Was war der von Beruf?
Nichts. Das waren drei Jungs, die sagten: „So, jetzt gehen wir in die Welt!“. Ich glaube, Karl Martens ist als einziger in Italien geblieben und von da aus aufs Schiff und in die Welt.
Und Walter Poller?
Kieler Arbeiterjugend, da kamen sie alle drei her. Und Walter Poller? Puh, irgendjemanden hatte ich mal kennengelernt, der mir über den Lebensweg von dem was erzählt hat … Aber das weiß ich jetzt nicht mehr.
Dann wollte ich noch gerne wissen, ob Sie sich noch an den holländischen Journalisten Rudie Kargie erinnern, aus dessen Interview mit Busch Sie in Ihrem Buch zitieren …
Ich weiß nicht mehr, ob das der Journalist war, der mich in Berlin ein paar Mal besucht hat und mir ständig irgendwelchen uralten Amsterdamer Käse mitgebracht hat.
Wie nett.
Kann sein, das der das war. Kann ich nicht mehr genau sagen. Weil mir aus dieser Ecke, aus Belgien, glaube ich, auch ein Mann und eine Frau ewig lange geschrieben haben (Lotti Relecom?). Wir hatten uns mal bei Busch getroffen. (…)
Interessant finde ich, dass Busch auch, und das wurde in der DDR ja eher unter den Teppich gekehrt, in den frühen 30er Jahren Schlager gemacht hat und absolut unpolitische Unterhaltungsprogramme.
Ja. Wenn die Situation sich 33 nicht so dermaßen geändert hätte, dann hätte der so ’n Krams auch weiter gemacht.
Haben Sie ein Lieblingslied von Busch?
„Min Jehann“ mag ich ziemlich gerne.
Interview: Jochen Voit
(Autorisierung Karl Siebig am 8. 10. 2005)

Klaus Steiniger
über den Antifaschismus-Bonus in der DDR, über linke Lieder als Erkennungszeichen und den Ernst Busch-Song "Ami go home!"
„Ernst Busch war der angesehenste Künstler der DDR“
(Gespräch am 18. Januar 2005 in Berlin)
Der Kontakt zu dem Journalisten Dr. Klaus Steiniger (73) war über Roger Reinsch vom Freundeskreis Ernst Busch e.V zustande gekommen. Der ehemalige Auslandskorrespondent des ND (u.a. USA, Sowjetunion, Portugal) und jetzige Chefredakteur der Zeitschrift RotFuchs wohnt in einer bescheidenen Wohnung am Stadtrand von Berlin. Unser Gespräch dauert an die drei Stunden, die erste Hälfte habe ich aufgezeichnet.
JV: Herr Steiniger, zu Beginn unseres Gesprächs möchte ich Sie bitten, dass sie ein wenig von sich erzählen. Sie haben gesagt, Sie sind Jahrgang 1932 …
Dr. Klaus Steiniger: Ja, Dezember 32, letztes Aufgebot der Weimarer Republik. Mein Vater war Jurist, hatte in Bonn promoviert und war die letzten Jahrzehnte Professor an der Humboldt-Universität. Vor 1933 war er kurze Zeit Anwalt – 33 ist er aus der Anwaltskammer rausgeflogen. 1935 wurde ihm die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt.
Wegen seiner politischen Einstellung?
Wegen seiner politischen Einstellung und auch aus rassischen Gründen, er war Halbjude. Ich wurde als Kind dadurch auch staatenlos. 1937 haben wir beide die tschechoslowakische Staatsangehörigkeit angenommen, weil die Verwandtschaft meines Vaters aus Böhmen stammte. Die hatten die tschechische Staatsangehörigkeit, und auf diese Weise gelang es, die tschechische zu bekommen. Das war aber ein kurzer Spaß, denn 1938 wurde die Tschechoslowakei besetzt. Und damit fiel der tschechoslowakische Staat, und damit gab ’s auch keine Staatsangehörigkeit mehr, wir wurden wieder staatenlos. Und 45 haben wir dann beide Staatsangehörigkeiten wieder erworben, dadurch dass die Nazi-Gesetze weggefallen waren und dadurch, dass der tschoslowakische Staat wiederhergestellt worden war. Die Doppelstaatsangehörigkeit hatten wir dann bis 1949, mit Gründung der DDR haben wir die tschechoslowakische Staatsangehörigkeit zurückgegeben.
Eine ungewöhnliche Konstellation …
Ja, ich war sogenannter Mischling zweiten Grades, was mich nie interessiert hat – wir waren keine religiösen Juden oder so etwas. Aber 1943 musste ich die Schule verlassen, eine höhere Schule …
Wo waren Sie auf der Schule?
Heute heißt das Leniagura, damals hieß das Hirschberg im Riesengebirge, im jetzt polnischen Riesengebirge. Da bin ich auf ein Gymnasium gegangen und musste dann die Schule verlassen. Und 1945 hat sich dann mein Vater nach dem Schicksal seiner sämtlichen böhmischen Verwandten erkundigt, also seiner Cousinen und Cousins, Onkels und Tanten – und die waren alle in Auschwitz vergast worden. Insgesamt 15 Personen, die sind auch in … Wie heißt die israelische Gedenkstätte?
Yad Vashem.
Yad Vashem, ja. Da sind die alle registriert. Wir haben uns da mal erkundigt. (…) Ich gehe davon aus, dass deutsche Juden im Wesentlichen assimiliert waren. Das Problem hätte uns überhaupt nicht interessiert oder sonderlich tangiert, wäre nicht der Antisemitismus der Nazis gewesen, der dann zu diesen außerordentlichen Folgen geführt hat.
Ihr Vater hatte nie die Idee auszuwandern, war kein Anhänger zionistischer Ideen?
Nein, er hat nie zionistische Ideen gehabt. Mein Vater war Kommunist. Und er war das schon vor 1933.
Sie sagen, er war Jurist. Hatte er einen proletarischen Hintergrund?
Nein, er kommt aus einer kleinstbürgerlichen Familie. Der Vater nannte sich Kaufmann, war aber ein reisender Vertreter, der mit einem Koffer unterwegs war und irgendwelchen Geschäftsleuten irgendwelche Muster anbot. Also Kleinst-Kleinbürgertum. (…)
Wissen Sie, wie Ihr Vater mit der kommunistischen Idee in Berührung kam?
Vor 33 hatte er ziemlich viel zu tun mit der „Weltbühne“, hat für die geschrieben, war dann im Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. (…) Er war ein linksintellektueller Antifaschist. (…) Ich habe nach 1945 dann auch sehr viel für die wiedererstandene „Weltbühne“ geschrieben. Heute gibt es zwei Nachfolgezeitschriften, die so ähnlich aussehen: Die eine heißt „Ossietzky“, die andere heißt „Das Blättchen“, das sind zwei miteinander konkurrierende Nachfolgepublikationen der „Weltbühne“.
Wann haben Sie zum ersten Mal von Busch gehört?
Mein Vater hatte mehrere Platten von ihm. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind diese Platten gehört habe. Ich erinnere mich an die „Ballade von den Säckeschmeißern“.
Sie hatten also ein Grammophon zu Hause?
Ja, mein Vater hatte die Schellacks und ein Grammophon. Und auf diesem Grammophon habe ich auch Busch-Platten vor 45 abgespielt. (…) Also Busch war mir schon als Kind ein Begriff, ohne dass ich damit viel verbinden konnte. Aber mein Vater sagte mir, das sei einer der großen Sänger der Weimarer Republik gewesen und so weiter. Da gab es ein Lied von den Arbeitslosen, daran erinnere ich mich auch. Mein Vater hatte jedenfalls mehrere davon. (…) Und er hat sie über die Nazi-Zeit gerettet. (…)
Nach dem Krieg zogen Sie dann nach Treptow …
Nein, wir wohnten zunächst am Botanischen Garten, zwischen Steglitz und Botanischem Garten. Wir wohnten wieder in derselben Straße, in der wir schon mal gewohnt hatten, ganz früher. Dort ist übrigens lustigerweise die erste Verfassung der DDR geschrieben worden, in West-Berlin. Mein Vater war der Sekretär des Verfassungsausschusses des deutschen Volksrates, und aus dem deutschen Volksrat entstand dann die provisorische Volkskammer der DDR. Der Vorsitzende des Verfassungsausschusses des deutschen Volksrates war Otto Grotewohl, und er war der Sekretär. Und da die Sekretäre die Arbeit zu machen pflegen, hat er dann weitgehend in unserer West-Berliner Wohnung in der Hortensienstraße 55 am Bahnhof Botanischer Garten die erste Verfassung der DDR geschrieben. Mit anderen Experten zusammen. (…) (Exkurs über die Aufbaugeneration in der DDR; die führenden Leute seien aus der sowjetischen Emigration gekommen, aber auch aus der West-Emigration, aus Konzentrationslagern und der Illegalität)
Wann sind Sie Busch zum ersten Mal begegnet?
49. Im Sommer 49 zogen wir nach Ost-Berlin. Meine Mutter war gestorben, und wir waren nun alleine. Und mein Vater hatte eine Professur an der Ost-Berliner Humboldt-Universität. Also lag es nahe, dass er dort hinzog. Und da hat er eine Wohnung in Treptow zugewiesen bekommen in diesem sogenannten Aufbauschwerpunkt 5. Die Straße hieß Dammweg, das war ’ne etwas längere Straße, und an der Straße war so ’ne Flachdachsiedlung gelegen. Und das waren kleine Wohnungen, für damalige Zeiten wahrscheinlich Luxus. Aber es waren Wohnungen, die zweieinhalb Zimmer hatten. Auf jeder Etage war ein Zimmer.
Das war der Standard?
Das war der Standard, die waren alle gleich. Es waren immer fünf Häuser zusammen in einer Reihe. Und Busch hatte auch so ’n Haus, genau die gleiche Ausstattung. (…) Es waren sehr bescheidene kleine Reihenhäuser – also nicht vergleichbar mit dem, was Busch dann später hatte. Es gab unten ein Zimmer mit ’ner Terrasse und winzigem Garten. Also es gab unten ein Zimmer und die Küche. Untendrunter gab’s ’nen Keller. Dann gab ’s im ersten Stock ein Zimmer und das Bad. Und im zweiten Stock war noch mal so ’n halbes Zimmer und ’ne Kammer.
Die Siedlung gibt ’s noch, oder?
Die gibt ’s noch, die kann man besichtigen. Und das war in keiner Weise ghettoisiert oder so …
War die neu gebaut worden?
Die Häuser waren wieder aufgebaut worden. Die waren ausgebombt. Die hatte es auch in der Nazi-Zeit gegeben. Das war, nach dem, was uns erzählt wurde, eine SS-Siedlung gewesen. Und die war total ausgebombt. Ich weiß nicht, ob da einzelne Häuser überdauert hatten. Jedenfalls als wir dort einzogen, standen da große Schilder, da stand drauf: „Aufbauschwerpunkt 5“. Wir waren die ersten, die dort einzogen. Wobei wir zu einem Zeitpunkt einzogen, zu dem die anderen Häuser schon bewohnt waren. Der Busch war auch schon da. Bei uns in unserer Reihe wohnte ein Mann, den ich aus dem Krieg kannte: Professor Bittel, der auch bei den Nazis gesessen hat, einer der Mitbegründer der KPD 1918. Der hatte mich im März 43 an den Bodensee mitgenommen, wo seine Frau eine Handweberei betrieb. Damals war er noch kein Professor, sondern einfach Karl Bittel, der wohnte mit uns in derselben Reihe, das war reiner Zufall. Und unsere unmittelbaren Nachbarn waren der Staatssekretär für Chemie und das andere war der Vorsitzende der Gewerkschaft Handel und Versorgung. Dann kam die nächste Reihe, da wohnte Busch und sein Nachbar, ich glaube sogar sein unmittelbarer, war Willi Stoph, der immer mit der Taschenlampe im Garten nach Regenwürmern suchte.
War der Angler?
Der war Angler. Das spielte sich alles sehr normal ab. Willi Stoph war damals kein Ministerpräsident und nichts dergleichen, sondern er war im Sekretariat des Parteivorstands der SED für Wirtschaftspolitik verantwortlich. Das war damals alles sehr in den Anfängen.
Alles Antifaschisten …
Die kamen alle aus dieser Schule.
Da tanzte auch keiner aus der Reihe – keiner, über den man sagte: „Das war aber mal ’n Nazi“?
Nein, das gab’s gar nicht. Der hätte auch keine Wohnung dort bekommen.
Musste man bestimmte Beziehungen haben, um dort ein Häuschen zu kriegen?
Also, mein Vater hat keinerlei Beziehungen eingesetzt, sondern sie haben gesagt, er solle übersiedeln nach Ost-Berlin. Das wollte er auch. Er war ja Abgeordneter dieser Gründungsvolkskammer der DDR, und diese Gründungsvolkskammer sollte nach Möglichkeit bei Gründung der DDR in Ost-Berlin versammelt sein. Und deshalb wurde ihm geraten überzusiedeln. Er war sowieso nach dem Tod meiner Mutter ein bisschen wurzellos geworden und hat das sofort gemacht.
Ihm hat sich nicht die Frage gestellt, da sich ja eine Spaltung abzeichnete, eventuell im Westen zu bleiben?
Diese Spaltung zeichnete sich eben noch nicht ab. Damals gab’s noch einen einheitlichen Berliner Magistrat. Es gab zwar schon ’ne politische Spaltung, aber noch keine territoriale.
Hat Ihr Vater sich mal dazu geäußert, wie sehr ihm die eine Besatzungsmacht näher stand als die andere?
Mein Vater war Kommunist und deshalb natürlich auf die Rote Armee festgelegt. Das war schon vor 33 für ihn eine klare Orientierung gewesen: die Sowjetunion.
Hat er das auch während des Krieges formuliert, dass er auf dieser Seite stand, dass er der Sowjetunion möglichst bald den Sieg wünschte?
Natürlich, natürlich. Ich hab noch ’ne Idee, wie Sie etwas mehr über mich erfahren können: Ich habe nämlich dieses Buch hier geschrieben (überreicht mir seine aktuelle Veröffentlichung). (…)
Zu Ihrer Begegnung mit Ernst Busch: Am Telefon sagten Sie mir, dass Sie und Ihr Vater dabei waren, als Busch sein Lied „Ami go home!“ kreierte. Wie hat sich das denn zugetragen?
Busch hatte einen sehr engen Draht zu meinem Vater. Die hatten sich gleich kennengelernt …
Übern Gartenzaun?
Na ja, übern Gartenzaun nicht. Das war die nächste Reihe, die Eingangstüren lagen auf der anderen Seite, wir mussten dann da so rumlaufen. Und eines Tages rief er meinen Vater an und sagte: „Ich bin hier gerade beim Dichten eines Liedes. Willst du nicht mal vorbeikommen?“ Und da war noch ein Schauspieler da, der hieß Ernst Kahler, der spielte damals am Deutschen Theater. Im Deutschen Theater gab es ja damals das Berliner Ensemble – die hatten noch keine eigene Bühne. Das Theater am Schiffbauerdamm hieß damals noch Theater am Schiffbauerdamm. Und das Berliner Ensemble spielte im Deutschen Theater. Und da spielte der auch, glaub ich, der Kahler. Busch und er waren Kollegen. (…) Ich weiß, dass Busch zu Anfang erhebliche Schwierigkeiten hatte durch seine Gesichtslähmung. Er sang nur gelegentlich mal und war noch nicht der große Schauspieler, als der er dann später bekannt geworden ist.
Er rief also Ihren Vater an. Das heißt ja, dass er Ihrem Vater vertraute …
Ich will das jetzt nicht überhöhen, aber es war einfach so: Mein Vater war damals sehr bekannt, hatte sehr viele Kontakte zu zig Leuten, war einer der bekanntesten linken Intellektuellen in Berlin. Und er war der erste Marxist, der ein juristisches Katheder bekam, also er war der erste Marxist, der an einer deutschen Universität eine Professur bekam. Das war 1946.
Im selben Jahr hat ja Busch die Lizenz für seine Plattenfirma Lied der Zeit bekommen …
Ja, es ging auch immer um Lied der Zeit in den Gesprächen der beiden.
Hat Ihr Vater den Busch auch juristisch beraten in der Zeit?
Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die sich sehr oft getroffen haben, sehr oft sich miteinander unterhalten haben. Wobei sich das später verlor, als Busch wegzog und mein Vater alle möglichen anderen Aufgaben hatte, der war dann im Weltfriedensrat und anderen Geschichten, dadurch haben sie sich nur noch selten mal gesehen …
Jetzt sind wir abgekommen von der Geschichte. Also: Busch rief an …
Busch rief an und sagte: „Ich bin hier beim Dichten eines Liedes. Willst Du nicht mal vorbeikommen?“ Und es war so: Mein Vater hat mich damals überall mithingenommen, ich war 16 oder 17. Und nach dem Tode meiner Mutter, die starb ganz jung mit 39 Jahren an Tuberkulose, hat er mich überall, auch zu Empfängen und zu solchen Geschichten mitgenommen, wo ich eigentlich gar nichts zu suchen gehabt hätte. So habe ich dann Busch kennengelernt. (…) Da war auch der Kahler anwesend. Ich hatte so gut wie noch nie einen Schauspieler gesehen, das war für mich damals sehr sensationell – es hat sich mir jedenfalls tief eingeprägt, dass das ein Schauspieler war. Ich war mit 16 Jahren noch in West-Berlin in die Partei eingetreten.
Das war dann nicht mehr die KPD, sondern bereits die SED?
Die SED, die gab ’s auch in West-Berlin. Das war nach der KPD-Zeit: 48 bin ich eingetreten, 46 hatte die KPD aufgehört zu existieren, da kam die Vereinigung. Ich bin dann als Jugendvertreter zur Parteileitung gekommen. Und die Parteileitung musste wieder irgendeine Veranstaltung machen, und Busch wurde vorgeschlagen und Harry Hindemith, ein anderer Schauspieler, der in der frühen DDR-Zeit sehr bekannt war, in einer Reihe von Filmen mitgespielt hat, kein großer Schauspieler, aber mit einer sehr einprägsamen Stimme – die beiden wollten wir einladen zu der Versammlung, dass die mal dort auftreten. Und das wurde dann auch akzeptiert. Wir haben uns dann an Busch gewandt (…), und Busch hat dann im Treptower Rathaus, dort tagte diese Parteigruppe, gesungen und Harry Hindemith hat rezitiert. Das wäre aus späterer Sicht ’ne absolute Sensation gewesen, damals war das gar keine Sensation: Man ging eben zu den Leuten hin und sagte: „Kannste nich mal machen?“ Und dann machten die das.
Was war das für eine Versammlung?
Die Parteiversammlung fand statt so auf halber Kellerebene im Tiefgeschoss des Treptower Rathauses. Das war 1949.
Sie kannten Busch damals bereits ja aus der Nachbarschaft …
Die Tatsache, dass er dieses Buch (zeigt ein Liederbuch) 1950 signiert hat, zeigt, dass es von 1949 bis 50 dann weiterging.
Haben Sie Busch auch deswegen angesprochen oder ansprechen lassen, weil Sie wussten: Der wohnt ums Eck und ist greifbar?
Ja. Und Busch war außerordentlich kommunikativ und freundlich und ging auf junge Leute zu.
Haben Sie noch Erinnerungen an seinen Auftritt im Treptower Rathaus?
Nee. Ich weiß bloß, dass es stattgefunden hat. Ich würde behaupten: Es kann sein, dass er auch rezitiert hat, weil er damals noch mit Singen sehr zurückhaltend war.
Haben Sie ihn privat mal als Sänger erlebt?
Nein, gar nicht. Er hat überhaupt nicht gesungen, sondern er hat sich ganz ruhig unterhalten. Er war damals auch noch geprägt durch seine Nazi-Erlebnisse und war insgesamt sehr ruhig. Aber er hat dann mit Pathos Dinge vorgetragen, also bei diesen Gesprächen hat er ab und zu was vorgetragen. Und dann fing er an mich zu beschenken mit Schallplatten. Im Laufe der Zeit habe ich von ihm vielleicht 80 oder 100 oder auch mehr Schallplatten geschenkt gekriegt. (…) Und zwar alles, was er an Versuchsplatten aus seiner Firma mitbrachte, hat er mir dann geschenkt. Ich hatte später mehrere Ständer mit Schellackplatten aus der frühen Produktion von Lied der Zeit: die ganzen Spanienlieder sowieso, „Ami go home!“ natürlich. Besonders hat sich mir eingeprägt diese Ballade mit der Wolke von Brecht: „An jenem Tag im blauen Mond September“, so fängt das an. Und dann kommt die Wolke: „Sie war sehr weiß und ungeheuer oben / Und als ich aufsah, war sie nimmer da“. Oder so ähnlich. (…) Das hat er gesungen, und das hat er sehr schön gesungen, „Erinnerung an die Marie A.“ heißt es.
Was ist aus all den Platten geworden?
Die habe ich später dummerweise verschenkt an westdeutsche Genossen, die noch ein Abspielgerät hatten. Ich hatte sonst keine Schellackplatten mehr und war mir über den Wert von Schellackplatten nicht im Klaren. Ich hatte kein solches Gerät mehr und hatte nur noch die Langspielplatten. Das war in den 60er Jahren.
Diese stolze Plattensammlung muss ja innerhalb kurzer Zeit bei Ihnen gewachsen sein …
Das muss 49/50 gewesen sein. Ich glaube, dass Busch dann relativ bald weggezogen ist. Der Busch muss 51 weggezogen sein. Er war damals verheiratet mit einer etwas merkwürdigen Frau …
… Margarete Körting …
… ja, die hatte aber irgendeinen Kosenamen …
… Tete.
Tete, genau. Mit Tete war er verheiratet. Tete war nicht ganz auf seiner Höhe. Tete wirkte etwas sonderbar. Sie hatte einen sehr dicht behaarten Hund, und dieser Hund wurde von ihr wie ein Mensch behandelt. Das heißt: Mit dem Hund führte sie in unserem Beisein längere Gespräche. (…) Sie hat in einer Kindersprache mit diesem Hund verhandelt. Und ich hatte den Eindruck, dass dem Busch das alles etwas lästig war. Das war Tete. (…)
Hatten Ihr Vater und andere Besucher bei Busch einen ähnlichen Eindruck? Erinnern Sie sich an entsprechende Kommentare?
Man fand diese Liaison von Busch mit Tete etwas merkwürdig, weil es auch nicht möglich war, mit Tete irgendwelche, sagen wir mal: geistig etwas höher stehenden Gespräche zu führen. (…)
War sie in Ihrer Erinnerung eine attraktive Frau?
Sie war eine blonde Frau, ziemlich üppig, bisschen jünger als er vielleicht.
Und der Hund war eine Art Kindersatz?
Der Hund war ein Kindersatz. Das war so ein Hund, wo man keine Augen sah, mit Zotteln bis nach unten auf den Boden. (…)
Lassen Sie uns noch mal zurückkommen auf die Situation, in der „Ami go home!“ entstand. Ihr Vater war ja offenbar dabei, als Busch an dem Text arbeitete …
Ich weiß nicht, ob an dem Text dann noch was verändert wurde. Busch hat das Lied jedenfalls damals gesungen.
Dieses Lied ist ja direkt aus der Zeit, der politischen Situation, entstanden …
Das ist ’n reines Agitationslied.
Ja. Und verglichen mit anderen Sachen, die Busch gemacht hat …
… ist es sehr simpel. (…) Aber es erfüllte damals eine Funktion. Das Lied war außerordentlich populär. Ich habe das auch gesungen, wir haben das alle gesungen. Mir sind heute noch einzelne Textzeilen gut im Gedächtnis. Aber wenn man’s genauer betrachtet, vor allem aus heutiger Sicht, muss man sagen: Es war sehr simpel. Und es war nicht auf gleicher Höhe mit andern Dingen, die er auch gesungen hat.
Bei welchen Anlässen haben Sie es gesungen?
Ach, damals wurde immer gesungen. Später war das so, dass ein Lied eine absolute Sensation war. Aber in der frühen Zeit wurde auf jeder Versammlung gesungen: am Anfang, am Ende, zwischendurch. Es war ein Erkennungszeichen. (…) Das war eine Tradition, die kam aus der Nazizeit. Ich meine, Lieder hat es in der Arbeiterbewegung immer gegeben. Aber in der Nazizeit war es so, dass sich in den Konzentrationslagern die Leute daran erkannten, ob sie die Liedertexte konnten. Also wenn einer sagte, er sei Kommunist, nahm man zunächst mal an, dass er von der Gestapo kommt. Man musste ihn ja erst mal irgendwie testen: Ist das ein auf uns Angesetzter oder ist das ein Echter? (…) Spitzel konnten in der Regel die Lieder nicht.Vielleicht hat man das irgendwann gemerkt und ihnen später auch die Lieder beigebracht. Aber zunächst war es ein bekanntes Erkennungszeichen in der Nazizeit in den Konzentrationslagern und in der Illegalität: Ob jemand die Liedertexte kannte, die linken Lieder konnte.
Es entstanden auch neue Lieder in den Konzentrationslagern. Das Lied der Moorsoldaten ist eines der bekanntesten geworden, vor allem durch Busch. Glauben Sie, dass Ihr Vater und Sie selber das schon in der Nazizeit gekannt haben?
Ich hab’s nicht gekannt. Mein Vater auch nicht.
Hat er Radio gehört, also „Feindsender“, etwa Radio Moskau?
Mein Vater hat sowohl BBC als auch Radio Moskau gehört. Aber „Die Moorsoldaten“ habe ich zum ersten Mal am Deutschen Theater gehört, da wurde 1946 ein Bühnenstück von Ernst Toller gespielt. Das hieß, glaube ich, sogar „Die Moorsoldaten“. Da wurde dieses Lied gesungen, das hat sich mir ungeheuer eingeprägt.
Ohne Busch?
Ohne Busch, von Busch lernte ich es erst später kennen. Ich habe das dann auch als Platte geschenkt gekriegt von ihm.
War das ein bekanntes Lied zur damaligen Zeit?
Ja, sehr populäres Lied. Und was mir auch noch in Erinnerung ist von den Platten, die er mir geschenkt hat: „Jarama-Front“ natürlich, diese ganzen Spanienlieder, „Hans Beimler-Lied“ …
Was haben Sie damals sonst für Musik gemocht, als Sie 17 waren?
Ich war kein Anhänger von Rock’n’Roll oder solchen Geschichten.
Den gab’s ja auch noch nicht so richtig …
Na, als ich 17 war, begann das schon. Aber auch Jazz und Tanzmusik haben mich nicht interessiert.
Klassische Musik?
Heute bin ich ein großer Freund bestimmter Teile der klassischen Musik. Aber damals wusste ich einfach davon viel zu wenig. Meine Musikkenntnisse konzentrierten sich im Wesentlichen auf Kampf- und Volkslieder.
Das heißt, der Busch hat Sie wirklich angesprochen …
Der Busch hat mich unmittelbar angesprochen. Das war das, was ich wollte.
Sie hörten die Lieder nicht wegen Ihres Vaters oder weil es sozusagen politisch korrekt war, die zu hören?
Nein, nein, das hatte damit gar nichts zu tun. Das gefiel mir.
Wie ging es Ihren Freunden, konnten die was damit anfangen?
Die fanden das auch gut. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass das damals ganz anders war, als meinetwegen in der Endphase der DDR. In der Anfangsphase war es so: Wir waren sehr viele, und wir hatten ziemlich übereinstimmende Interessen. Ich denke jetzt an die frühe FDJ und so weiter, da gab es in der Jugend nach diesem Krieg wirklich eine Massenbasis – im Osten jedenfalls.
Welche Rolle spielte für Sie als Angehörige der Aufbaugeneration in der DDR der andauernd formulierte Antifaschismus?
Ich fand, dass Antifaschisten in der DDR falsch behandelt wurden. Dass beispielsweise alle möglichen Privilegien auch für Kinder von Antifaschisten, die schon in der DDR geboren waren, eingeführt wurden. Also, es gab eine ganze Reihe von Leuten, da waren die Eltern VdN, also Verfolgte des Naziregimes , und die Kinder, die damit überhaupt nichts mehr zu tun hatten, die konnten dann auf die Schnelle ’n Auto bekommen oder so. Also nicht kostenlos, aber die kriegten dann ’n Schein für’n Auto oder so was. Viele haben davon profitiert.
Das ging Ihnen zu weit?
Die Anständigen, sozusagen, haben davon natürlich keinen Gebrauch gemacht. Ich habe aus der Tatsache, dass mein Vater VdN war, nie irgendwelchen Nutzen gezogen. Aber ich hätte das tun können. Und ich fand das viel zu weitgehend.
Wurde dieser Antifaschismus-Bonus nicht im Lauf der Zeit in der DDR weitgehend abgeschafft?
Nee, nee. Der ist überhaupt nicht abgeschafft worden. Der ist leider in einer Weise ausgeweitet worden, die völlig ungerechtfertigt war. Der Antifaschismus ist dadurch abgeflacht worden: Erstens haben wir einen großen Fehler gemacht und sind davon ausgegangen, dass die Nazis alle in den Westen gegangen sind. Die Nazis waren aber nicht alle in den Westen gegangen, die großen Nazis waren zum größten Teil in den Westen gegangen. Aber die Deutschen waren 1945 im Grunde genommen alle indoktriniert von den Nazis – fast alle, mit wenigen Ausnahmen. Natürlich waren diese indoktrinierten Leute auch im Osten und haben sich dann …
Waren Sie gegen diese Indoktrination gefeit? Waren Sie nie in der HJ?
Nein, ich war nie in der HJ. Ich durfte ja gar nicht.
Aber Sie wären vielleicht gerne …
Also, ich kann mich erinnern, dass ich Ostern 1941 oder so aus der Schule heimkam. Ich ging in Dahlem in die Schule, meine Eltern hatten mich da in eine Schule getan, weil sie der Meinung waren, die wäre nicht so eine Nazi-Schule, war aber genauso eine wie die anderen auch. Dann kam ich Ostern nach Hause und da ging es um die Frage: „Woher kommt denn eigentlich Ostern?“ Und das wusste ich ganz genau, ich sagte: „Das kommt von unserer Göttin Ostara“. Von unserer Göttin Ostara! Weil die Nazis alles an den Germanen abhandelten, da gab es die germanische Göttin Ostara, die hatte Ostern kreiert. Das gab dann einen fürchterlichen Krach zu Hause. Und dann kann ich mich erinnern, dass ein paar Monate später in der Schule schon bei den Kleinen durchgenommen wurde die „Systemzeit“. Systemzeit war die Weimarer Republik.
(Frau Steiniger kommt von der Arbeit nach Hause, wir begrüßen uns)
„Systemzeit“ war also abwertend gemeint …
Die Lehrerin, Frau Hoffmann, erzählte uns: „Am schlimmsten waren die Kommunisten, das waren die ganz Blutrünstigen, dann kamen die Sozialdemokraten, die waren fast genauso schlimm. Und dann kamen die anderen alle, die schlappen feigen Säcke der Weimarer Republik. Doch dann kamen die Nazis und Herr Horst Wessel und so weiter. Und ich war damit voll gepumpt, kam nach Hause und fragte meinen Vater: „Was hast’n Du gewählt?“ Dann sagte er, er hätte immer Kommunisten gewählt. Daraufhin fragte ich meine Mutter. Meine Mutter sagte, sie hätte immer Sozialdemokraten gewählt, bis auf das letzte Mal im März 1933, da hätte sie auch Kommunisten gewählt. Und damit war natürlich ein fürchterlicher Konflikt in mir ausgelöst: Ich glaubte nicht mehr dem, was in der Schule erzählt wurde. Der Zweifel war gesetzt, und das hat dann immer weiter gewirkt. Was mich nicht davon abgehalten hat, als ich dann außerhalb elterlicher Kontrolle war, was weiß ich, Ritterkreuzträger-Autogramme zu sammeln. Das machten damals alle, und da habe ich das eben auch gemacht.
Zurück zum Antifaschismus in der DDR …
Die Antifaschisten standen in höchstem Ansehen, hatten alle möglichen Vorteile auch in der Versorgung. Das war alles gerechtfertigt bei den Leuten, die aus den KZs kamen oder aus dem Widerstand kamen. Später änderte sich das. (…) Da gab es nicht wenige Fälle, in denen Kinder von VdN abkassierten. Ich habe das selbst erlebt: Die kriegten dann ’ne Wohnung oder sie kriegten dann ’n Auto außer der Reihe.
(Ende der ersten Kassettenseite)
Von welcher Zeit sprechen Sie jetzt?
Ich spreche von der Honecker-Zeit. Unter Ulbricht gab’s so was nicht, unter Ulbricht war das alles sehr solide.
Den Status VdN gab’s ja bis zum Ende der DDR …
Ja, den Status des VdN gab’s bis zum Schluss. Für die Beteiligten gab’s ’ne Rente, die VdN-Rente. Der Status VdN galt bis 89. Aber teilweise war es eben grotesk: Ich habe selbst mit Leuten zusammengearbeitet, die entweder nach dem Krieg oder zu DDR-Zeiten geboren wurden, überhaupt nichts auszustehen hatten, und die nur dank der Tatsache, dass ein Elternteil VdN war, irgendwelche Privilegien genossen.
War das eine stehende Redewendung: „Die Sowiesos sind bestimmt VdN, sonst hätten die doch kein Auto …“
VdN hieß Verfolgte des Naziregimes. VdN war ein Status. Es bedurfte einer Anerkennung, zunächst nannte sich das VVN, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Und die Leute, die VVN waren, galten auch als VdN. Später wurde der Status eingeengt, die Kriterien wurden verschärft, weil man eben feststellte, dass auch Missbrauch damit getrieben worden war.
Also war es erstrebenswert, VdN zu sein, denn es bedeutete Geld?
Ja, aber die Maßstäbe waren sehr streng.
Gab es zu Beginn der 50er Jahre eine Zäsur durch diese berüchtigte Parteiüberprüfung? Die wurde ja zum Teil, wie etwa im Fall Ernst Busch, als Zumutung gegenüber verdienten Antifaschisten empfunden …
Ich glaube, dass diese Parteiüberprüfung notwendig war. Die war aus meiner Sicht notwendig, um zwei Arten von Leuten loszuwerden: erstens, rechte Sozialdemokraten und zweitens, kommunistische Sektierer. Dann gab es noch bei den Kommunisten Untergeschlüpfte, nach 1945 haben überall Leute versucht, irgendwo unterzuschlüpfen. Man konnte auch mit Nazipartei-Vergangenheit in alle diese Parteien eintreten. Es gab keine Bedingung, dass man einer der Parteien nicht beitreten könnte, wenn man Mitglied der Nazi-Partei .gewesen war. Und die Nazi-Partei hatte siebeneinhalb Millionen Mitglieder. Und was ich von Busch weiß, sind zwei Dinge – ob sie stimmen, weiß ich nicht. Die eine Variante ist, Busch habe sich geweigert, sich von einer Kommission überprüfen zu lassen, der auch Sozialdemokraten angehörten. Jede Überprüfungskommission war doppelt besetzt. Um zu verhindern, dass die ehemaligen Kommunisten die Sozialdemokraten ausschließen oder umgekehrt, waren in allen Prüfungskommissionen sowohl ehemalige Sozialdemokraten als auch ehemalige Kommunisten. Und eine Variante, die ich gehört habe, ist, dass Busch in Erfahrung gebracht hat, dass da soundsoviel Sozialdemokraten drin seien, und von Sozialdemokraten lässt er sich nicht überprüfen.
Wo haben Sie die Geschichte her?
Weiß ich nicht. Aber das ist eine Variante, die ich gehört habe. Die zweite Variante hängt zusammen mit dem Verlag Lied der Zeit. Dort sollte es zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein und der Hauptbuchhalter nach dem Westen abgehauen sein oder irgend so etwas. Das ist die zweite Variante, die ich gehört habe.
Hat die mit der Parteiüberprüfung zu tun?
Die hatte mit der Parteiüberprüfung wohl auch was zu tun. Oder das Ganze war später, ich weiß es nicht … Nichts ist für mich authentisch, ich habe es nur gehört …
Dass Busch sein Parteibuch angeblich den Leuten von der Kommission vor die Füße geschmissen hat oder sogar seine Mitgliedschaft aufgekündigt hat – das hat man sich auch erzählt …
Das habe ich auch gehört, aber eigentlich nicht geglaubt.
Damals schon?
Nein. Damals habe ich die Sache mit den Sozialdemokraten gehört. Das wurde von irgendwelchen Leuten erzählt, dass der Busch gesagt hätte: „Ein Busch lässt sich nicht überprüfen!“ So ungefähr habe ich das gehört. Das ist mir so erzählt worden. Busch war ein Sektierer.
Inwiefern?
Er hatte einen gewissen Hang zum Anarchismus. Und deshalb würde ich das nicht für hundertprozentig falsch halten, falls es sich so zugetragen haben sollte.
Glauben Sie, dass Busch eine spezielle Abneigung gegenüber sozialdemokratischen Funktionären hatte? Oder war es nicht eher ein allgemeines Misstrauen, das er gegenüber kommunistischen Funktionären genauso hatte?
Nein. Bei den Kommunisten war es so: Vor 33 gab’s 300.000 Mitglieder. Von den 300.000 Mitgliedern sind 59.000 umgekommen in der Nazi-Zeit. Viele haben sich gewandelt, übriggeblieben sind vielleicht maximal 100.000. Innerhalb weniger Monate war die KPD auf einmal eine Partei mit 600.000 Mitgliedern. Und Busch hat natürlich gesagt: „Was sind das für merkwürdige Leute, das sind doch keine Kommunisten!“ – Unter denen, die da eingetreten sind, waren sicher auch viele Neue, die nach dem Sturz des Faschismus jetzt dazukamen, aber es waren natürlich auch viele Karrieristen.
Busch hatte wohl auch was dagegen, von Leuten überprüft zu werden, die wesentlich jünger waren als er und eventuell eben erst in einem Umerziehungskurs auf die linke Linie gebracht worden waren …
Na ja … Ich bin ja auch überprüft worden damals, und das ist ganz korrekt gelaufen. Meine Überprüfung lief so: Da saßen vier Leute, zweie von der SPD, zweie von der KPD. Ich wusste nicht, wer von welcher Seite war. Das war völlig egal. Da saßen vier Leute vor mir und haben ein Gespräch mit mir geführt, das sehr ruhig und sachlich und freundlich verlief.
Das scheint bei Busch eben nicht der Fall gewesen zu sein …
Ja, aber Busch hatte natürlich Haare auf den Zähnen.
Er wollte selber Fragen beantwortet haben …
Die Leute, die mit ihm zu tun hatten, waren ihm ganz offensichtlich nicht gewachsen. (…)
Kommen wir wieder zu Ihnen und Ihrem Blick auf Busch: Haben Sie ihn eigentlich später noch mal gesehen?
Nein, ich bin ihm nie wieder begegnet. Ich habe ihn natürlich noch x-mal auf der Bühne gesehen im Theater, auch als Sänger. Ich habe ihn bei den verschiedensten Gelegenheiten gesehen, aber ich bin nie wieder mit ihm persönlich zusammengetroffen. Deswegen habe ich Ihnen ja am Telefon gesagt, dass es eine ganz periphere und kurze Geschichte ist, die ich Ihnen zu erzählen habe.
Aber Sie waren als Journalist tätig und hatten daher ein Auge auf die …
Ich war 25 Jahre in einer leitenden Position beim Neuen Deutschland. Das heißt: in einer journalistisch leitenden, nicht in einer administrativ leitenden Position. Ich war, heute würde man zu so was sagen, Starreporter. Das ist aber natürlich Quatsch, weil es bei uns keine Starreporter gab. Ich war Sonderkorrespondent und Auslandskorrespondent des Neuen Deutschland. Und in dieser Eigenschaft war ich immer eingesetzt bei Sachen, die auch ’n bisschen heikel waren. Also, ich habe beispielsweise mehrere Monate im Gerichtssaal in Kalifornien beim Prozess gegen Angela Davis verbracht. Oder ich war fünf Jahre in Portugal, als dort Revolution war. Oder ich war in einer sehr heiklen Mission mehrere Monate in Japan.
Das klingt nach einem tollen Job.
Das war ein toller Job. Zum Schluss bin ich eingebrochen: Da war ich akkreditiert in Paris und kriegte ’ne Bauchspeicheldrüsenentzündung, die beinah tödlich ausgegangen wäre. Und dann musste ich also meine Tätigkeit nach ein paar Monaten beenden. Aber ich bin in der ganzen Welt rumgekommen, das können Sie da drin nachlesen (zeigt auf das Buch, das er mir geschenkt hat).
Ich mach das, ich les das nach. Wie sahen Sie denn als professioneller Medienmensch, als Starreporter, den Künstler Busch? Er war ja einer der Prominenten in der DDR.
Busch war bei uns allen in höchstem Ansehen. Was da war mit seinem Parteibuch, und was da war, dass er mit diesem und jenem Krach hatte … Also, es war bekannt, dass schlecht Kirschen essen war mit Busch. Das war bekannt …
Aber so hatten Sie ihn gar nicht kennengelernt?
Nein, so hatte ich ihn nicht kennengelernt. Aber das war bekannt, auch aus dem Berliner Ensemble war das bekannt, dass es schwer ist, mit ihm manchmal klarzukommen.
Es gibt Leute, die behaupten, Busch hätte Honecker geohrfeigt.
Das glaub ich nicht. Das halte ich für schlechterdings erfunden.
Dann ist es eine gut erfundene Geschichte. Sie scheint mir ein Versuch zu sein, Busch zu charakterisieren. Wenn man so was jemandem zutraut, dann ihm, oder?
Ja, sicher, aber das glaube ich nicht.
Wie erklären Sie sich, dass solche Geschichten im Umlauf sind?
Ach, es sind 1000 Geschichten in Umlauf! Was meinen Sie, was ich so an Stories gehört habe, bei denen es sehr reizvoll gewesen wäre, sie weiter zu verfolgen, die sich dann als reine Luftblasen erwiesen haben! Immer wieder bin ich auf solche Dinge gestoßen.
Ich bin auch weit davon entfernt, diese Geschichte zu glauben. Aber es ist doch seltsam, dass die Leute von sich aus damit ankommen. Manche sagen: „Busch? Das ist doch der, der Honecker geohrfeigt hat!“ Das finde ich merkwürdig – immerhin saßen ja beide im selben Zuchthaus.
Dazu kann ich mich nicht äußern. Ich meine, Honecker muss man so sehen, ich kannte ihn persönlich: Honecker wäre überhaupt kein Problem – weder für die DDR, noch für sich selbst – gewesen, wäre er 1. Bezirkssekretär in Neubrandenburg gewesen. Da wäre er der Aufgabe voll gewachsen gewesen. Und da hätte er sicher mit zehn Jahren Nazi-Haft gut bestehen können. Aber das Problem bestand darin, dass er eine Aufgabe hatte, der er nicht gewachsen war. Die Tragik Honeckers besteht darin, dass er, nach dem Peter-Prinzip, über die Grenzen seiner Kompetenz gestiegen ist.
Als ND-Journalist erinnern Sie sich sicher an die Sonderseiten im ND, die im November 1976 anlässlich der Ausbürgerung Wolf Biermanns erschienen. Da waren Stellungnahmen bekannter Künstler der DDR wie Ernst Busch und Willi Sitte zu lesen, die um Verständnis warben für die Ausbürgerung. Wie ist so was zustande gekommen?
Da das ND das Organ des Zentralkommitees war, nehme ich an, dass in diesem Falle von der Kulturabteilung des Zentralkommitees eine entsprechende Empfehlung gekommen ist.
Wie lief das, wurde da ein Fax geschickt?
Nö, da haben die sich unterhalten. Da haben die den stellvertretenden Chefredakteur für Kultur eingeladen und haben sich mit dem unterhalten: „Was könnte man da machen?“, oder so. Zu Biermann ist meine Meinung: Erstens, ich halte Biermann für einen ausgesprochenen Strolch, charakterlich für einen absoluten Lumpen. Zweitens, ich halte die Ausbürgerung für politisch falsch.
Was ich an dieser Sache interessant finde, ist, dass Busch ganz deutlich sich auf eine Seite schlägt. Er hätte ja dazu nichts sagen müssen …
Nein, das war Buschs Standpunkt, da bin ich fest von überzeugt. Busch ließ sich so was nicht abfordern. Wenn er nicht gewollt hätte, dann hätte er’s nicht gemacht.
Meinen Sie, dass es eine Chance gibt, diese Vorgänge zu recherchieren? Gibt es Leute, mit denen ich reden kann, die damals für die Seite im ND zuständig waren? Oder ist das illusorisch?
Das halte ich für illusorisch. Es kann natürlich auch sein, dass die Sache auf höchster Ebene entschieden worden ist, dass das von Honecker gekommen ist. (…) Das ist schwer nachzuvollziehen. Ich glaub nicht, dass man da jemanden findet, der heute sagen wird: „Ich habe damals das und das gemacht in der Sache.“ Also, Leiter der Kulturabteilung beim Neuen Deutschland zu der Zeit war Klaus Hoepcke.
Haben Sie ’n Draht zu dem?
Nein. Ich hatte immer ’n guten Draht zu ihm. Dr. Klaus Hoepcke ist heute politisch aktiv. Er ist ein sehr aktiver Mann in der PDS, er gehört zu der linken Opposition in der PDS und äußert sich öfter zu verschiedensten Gelegenheiten. Also er ist nicht in der kommunistischen Plattform in der PDS, sondern er engagiert sich … ich glaube, sie nennen sich Marxistisches Forum, er ist einer der Chefs vom Marxistischen Forum. (…) Er ist ausgesprochen nett. Später war er Stellvertretender Kulturminister.
Es ist nicht ganz einfach, mit dem damaligen ND in Kontakt zu kommen, auch wenn die Zeitung jedenfalls dem Namen nach heute noch existiert …
Das heutige ND ist meiner Ansicht nach nicht auskunftsfähig. Das heutige ND besteht zum großen Teil aus Leuten, die ich alle kenne von damals.
Der Chef ist ein Grüner.
Ja. Aber die meisten anderen sind aus der Zeit, in der ich da war. Ich bin bis Anfang 92 dort gewesen. Und sie haben sich fast alle gewandelt. Sie sind das Gegenteil von dem, was sie vorher waren. Zum Teil jedenfalls. Ich meine jetzt nicht, dass sie nur bestimmte neue Realitäten in Rechnung stellen oder so. Sondern sie können sich nicht mehr so genau an das erinnern, was sie früher gedacht haben.
Der Text im ND gibt eben Anlass zu Spekulationen. Angelika Domröse schreibt etwa in ihren Memoiren, dass sie damals mit anderen jungen Leuten bei Busch geklingelt habe, um seine Unterschrift gegen Biermanns Ausbürgerung zu kriegen. Irene Busch hätte ihren Mann an der Tür verleugnet, und als Angelika Domröse mit ihren Freunden wieder weg war, hätte Irene Busch die Partei angerufen. Wenn das stimmt, dann könnte man auch vermuten, dass dieser Text im ND auf ihre Initiative hin erschien.
Nein, das halte ich für kaum denkbar. Busch lässt sich so etwas nicht vorschreiben – so wie ich ihn in Erinnerung habe. Er ist nicht der Mann, der sich von Irene vorschreiben lässt, was in seinem Namen im Neuen Deutschland steht.
Auch nicht als alter Mann?
Nein, gar nicht. Das halte ich für ausgeschlossen.
Man druckte Buschs Statement ganz oben links auf die Seite, als ob er der Staatskünstler schlechthin war.
Er war einer der ersten. Er war vielleicht der angesehenste Künstler, den die DDR damals hatte. Busch, Weigel, mit großem Abstand: Schall … Nein: Busch war der Staatskünstler.
Würden Sie sagen?
Ja. Er war der Künstler mit dem größten Renommee. Ich meine, es gab andere große Schauspieler, die vielleicht größere Schauspieler waren als er selber.
Wie vertrug sich das mit seinem rebellischen Image, das er auch in der DDR hatte?
Ich kann nur sagen: In dem Milieu, in dem ich verkehrte, war er höchst respektiert. Und diese ganzen Geschichten mit dem Parteibuch und so weiter, das waren alles Sachen, die in den Niederungen angesiedelt waren. Da hat man gesagt: „Lasst den Busch mal machen!“
Hat er Narrenfreiheit gehabt?
Nee, nee, das nicht in dem Sinne. Aber als es hieß, er sei ohne Parteibuch, stieß das auf Ablehnung in der Partei: dass man Busch das Parteibuch nicht gegeben hatte. „Einen Busch kann man nicht gehen lassen!“ – so war die mehrheitliche Auffassung. Ich meine, unter Honecker wurden dann eben in der Kulturpolitik gravierende Fehler begangen. Einer davon war die Ausbürgerung Biermanns.
Was waren andere?
Na, die Filmverbote beispielsweise.
Zensur …
Zensur gibt’s in jedem Land. In irgendeiner Form gibt es überall Zensur, da habe ich keine Illusionen. (…) Aber es war so, dass Filme wie „Spur der Steine“ oder so …
Toller Film!
Ganz toller Film! Auch für die DDR ein ganz toller Film! Der Film ist bejubelt worden bei seiner Premiere in Potsdam im Beisein der gesamten dortigen Parteiführung. Und 14 Tage später wurde er in Berlin im Kino International von Parteihochschülern ausgepfiffen. (…) Da wurden Krawalle inszeniert und so weiter. Das war Hager! Das war nicht Honecker! Honecker verstand von den Sachen nichts. Der Mann, der die Kulturpolitik in der DDR auf dieses Gleis gefahren hat, war Kurt Hager.
Was war das für ein Typ?
Ich kannte ihn ganz gut. Ein kalter, kluger Intellektueller. (…) Sehr gebildeter Mann – aber ein Mann, der dann nach 89 gesagt hat, als man ihn gefragt hat, warum er denn bestimmte Dinge gemacht hat: „Na, man hängt eben so an der Macht“. (…) Das war ein Mann, der jahrzehntelang in der Parteiführung war.
Ich würde gerne noch mal auf das Wort „Staatskünstler“ zurückkommen.
Also, das ist immer subjektiv gefärbt, das ist meine Sicht auf die Dinge.
Ich halte den Begriff ja für schwierig …
Gemeint ist: der angesehenste Künstler des Staates.
Mag sein. Ich fürchte aber, dass sich dieser Status und echte Popularität nicht gut vertragen.
Also, Busch war zunächst in der Nachkriegszeit bei den Arbeitern hier sehr populär. Aber die Arbeiter haben sich natürlich verändert.
Es gab irgendwann keine mehr.
In Westdeutschland verwandelte sich die Masse der Arbeiter in Arbeiter-Aristokratie. Das Problem der nicht vorhandenen Kampfbereitschaft der westdeutschen Arbeiterklasse besteht darin, dass sich im Laufe der Zeit ein großer Teil der Arbeiter in Arbeiter-Aristokratie verwandelt.
Was ist Arbeiter-Aristokratie?
Arbeiter-Aristokratie ist ein fester Begriff in der marxistischen Literatur. Das sind Arbeiter, die aber auf dem Niveau gehobener Kleinbürger leben.
Müssen Arbeiter auf einem bestimmten Niveau leben, um Arbeiter zu sein?
Nein. Es gab in der Arbeiterklasse immer die Arbeiter-Aristokratie , das waren die Meister; eine bevorzugte, besser gestellte, privilegierte Schicht. Und es ist natürlich überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass Arbeiter auf diesem Niveau leben, aber es hat natürlich bestimmte Wirkungen, wenn nicht gleichzeitig eine revolutionäre Arbeiterbewegung existiert, die genügend Einfluss besitzt. Es hat Wirkung auf das Denken der Arbeiter. Ein Meister denkt im Kapitalismus anders als ein Hilfsarbeiter. In dem Sinne meine ich das. Arbeiter-Aristokratie ist also ein fester Begriff aus der Arbeiterbewegung für Leute, die eigentlich Arbeiter sind, sich aber nicht als Arbeiter empfinden. Aufgrund ihres Abrückens vom normalen Arbeiterleben empfinden sie sich nicht mehr als Arbeiter. Ich habe lange Zeit in USA gearbeitet. Und der amerikanische Arbeiter sagt nie, wenn man ihn nach seiner Klasse fragt, „working class“. Der amerikanische Arbeiter sagt: „middle class“.
Wenn man das etwas weniger ideologisch betrachtet, muss man feststellen, dass es kaum noch Arbeiter gibt, da es ja tatsächlich diese Umwandlung zur Dienstleistungsgesellschaft gegeben hat …
Im sozialökonomischen Sinne gibt’s natürlich noch Arbeiter.
Gut. Aber wir müssen uns darüber klar sein, dass einer wie Busch seine klassische Zielgruppe, nämlich die Arbeiter …
… die hat er verloren. (…) Das ist übrigens von Land zu Land verschieden. Als ich beispielsweise die fünf Jahre in Portugal gelebt habe, da bin ich einem klassischen Bilderbuch-Proletariat begegnet. Das heißt, man kann nicht sagen: „Es gibt die Arbeiter nicht mehr“, oder: „Es gibt das Proletariat nicht mehr“. Es gibt weltweit natürlich das Proletariat, in ganz Südamerika gibt’s das Proletariat. (…)
Ich möchte noch mal über diesen Sonderstatus mit Ihnen sprechen, den Busch in der DDR hatte. Sie sagen, er war der angesehenste Künstler der DDR, hätte aber gleichzeitig was Anarchistisches an sich gehabt. Vielleicht macht ihn genau das aus, dies zu vereinen: der Staatskünstler zu sein und der Mann zu sein, dem die Leute zutrauen, dass er Honecker ohrfeigt …
Er hatte was Anarchistisches an sich in seinem ganzen Habitus. Das fiel mir auch damals auf in den Diskussionen zwischen meinem Vater und ihm, das lag ihm. Aber er war marxistisch nicht gebildet. Er war völlig unideologisch. Das war ihm alles relativ egal. Weshalb hatte er diesen Status bei uns? Weil eine bestimmte Kategorie von Leuten in der DDR einen ganz hohen Status hatte – obwohl es da hin und wieder auch mal Krach gab und weiß ich was: Das waren die Spanienkämpfer. Und Busch war der Spanienkämpfer! Obwohl er gar kein Spanienkämpfer war. Der Busch war die Symbolisierung des Spanienkämpfers. Am populärsten und am bekanntesten waren nicht seine Stücke und all das, sondern seine Spanienlieder. Busch war der Mann von „Spaniens Himmel breitet seine Sterne“.
War das eine Art alternative Nationalhymne der DDR?
Ja, ja. Jeder kannte „Spaniens Himmel“. Wenn irgendwo ein Lied angestimmt wurde, war es „Spaniens Himmel“. Und „Spaniens Himmel“ war Busch. (…) In unseren Kreisen wusste man, es gab alle möglichen Rütteleien mit ihm, aber das wurde alles weggestrichen und man sagte: „Der Busch ist so groß – das ändert alles nichts“. (…) Vielleicht ist „Staatskünstler“ doch nicht das richtige Wort. Aber im Ausland habe ich sehr oft festgestellt, wie bekannt er war. Beispielsweise in Portugal: Die portugiesischen Kommunisten haben Busch verkauft – in Massen.
Die Platten?
Kassetten! Busch war in Portugal präsent auf dem Höhepunkt der portugiesischen Revolution in den 70er Jahren nach dem Sturz des Faschismus. Da gab’s dort eine kommunistische Partei mit 200.000 Mitgliedern, heute hat sie noch 12.000. Und diese kommunistische Partei hat Busch gespielt, natürlich.
Haben Sie das häufiger erlebt?
Ja, natürlich. Busch war die DDR für die Portugiesen.
Ist Ihnen das woanders auch passiert?
Nein. Aber in Frankreich, in der französischen Linken, wurde Busch auch gespielt.
Busch als Repräsentant?
Busch war die DDR – für diese Leute.
Busch-Platten wurden ja auch gelegentlich als offizielle Präsente bei Veranstaltungen überreicht.
Kann sein.
In seiner frühen Zeit war ein wesentlicher Bestandteil seiner Kunst das Dagegen-Sein. In den letzten drei Jahrzehnten seines Lebens musste er immer dafür sein. Wie geht so was?
Das war schwierig für ihn, klar. Aber das war überhaupt die Schwierigkeit! Das ist auch generell der Konflikt gewesen zwischen Genossen aus der DDR und Genossen aus Westdeutschland. Der Konflikt bestand darin, dass die einen immer dagegen waren, die andern waren immer dafür.
Das ist beides anstrengend (lacht).
Stimmt, das ist beides anstrengend (lacht). Wobei man sich das nicht so vorstellen darf, bei uns in der DDR, dass wir nun ununterbrochen die Hand gehoben haben und gesagt haben: „Wir sind dafür“. Ich habe x-mal gesagt: „Ich bin dagegen!“ – und ich bin deshalb nicht nach Sibirien gekommen.
Aber Sie waren auch, das muss man ja sagen, in einer relativ privilegierten Situation.
Ja, aber ich habe mich auch gegen wesentlich Privilegiertere kräftig zur Wehr gesetzt, wenn es drauf ankam. (…)
Busch hatte sich fest vorgenommen, dafür zu sein. Wobei er bestimmte politische Parolen als Lieder populär machte: „Die Partei hat immer Recht“ oder eben „Ami go home!“. Letzteres formuliert ein klares Feindbild und klingt heute doch ziemlich platt, ganz abgesehen von chauvinistischen Untertönen …
Das Lied ist fürchterlich, es ist sehr platt. Das hat er selber sich so ausgedacht. Ich meine, er wollte darauf ein Echo haben oder vielmehr: er wollte Bestätigung haben. Er horchte nicht in die anderen hinein, was die nun meinten, sondern er wollte Bestätigung haben. Und damals waren wir, als Publikum, natürlich auch einfach gestrickt. Unsere politischen Erfahrungen waren gering, auch bei denen, die schon welche gemacht hatten. Auch mein Vater hatte nicht die Erfahrungen, die er dann später hatte.
War das eigentlich ein populärer Slogan damals, „Ami go home“?
Ja, sehr populär! Unerhört populär!
Also auch schon vor 1950, vor dem Lied?
Ja, ja. Das war der Slogan!
Wo kam der her?
Der kam aus Westdeutschland. Aus der Anti-Atom-Bewegung und so. Der Stockholmer Appell gegen die Atombewaffnung war 1948, da muss der Ursprung sein. Es gab damals noch keine Bestätigung einer sowjetischen Atomwaffe. Ich habe selbst Unterschriften gesammelt für den Stockholmer Appell in West-Berlin, als ich dort wohnte. Meiner Ansicht nach war das 48, es kann aber auch 49 gewesen sein. Aber jedenfalls war es zu einer Zeit, als die Amerikaner im Alleinbesitz der Atomwaffen waren. Und da hatten die Leute alle Angst vor.
Sie würden also sagen, der Slogan kommt von links?
Der kommt von links! Das ist kein chauvinistischer Slogan.
Es könnte ja auch ein Slogan sein, der schon bei den Nazis …
Nein, nein. Der ist in den späten 40er Jahren entstanden. Bei den Nazis habe ich nie so was gehört. „Go home“ kann es ja auch erst heißen nach dem Eintreffen der Amerikaner. Ich kann nicht „go home“ sagen, wenn gar keiner da ist.
Gut. Aber es gab eine Zeit, in der die Amerikaner sich bereits auf ehemals deutsch besetztem Gebiet befanden. Es hätte ja sein können, dass dieser Slogan bereits vor 1945 in Deutschland in Gebrauch war.
Nee, nee. Ich erinnere mich genau, wie der aufkam. Das muss 48 gewesen sein.
Es gab Bücher mit dem Titel, es gab Graffitis an den Wänden vom Ruhrgebiet über München bis Berlin …
Ich hab auch welche gemalt. (…) Es gab sofort ’ne Massenbasis für diesen Slogan.
Wann war das? Hat Sie Buschs Lied dazu angeregt?
Nein, das war vorher. Diese Losung war ja bereits da.
War da gleich ’ne Ideologie dahinter, ’ne kommunistische?
Das war viel breiter. Erstens waren die Amis einfach unheimlich mit ihrem Alleinbesitz der Atomwaffen. Es gab damals noch kein Gleichgewicht der Kräfte, der Potenziale. Und zweitens war damals, als die Bundeswehr geschaffen werden sollte, die Wiederbewaffnung Deutschlands ungeheuer unpopulär. Das war ein Werk der Amerikaner: Die Amerikaner brachten die Bundeswehr! Und deshalb: „Ami go home!“
War das auch Ausdruck kultureller Abneigung?
Weiß ich nicht.
War das vielleicht sogar rassistisch?
Nein, das glaub ich nicht. Auf gar keinen Fall. Die Leute, die diese Losung hatten, hatten beispielsweise nichts gegen schwarze Amerikaner. (…)
Zum Schluss möchte ich noch gern wissen: Haben Sie ein Lieblingslied von Busch?
Die „Jarama-Front“. Das ist eigentlich mein Lieblingslied. Ich kann mich erinnern, dass ich das „Jarama-Lied“ mal in Vietnam gesungen habe. Ich hatte ’ne ganz gute Stimme, hab Bass gesungen. Und kurz nach Beginn der Bombardierungen war ich in Vietnam, im August 1964 war der erste Angriff auf Nordvietnam. Ich war an der Küste in der Ha Long-Bucht, und da hab ich abends vor den Vietnamesen dort deutsche Lieder gesungen. Die wollten welche hören. Da hab ich als erstes die „Jarama-Front“ gesungen. Das war zu der Zeit, als der Kampf im Süden schon begonnen hatte. Und als Vergeltung flogen die Amerikaner drei Angriffe auf Nordvietnam im August 64. Ich arbeitete damals im Außenministerium der DDR und habe dort USA gemacht.
Und den Vietnamesen haben Sie deutsches Liedgut nahe gebracht?
Ja, die haben gesagt: „Sing doch auch mal was!“ – und dann hab ich auch was gesungen. Und dann hab ich ihnen die Geschichte dazu erzählt. (…)
Und: Kam das gut an?
Das kam sehr gut an.
Interview: Jochen Voit
(Autorisierung Klaus Steiniger am 30.9. 2005)
Nachtrag:
Klaus Steiniger ist Autor verschiedener Bücher, u.a.:
∆ Portugal – Traum und Tag. Aus der Chronik einer Revolution. Leipzig: Brockhaus 1982.
∆ Bei Winston und Cunhal. Reporter auf vier Kontinenten. Berlin: edition ost 2004.

Hans-Georg Uszkoreit
über Musik und Politik in der frühen DDR und die Querelen um den Musikverlag "Lied der Zeit"
„Ernst Busch hat mich mit bleibendem Hass und Misstrauen bedacht!“
(Gespräch am 26. Juli 2008 in Schwerte)
Hans-Georg Uszkoreit ist Jahrgang 1926. Geboren ist er in Ragnit (heute: Neman) in Ostpreußen (heute: der russischen Enklave Kaliningrad), wo er zusammen mit sechs Geschwistern aufwächst. Der Vater ist Verwaltungsangestellter, die Mutter Hausfrau, beide sind Baptisten und erziehen die Kinder im christlichen Sinn. Der NSDAP treten sie nicht bei, obgleich dem Vater im Fall einer Mitgliedschaft der Beamtenstatus in Aussicht gestellt wird. Hans-Georg Uszkoreit kommt zu den Pimpfen und in die HJ (”Dort habe ich mich gedrückt, wo ich nur konnte”). Ab dem 12. Lebensjahr lernt er das Orgelspielen in der evangelischen Kirche von Ragnit, wo er bald einen ”eifrigen Zuhörer” hat, wie er sich erinnert. ”Dieser Mann, Heinz Buchholz, war Sparkassenangestellter und ein Orgel-Narr, und der ging 1943 eines Tages zu meinem Vater und sagte: ’Ihr Sohn muss Musik studieren!’ Darauf erwiderte mein Vater: ’Das kann ich nicht bezahlen.’ Da sagte der Mann: ’Das mache ich dann, wenn Sie einverstanden sind.’ So wurde er mein Mäzen.” Durch eine Sonderprüfung erhält der erst 17jährige die Zulassung zum Studium. Von Mai 1943 bis März 1944 studiert er zwei Semester an der Universität Königsberg am Institut für Musikerziehung und Kirchenmusik. Sein Orgellehrer ist der Domorganist von Königsberg, Prof. Herbert Wilhelmi. Danach wird er als Soldat eingezogen – seine ursprünglich auf zwei Jahre festgesetzte Zurückstellung vom Militärdienst ist auf ein Jahr reduziert worden. Als Musikstudent wird er automatisch Funker; er kommt an die Ostfront. In bleibender Erinnerung ist Hans-Georg Uszkoreit eine kurze Ansprache seines Hauptmanns nach dem Anschlag auf Hitler am 20. Juli 1944: Ab sofort, so der Befehl, sei der bisher übliche militärische Gruß der Wehrmacht durch den Hitlergruß zu ersetzen. ”Dann hob der Hauptmann die Hand und streckte sie aus, als ob er grüßen wollte, und sagte: ’So hoch liegt der Dreck in Deutschland.’ Das konnte jetzt jeder verstehen wie er wollte, ich hab das als Aussage gegen Hitler aufgefasst. Das war direkt an der Front, ein paar hundert Meter waren die Russen entfernt.” Wenig später, im September 1944, wird seine Einheit ”durch die Blödheit eines Offiziers, der einen völlig aussichtslosen Angriff befahl”, von den Sowjets eingekesselt. Uszkoreit gehört zu den wenigen Überlebenden und kommt mit einem Beindurchschuss in Gefangenschaft. Während seiner vier Jahre dauernden Kriegsgefangenschaft ist er in verschiedenen Lagern untergebracht: in Brestlitowsk, in Minsk und bei Ivanowo an der Wolga. Die Gefangenschaft ist durch Entbehrungen und harte körperliche Arbeit geprägt. ”Die Hälfte der Zeit war ’ne Hungerzeit”, sagt Uszkoreit. Die Teilnahme an zwei ”antifaschistischen Lehrgängen”, die von deutschen Emigranten durchgeführt werden, verbessert seine Situation ein wenig. Zeitweise leitet er einen deutschen Chor, mit dem er Programme erarbeitet und Konzerte gibt. In der Gefangenschaft hört er auch zum ersten Mal Ernst Busch, dessen Lieder durch den Lagerfunk verbreitet werden. Im Dezember 1948 kehrt er, sozialistisch umerzogen, nach Deutschland zurück. Zwei Tage vor Heiligabend trifft er seine inzwischen aus Ostpreußen geflohenen Eltern bei Güstrow in Mecklenburg wieder.
Hans-Georg Uszkoreit hat nicht viel Zeit, sich mit den neuen Lebensbedingungen in Deutschland vertraut zu machen – politisch geschulte Leute wie er werden in der SBZ dringend gesucht und regelrecht umworben. Bereits im März 1949 schickt die SED-Landesleitung Schwerin den Kriegsheimkehrer, der noch gar kein Parteimitglied ist, als Parteisekretär an die Universität Rostock. ”Das war ein Verwaltungsjob, der mir wenig Spaß machte”, sagt Hans-Georg Uszkoreit. Erst als man ihm 1951 anbietet, nach Berlin zu gehen und Mitarbeiter der neuen Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten (”Stakuko”) zu werden, sieht er sich gemäß seinen Interessen eingesetzt. Uszkoreit, seit Oktober 1949 SED-Mitglied, wird Hauptreferent in der Abteilung Musik bei der Stakuko. Unter anderem ist er für die Verstaatlichung des defizitären und kulturpolitisch eher hemdsärmelig agierenden Schallplattenunternehmens Lied der Zeit zuständig. Im Vorfeld der 1953 realisierten Betriebsübernahme kommt es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Ernst Busch, dem Leiter der Lied der Zeit GmbH, die nie ausgeräumt werden; auch Jahre nach der Umwandlung seiner Firma in einen VEB straft der Sänger den Kulturfunktionär mit Verachtung. Dabei hat der Ursprung des Streits weniger mit persönlichen Animositäten, als mit den starren Richtlinien der Kunstkommission zu tun.
Hauptaufgabe der von Helmut Holtzhauer geleiteten Stakuko ist es, das künstlerische Schaffen in der DDR auf der Grundlage des Fünfjahrplanes zu fördern und zu lenken. Im Arbeitsplan für das Jahr 1952 werden weit reichende Ziele genannt: Aufschwung des kulturellen Niveaus der Bevölkerung, Erhaltung des Friedens und der künstlerischen Überlieferungen des deutschen Volkes, Kampf gegen Kosmopolitismus und Formalismus und um die realistische Methode in der Kunst, Verbreitung der Kunst unter den Massen, Änderung der Studienprogramme an den Kunstschulen, Erhöhung des Verantwortungsbewusstseins, Verbesserung der Arbeitsdisziplin, bessere Koordinierung der Arbeiten im Staatsapparat. Bei der Verfolgung dieser Ziele wendet die Kunstkommission zum Teil autoritäre Methoden an: Zensorische Eingriffe in Theaterstücke und die Einmischung in die Programmplanung von Verlagen gehören zur Praxis der Stakuko. Nicht nur von Seiten der Künstler gibt es Kritik an der als kunstfern geltenden ”Kulturadministration”. Bereits im November 1951 hat Walter Ulbricht der Stakuko Mängel in ihrer Arbeit vorgeworfen und sie als ”zu sporadisch und geheimnisvoll” (interne Protokolle) bezeichnet. Hans-Georg Uszkoreit macht rückblickend vor allem den kompromisslosen Führungsstil Holtzhauers für den schlechten Ruf der Kunstkommission verantwortlich.
Als im Januar 1954 das Ministerium für Kultur die Nachfolge der Ende 1953 aufgelösten Stakuko antritt, wird Uszkoreit übernommen; er wird stellvertretender Leiter der Abteilung Musik. Für Holtzhauer ist in dem von Johannes R. Becher geleiteten Ministerium kein Platz mehr. Im Jahr 1956 wird Uszkoreit Abteilungsleiter in der Hauptabteilung Musik im Kulturministerium. Damit ist er für die ideologische und organisatorische Lenkung des gesamten Musiklebens der DDR zuständig. Seine Aufgaben sind vielfältig: Er kümmert sich um Orchesterbesetzungen und das Chorwesen, kontrolliert die Konzertplanung, redet bei der Einführung der 60/40-Regel mit, erstellt Programme für staatliche Festveranstaltungen und gehört zu den Initiatoren der gesamtdeutschen Druckausgabe der Werke von Johann Sebastian Bach. 1957 promoviert er bei den Musiksoziologen Ernst Hermann Meyer und Walther Vetter an der Humboldt-Universität über ”Volksbildende und kulturfördernde Probleme der musikalischen Programmgestaltung”. Als höchster Musikfunktionär der DDR erntet Uszkoreit nicht nur Zustimmung. Gegen Ende seiner acht Jahre dauernden Tätigkeit im Ministerium kommt es zu vereinzelten Beschwerden über ”die Arbeitsweise der Musikabteilung, besonders des Genossen Dr. Uszkoreit” (Schreiben von Siegfried Wagner, Kulturabteilung des ZK der SED, an Hans Bentzien vom 17.3.1961).
Bereits vor Amtsantritt des neuen Kulturministers Hans Bentzien 1961 trägt sich Uszkoreit mit dem Gedanken, sich beruflich neu zu orientieren. Das Angebot von Harry Költzsch, als Künstlerischer Direktor zum VEB Deutsche Schallplatten zu wechseln, schlägt er allerdings aus, als ihm Bentzien anträgt, Rektor der Dresdener Musikhochschule zu werden. Von 1963 an leitet er die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber und unterrichtet Studenten in Musikgeschichte. Nachdem er dieses Postens durch eine ”Partei-Intrige”, so Uszkoreit, 1968 enthoben wird, kommt er auf Költzschs Angebot zurück. Beim VEB Deutsche Schallplatten ist er zunächst Leiter der Abteilung Wissenschaft, ab 1973 dann Chefredakteur der Klassikabteilung Eterna. An das politische System der DDR glaubt Uszkoreit zu dieser Zeit kaum noch. Nachdem man ihm 1972 die Reise in die Bundesrepublik zur Beerdigung seiner Mutter verwehrt, beschließt er, mit diesem Staat ”Schluss zu machen”. Im Jahr 1975 nutzt er eine Dienstreise nach München zur Flucht aus der DDR. In der Bundesrepublik findet er Arbeit an der Volkshochschule Schwerte. Er wird dort stellvertretender Leiter für Kunst, Musik und Literatur. Heute ist Hans-Georg Uszkoreit im Ruhestand, beschäftigt sich mit MIDI und den musikalischen Verwendungsmöglichkeiten des Computers. Er lebt mit seiner Frau in Schwerte.
JV: Sie waren vier Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. War das sozusagen die Zeit, in der Sie politisch umerzogen wurden?
Dr. Hans-Georg Uszkoreit: Wissen Sie, ich ärgerte mich immer über die alten Nazis unter den Kriegsgefangenen, über die ältere Generation. Und einmal, es muss im Jahre ’47 gewesen sein, mussten wir mal wieder Kartoffeln schälen für ’s Lager, und da tönte es wieder: ’Alles Mist hier, bei Hitler war doch alles in Ordnung!’ und so weiter. Ich widersprach und bekam dann zu hören: ’Ihr seid mal ganz still, Ihr habt doch den Hitler gewählt!’ Da hab ich gesagt: ’Ich habe ihn kein einziges Mal gewählt, Ihr habt ihn gewählt!’ Es gab also einen echten Streit. Und dieser Streit muss den Sowjets gemeldet worden sein, denn ich wurde eines Tages gerufen und kurzerhand gefragt, ob ich bereit wäre, auf eine antifaschistische Schule zu gehen. Die hatten mich sozusagen als Antifaschisten ausgemacht. Dann war ich in Minsk auf der weißrussischen Gebietsschule zu einem dreimonatigen Lehrgang.
Was können Sie über den Lehrgang sagen? Hat man Sie da vom Sozialismus überzeugt?
Die Schulung nannte sich antifaschistischer Lehrgang. Man hat zu uns gesagt: ”Wir machen keine Sozialisten aus Ihnen, aber wir wollen, dass Sie, wenn Sie nach Hause kommen, antifaschistisch wirksam werden!” Wir waren eine gemischte Gruppe aus allen Teilen Deutschlands. Und diejenigen, die aus Westdeutschland waren, wurden dann auch in die westlichen Zonen entlassen.
Waren Ihre Mitschüler schon vorher mit kommunistischen Ideen in Berührung gekommen?
Kaum, die waren meist so alt wie ich. Aber wir alle hatten uns natürlich unsere Gedanken gemacht. Als ich in Gefangenschaft war, hatte ich einen echten Hass auf die ganze Hitler-Zeit: Ich war aus dem Studium rausgerissen worden. An der Front hatte ich nur Rückzüge erlebt, jede Woche ging es zurück, ich kannte gar nicht die Zeit der Offensiven. Sonnabend war meistens ”Reisetag”, so nannten wir das. Und ich, als Funker, kriegte immer als erster den Befehl übermittelt, dass es jetzt wieder rückwärts ging. […]
Wie lief der Lehrgang ab?
Es war schulmäßig aufgezogen. Es wurden Vorträge gehalten, Seminare veranstaltet, Diskussionen abgehalten. […] Als ich nach drei Monaten zurück ins Lager kam, wurde ich erneut gefragt, ob ich auf eine Schule gehen möchte. Und dann kam ich auf die Zentralschule in Taliza bei Nischni Nowgorod, im damaligen Gorki, 500 Kilometer hinter Moskau. Das war ein neunmonatiger Lehrgang, der schon etwas intensiver war: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, dialektischer historischer Materialismus und so weiter. […] Und man erzählte uns, dass man uns am Ende des Lehrgangs entlassen würde. […] Ich habe in dieser Zeit auch einen Chor geleitet, ein anderer Gefangener leitete ein Orchester. Wir haben uns aus dem Kopf die Noten aufgeschrieben und haben richtige Konzerte gegeben. Das war eine gute Schule in musikalischer Hinsicht.
”Meine erste Begegnung mit Busch war eine rein akustische.”
Gehörten auch Busch-Lieder zum Repertoire?
Ja, ”Spaniens Himmel” haben wir schon gesungen.
Der Name Ernst Busch war ihnen also schon in der Gefangenschaft ein Begriff?
Ja, die hatten Busch-Platten da. Man übertrug seine Lieder im Lagerfunk. Meine erste Begegnung mit Busch war eine rein akustische. Ein paar Jahre später haben wir uns dann persönlich kennengelernt…
Ein knappes Jahr vor Gründung der DDR kamen Sie zu Hause an …
Ja. Und was ich so überraschend fand: Als wir in Frankfurt/Oder aus unserem Zug ausstiegen, wurden wir bereits umschwärmt von Kopfjägern – ”Headhunter” würde man heute sagen. Die wussten ganz genau, wer da ankam. Damals gab es ja kaum geschulte Leute. Da gab es höchstens welche, die ein, zwei Wochen Kreisparteischule absolviert hatten. Aber man musste eben mit den Menschen arbeiten, die da waren. Ich bekam augenblicklich verschiedene Angebote. Einer sagte zu mir: ”Sie können sofort zur Volkspolizei kommen, da werden Sie Oberst!” Ich sagte (lacht): ”Ich bin froh, wenn ich meine Uniform wieder ausziehen kann!” Ich trug bei meiner Rückkehr noch Sachen aus dem Krieg: eine alte Wehrmachtsuniform, eine Luftwaffenjacke und einen italienischen Offiziersmantel. […]
Das heißt, man hat von Seiten der SED versucht, Sie schon direkt am Bahnsteig für eine politisch wichtige Funktion zu gewinnen?
Ja, so kann man das sagen.
Sie sind dann zunächst nach Güstrow gegangen. Sind Sie eigentlich direkt in die Partei eingetreten?
Nee, aber dazu gibt es eine Anekdote: Im Januar ’49 bin ich zur SED-Landesleitung nach Schwerin geschickt worden. Dort fragte man mich: ”Was haben Sie zuletzt in Deutschland gemacht?” Ich sage: ”Musik studiert.” – ”Aha, studiert … Und wo?” Ich sage: ”An der Universität Königsberg.” – ”Hm, wir brauchen einen Parteisekretär an der Universität Rostock.” Ich war perplex und fragte: ”Und das soll ich …?” (lacht) Sie müssen sich vorstellen: Ich hatte ja die deutschen Verhältnisse gar nicht mitbekommen. Ich hatte nicht wie die anderen das Kriegsende und die Jahre danach in Deutschland erlebt. Ich war damit beschäftigt, mich wieder an die hiesigen Gepflogenheiten zu gewöhnen. Aber ich sagte: ”Doch, ja, mache ich.” So wurde ich Parteisekretär der Universität Rostock.
Obwohl Sie noch gar kein Parteimitglied waren?
So ist es. Bei der Parteiüberprüfung 1951 ist mir das übrigens angekreidet worden. Diese Überprüfung fiel ja bekanntlich dramatisch für Ernst Busch aus, aber sie war insofern auch dramatisch für mich, als man zu mir sagte: ”Sie sind im März ’49 Parteisekretär an der Uni geworden und erst im Oktober ’49 in die Partei eingetreten – können Sie das erklären?” Ich sagte: ” Ich habe das für ’nen Verwaltungsposten gehalten und habe daraus nicht den Zwang abgeleitet, mich als Mitglied eintragen zu lassen. Außerdem dachte ich, das geht irgendwie automatisch.” Das sei aber ein merkwürdiger Widerspruch, hieß es, man könne doch nicht Parteisekretär sein, ohne Mitglied der Partei zu sein. Ich habe geantwortet: ”Das ist kein Problem für mich gewesen.” Ich hatte ja nichts dagegen gehabt, Parteimitglied zu werden. Aber ich war eben gar nicht erst gefragt worden. Also, das war ein großes Kuriosum. […]
Dieser Posten in Rostock entsprach noch nicht ganz Ihren beruflichen Vorstellungen …
Ich betrachtete das als Übergang. Eines war klar: Ich gehörte zu den Leuten, auf die Parteifunktionäre ein Auge warfen. Wir waren sozusagen Teil der Kaderreserve. Und ich weiß noch, dass ich im Sommer ’51 gefragt wurde, wo ich eingesetzt werden möchte. Dass ich Musik studiert hatte, war so eine Art Markenzeichen. Es hieß dann: Der muss in die Kultur. Da hatte man ohnehin zu wenig Leute. Viele Funktionäre waren proletarischer Herkunft, und die sahen sich nicht unbedingt für den Kulturbereich zuständig. Also bot man mir einen Posten in der Gewerkschaft Kunst an. Da habe ich gesagt: ”Nee, in die Gewerkschaft will ich nicht; ich möchte wieder im Musikbereich arbeiten.” Das wurde mir auch gewährt. ”Gerade ist eine Staatliche Kunstkommission gegründet worden”, sagte man mir, ”und die suchen noch einen Referenten für Musik.” Und diese Stelle bekam ich. Ich wurde Hauptreferent in der Abteilung Musik. Mein Abteilungsleiter war Rudolf Hartig, dem anfangs noch Fritz Erpenbeck als Chef der Hauptabteilung Theater/Musik vorgesetzt war. Später wurde diese Hauptabteilung geteilt, sodass auch die Musik Hauptabteilung wurde. Und Holtzhauer war der Chef der gesamten Kunstkommission.
”Bei der Kunstkommission praktizierten wir learning by doing.”
Als Sie ’51 anfingen, bei der neu gegründeten Staatlichen Kunstkommission zu arbeiten, da …
… da hatte ich überhaupt erst das Gefühl: ”Jetzt hab ich endlich eine Tätigkeit gefunden, die mir entspricht.”
Was, glauben Sie, hat man von ihnen erwartet in dieser neuen Position?
Tja, die Kunstkommission war ja auch noch neu. Es gab keinerlei Erfahrungen. Es ging um learning by doing im wahrsten Sinne des Wortes. Insofern kriegten wir auch keine Anleitung. Wir mussten uns selbst anleiten. Wir wussten nur, wofür wir zuständig waren. Meine Arbeitsgebiete waren der Komponistenverband, die Firma Lied der Zeit, die Internationale Musikbibliothek – dies waren meine ersten Aufgabenbereiche. Das Orchesterwesen hatte Hartig in der Hand, das bekam ich erst später. Dann wurde die AWA gegründet, die Anstalt zur Wahrung der Aufführungsrechte, auch damit hatten wir zu tun.
Für einige dieser Institutionen waren bereits vor Ihrer Zeit Pläne gemacht worden. Dass die Lied der Zeit GmbH verstaatlicht werden sollte, das stand ja schon fest, bevor Sie anfingen …
Ja, die ganze erste Phase habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Sie dürfen nicht vergessen: Als Lied der Zeit von Ernst Busch gegründet wurde, war ich noch in Kriegsgefangenschaft. […] Ich war ab März ’52 mit Lied der Zeit befasst. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich zu ihm in die Taubenstraße gegangen bin, und mich ihm vorgestellt habe. Er hat mich an und für sich akzeptiert. Unser Verhältnis wurde aber dann schwierig.
Lag das an den doch recht weitreichenden Eingriffen, die von Seiten der Kunstkommission beschlossen wurden? Aus den Unterlagen, die sich im Bundesarchiv befinden, geht hervor, dass Sie im Oktober ’52 einen konkreten Plan vorgelegt haben zur ”Einflußnahme auf die Schallplattenproduktion von Lied der Zeit”. Der Plan sollte bis Ende des Jahres verwirklicht werden. Die Umwandlung in einen ”volkseigenen Betrieb” stand an erster Stelle, dann gab es noch andere Punkte wie die Schaffung eines Kuratoriums, eine mehr auf Klassik ausgerichtete Produktionsplanung, die Einsetzung eines neuen künstlerischen Leiters und so weiter …
Das habe ich geschrieben? Das habe ich bestimmt nicht alleine gemacht.
Mag sein. Aber Sie waren doch sehr nah an der Firma dran. Ihnen wurden Probeplatten zur Beurteilung übersandt, im November ’52 zum Beispiel die Weihnachtsplatten …
Daran erinnere ich mich gut. Eins der Lieder habe ich verboten.
”Dass Adenauer an die Zweige des Weihnachtsbaumes gehängt werden sollte – das fand ich primitiv!”
Sie haben das damals mit der Verletzung der ”religiösen Gefühle vieler unserer Menschen” begründet. Es ging um das von Busch gesungene satirische Lied ”Deutsche Weihnacht” nach Tucholsky …
Das Problem war, dass der Text umgedichtet war, das war nicht mehr Tucholsky. Was mich störte, war die letzte Strophe. Da hieß es sinngemäß: Weihnachten werden wir erst haben, wenn Adenauer an den Zweigen des Weihnachtsbaumes hängt (”Denn auch Geduld geht mal zur Neige / Die Adenauers schlagen Schaum / Die hing ich gern in deine Zweige, oh Tannebaum”; J.V.). Das stieß mir derart auf, dass ich gesagt habe: Das ist Proletkult höchster Güte. Ich fand das primitiv. Ich habe Busch angerufen und gesagt: ”Herr Busch, ich mische mich sonst nicht ein, aber das geht nicht. Dieses Lied kann ich nicht gestatten.” Ich habe also direkt von meinem Weisungsrecht Gebrauch gemacht, das einzige Mal übrigens, so weit ich weiß. Busch hat geantwortet: ”So ’n Quatsch! Ich habe das Lied Wilhelm Pieck vorgesungen, und der fand es wunderbar!” Da habe ich gesagt: ”Wenn Wilhelm Pieck mir den Auftrag gibt, die Genehmigung zu erteilen, dann mache ich das, aber nicht eher!” Und damit war für mich der Fall erledigt und für Busch wohl auch. Er hat dann nichts mehr dazu gesagt. Dieser Vorfall hat aber nicht zu der Entzweiung mit Busch geführt.
Bevor wir näher über diese Entzweiung reden, würde mich interessieren, wieviele persönliche Begegnungen Sie eigentlich mit Busch hatten.
Wir haben uns vielleicht ein halbes dutzendmal bei verschiedenen Anlässen getroffen. Ein Anlass war zum Beispiel das viele Altmaterial, das bei der Firma eintraf. Schellack war ja Mangelware. Darum wurde eine neue Schallplatte nur gegen Rückgabe einer alten Platte verkauft. Das war bis zum Ende von Lied der Zeit so üblich. Jedenfalls rief mich eines Tages der Betrieb an, vielleicht sogar Busch selbst, und sagte: ”Hier sind so viele wertvolle Sachen abgegeben worden, und es ist jammerschade, dass die nun zermahlen werden! Guckt Euch das doch mal an!” Ich bin also hin, und da standen meterhohe Stapel von Altmaterial, das aus den Läden zurückgekommen war, zum Teil schon vorsortiert. Aber die Menge war so groß, dass mir sofort klar war: Das kann ein Einzelner überhaupt nicht schaffen, das vollständig zu sortieren. Das wäre ein Full-Time-Job gewesen. Ich habe nur mal wahllos reingegriffen, und schon hatte ich eine Platte in der Hand mit einer Originalrede des Reichspräsidenten Hindenburg. Also, es waren Schellacks von historischem Wert. Und das hat mir echt leid getan, die alle unbesehen einstampfen zu lassen. Aber ich hätte mehrere Arbeitskräfte gebraucht, um die Platten in zwei Kategorien einzuteilen: in solche, die es wert sind, aufgehoben zu werden, und solche, die man zu neuen Platten verarbeitet. […] Bei Lied der Zeit hatte man schon das richtige Gespür für die Situation gehabt, aber die ökonomischen Bedingungen innerhalb der Firma waren natürlich nicht besonders günstig, sodass man auf die Wiederverarbeitung des Altmaterials angewiesen war. Ist Ihnen bekannt, wo die Schallplatten damals gepresst wurden?
In Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge.
Richtig, und zwar zunächs noch auf Hutpressen. Früher waren da Filzhüte hergestellt worden. Und diese Pressen wurden nun umgebaut zu Schallplattenpressen. Ich bin selbst nie in Ehrenfriedersdorf gewesen, aber ich habe mir das berichten lassen.
”Ich monierte die völlig kritiklose Herausgabe von Schlagern.”
Sie sagen, die ökonomischen Bedingungen waren schwierig. Wurde Lied der Zeit eigentlich von staatlicher Seite bezuschusst?
Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, hat der Busch 500.000 Mark bekommen als Kapital für seine GmbH. Damit sollte er arbeiten. Wir haben auch mal über das Finanzielle gesprochen, der Busch und ich. Ich monierte die völlig kritiklose Herausgabe von Schlagern. Alles, was gerade so an Tanzmusik lief, kam damals bei Amiga heraus. Ich sagte zu Busch: ”Ist das nicht ein Jammer, dass Sie diesen Mist herausbringen? Das ist doch ein Widerspruch zu dem, was Sie sonst machen!” Und da sagte Busch: ”Davon leben wir! Ich muss das machen! Wir gehen pleite, wenn wir auf die Schlager verzichten.” Das habe ich eingesehen, ich konnte ihm ja auch kein Geld geben.
Wenn man sich die Dokumente aus der Zeit 1952/53 anschaut, könnte man den Eindruck gewinnen, dass sich da eine Art Privatfehde zwischen Ihnen und Busch entwickelt hat. Tatsächlich aber war der Kontakt zwischen der Kunstkommission und Busch von Anfang an unter einem schlechten Stern gestanden. Im Dezember 1951, da waren Sie offenbar noch gar nicht zuständig, hat Abteilungsleiter Hartig einen ziemlich ungehobelten Brief ohne persönliche Anrede an Lied der Zeit geschrieben, der Busch auf die Palme gebracht haben muss. In dem Brief wurde gefordert, dass Lied der Zeit mehr Aufbaulieder machen müsste. Gerhard Eisler, der den Brief auch zu lesen bekam, hat darauf notiert: ”Sehr geehrter Herr Busch! Ich rate Ihnen, diesen Brief wegen seines ungehörigen, frech-herrschenden Tones dem Absender zurückzusenden. Ein Künstler wie Sie braucht sich so etwas nicht bieten zu lassen.” Das heißt, die Atmosphäre war bereits vergiftet, als Sie anfingen, sich intensiver mit der Firma zu befassen…
Das ist gut möglich. Als Hartig diesen Brief schrieb, war ich erst ein paar Wochen bei der Kunstkommission. Das hab ich wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Man muss dazu sagen: Der Hartig war ein bisschen sonderlich. Er war sehr musikbegeistert, aber in Verwaltungsdingen war er ein Beamter alter preußischer Schule. Er war ja doppelt so alt wie ich.
Mich würde interessieren, ob Sie diese vergiftete Atmosphäre zu spüren bekamen. Haben Sie Ablehnung von Busch erfahren?
Nee, eigentlich nicht. Weil ich auch solche Forderungen an ihn nicht richtete und auch nicht zu richten hatte. Es war merkwürdig: Ich konnte ihn streckenweise auch duzen, wir hatten sogar ’ne gewisse Vertraulichkeit. Ich habe nur zu ihm gesagt: ”Busch, das Repertoire ist zu eng! Wir sind Monopolbetrieb in der DDR. Was wir nicht herausbringen, bringt keiner heraus.” Es gab ja keine Konkurrenz: Für den DDR-Bürger war die einzige Quelle für Schallplatten die Firma Lied der Zeit. Darauf sagte Busch: ”Ich tue ja schon, was ich kann!” Dann hat er mir aufgezählt, was alles an klassischen Werken bei Lied der Zeit im Programm und in Vorbereitung war, das ist mir noch genau im Gedächtnis. Besonders herumgeritten ist er in diesem Gespräch auf Beethovens ”La Marmotte”. Das Lied hatte er selbst eingesungen.
”Als Busch Beethoven-Lieder sang, waren auf einmal lyrische Klänge in seiner Stimme.”
Wie fanden Sie das? Busch war ja kein klassischer Sänger …
Das hat mich schon beeindruckt. Er hatte auch ”Bauern unter der Linde” aufgenommen und das ”Flohlied” aus dem ”Faust” und den Schlussmonolog aus ”Egmont”. Ich fand das gut, es war seinen Möglichkeiten entsprechend. Ich hatte ja diese Empfehlung eher vorsichtig gegeben. Mir ging es nicht darum, dass der Busch jetzt anfangen sollte, das Kunstlied zu singen. Und ich war dann angenehm überrascht, als ich diese Aufnahmen hörte. Da waren auf einmal lyrische Klänge in seiner Stimme.
Sie haben also registriert, dass er sich bemüht hat, sein Repertoire zu erweitern. Aber diese ”lyrischen Klänge” entsprachen noch längst nicht dem, was die Kunstkommission eigentlich hören wollte …
Nein, da mussten Berufssänger her. Busch galt ja in unseren Augen nicht als ausgewiesener Konzertsänger.
Wie sah man denn den Sänger Busch bei der Kunstkommission?
Als äußerst begabtes Naturtalent. Er hatte ja kein Studium in dem Sinne gehabt wie ein Opern- oder Konzertsänger.
In den Akten von damals monieren Sie die Einseitigkeit des Repertoires und auch die Einseitigkeit der Interpretation. An einer Stelle schreiben Sie, Busch überschätze sich als Sänger …
Ja, das war meine Befürchtung.
Haben Sie ihm das auch gesagt?
Naja, vielleicht in aller Vorsicht, aber so direkt nicht. Ich hatte ja auch keinen Anlass dazu. Wenn er jetzt die ”Winterreise” von Schubert aufgenommen hätte, wäre ich nicht darum herumgekommen, ihm zu sagen: ”Also, das geht nun wirklich nicht.”
Im Jahr ’51 fing Hartig an, Kritik an Lied der Zeit zu üben. Im Jahr 52 übernahmen Sie das dann. Sie waren Hauptreferent, Sie überprüften die Produktionspläne und trieben die Verstaatlichung der Firma voran. Das ging bis Mai ’53, da wurde aus Lied der Zeit ein sogenannter VEB, ab ’54 dann VEB Deutsche Schallplatten. Für Busch war keine Funktion im neuen Unternehmen vorgesehen. Hatten Sie den Eindruck, dass Busch mit dieser Entwicklung einverstanden war? Prinzipiell hat er ja eine Verstaatlichung seines Unternehmens befürwortet …
Ich kann das nicht genau sagen. Ich habe kein Gespräch erlebt, in dem Busch konfrontiert wurde mit dieser Fragestellung. Vielleicht hat ein solches Gespräch stattgefunden, als ich in China war … Wann war das? Das muss von Dezember ’53 bis März ’54 gewesen sein …
”Man sagte mir: ’Ich muss Ihnen eine große Schweinerei melden! Der Busch verbrennt Bänder!’”
Da war die Verstaatlichung bereits abgeschlossen …
Richtig, die Übergabe war ja Ende April, Anfang Mai ’53. Und da passierte folgendes: An einem Sonntag (das wäre dann der 3. Mai gewesen, Busch nennt in einem Notizheft allerdings den 2. Mai als Datum; J.V.) wurde ich zu Hause angerufen von dem damals amtierenden Betriebsleiter von Lied der Zeit, das müsste Josef Griffaton gewesen sein, der auch als neuer Chef vorgesehen war. Der sagte: ”Ich muss Ihnen eine ganz große Schweinerei melden! Der Busch ist mit einem unserer Heizer oder Kraftfahrer in den Betrieb gegangen und verbrennt dort Tonbänder!” Es war ja Feiertag, was sollte ich machen? Ich sagte: ”Das geht nicht! Das ist das ganze Kapital, was der Betrieb hat. Das muss sofort unterbunden werden. Sorge dafür, dass das aufhört!” Wie das nun geschehen ist, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist der Griffaton hingegangen und hat gesagt: ”Ich habe Auftrag von Uszkoreit aus der Kunstkommission, die Aktion hier sofort zu unterbinden!” Das war mit Sicherheit einer der Gründe, warum Busch dann auf mich gefeuert hat. Dass man ihn vielleicht sogar mit sanfter oder auch etwas weniger sanfter Gewalt dazu gebracht hat, damit aufzuhören …
Hat man das?
Weiß ich nicht. Ich habe die Weisung gegeben, das zu unterbinden. Und meines Erachtens ist das unterbunden worden. Busch hat dann zu seiner Rechtfertigung gesagt, er habe nicht das Repertoire vernichten wollen, sondern nur die Dinge, die bei einer Veröffentlichung für ihn von Nachteil wären.
War das nicht glaubwürdig?
Doch, das war glaubwürdig. Aber das Glauben nützte nichts in dem Falle.
Busch hat später in einer Notiz behauptet, er hätte mit Holtzhauer Ende April abgesprochen, dass er vor der Übergabe des Betriebs noch ”klar Schiff” machen und ”Fehlaufnahmen” vernichten würde …
Das war mir alles nicht bekannt. Ich wurde nur überrascht von der katastrophenähnlichen Mitteilung, da passiere was Schlimmes bei Lied der Zeit. Wie die Vernichtung letztendlich gestoppt wurde, wer das gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie verhindert worden ist. […] Ich habe kürzlich den letzten Generaldirektor des VEB Deutsche Schallplatten, Harry Költzsch, angerufen und ihn gefragt: ”Wer war denn eigentlich Dein Vorgänger?” Er wusste es nicht mehr. Költzsch war von ’55 bis ’88 bei der Schallplatte. Ein Jahr vor der Wende ist er in Rente gegangen. Ich vermute aber, dass davor Griffaton der Chef war. Und er war es auch, der mich damals anrief.
Es könnte auch Albert Busch gewesen sein, der wohl eine Art Interimsleiter bei Lied der Zeit gewesen ist …
Wie dem auch sei: Der ganze Vorfall hat dazu beigertagen, dass ich zum Kreis derer gehörte, die Ernst Busch mit bleibendem Hass und Mißtrauen bedachte. Das habe ich stets sehr bedauert, zumal ich dafür meiner Meinung nach keine Ursache geboten habe. Ich habe ihn wegen seiner künstlerischen und kulturellen Leistungen seit eh und je bewundert und geachtet. […]
”Der Jazz wird meines Erachtens überbewertet.”
Lassen Sie uns kurz über die musikalische Linie der Kunstkommission sprechen. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie damals den hohen Anteil an Unterhaltungsmusik bei Lied der Zeit kritisiert haben. In einer ”Einschätzung des Betriebs” vom August 1952 monierten Sie neben ”proletkultischen Songs” und dem zu häufigen Auftauchen des Namens Ernst Busch auch ”rechtsopportunistische Tendenzen”. Damit gemeint waren ”mehrere Liedplatten, die, mit der Absicht den USA-Imperialismus zu karikieren, ganze Strecken ’heißester’ Jazzmusik enthalten (z.B. das Lied ’Ami go home’)”. Wie standen Sie zum Jazz damals?
Der Jazz wurde und wird meines Erachtens überbewertet. Er gilt als eine spontane Volksmusik, geboren von den Schwarzen in Amerika. Und ich habe mich immer dagegen gewandt, den Jazz salonfähig zu machen, nur weil er angeblich eine Protestmusik der Schwarzen sei. Denn das stimmte gar nicht. Die Weißen haben sich den Jazz ganz schnell unter den Nagel gerissn. Und diejenigen Schwarzen, die Jazzvertreter waren, sind nicht unbedingt Kämpfer für die Gleichberechtigung der Rassen gewesen. Interessant ist der Ursprung in New Orleans, wo tatsächlich die Schwarzen aufgrund der ihnen aufgezwungenen Mittellosigkeit mit ganz einfachen Instrumenten wie dem Waschbrett oder diesen Ölfässern eine tolle Musik hervorgebracht haben. Vor allen Dingen konnten sie improvisieren, das war eine große Leistung. Aber was aus dem Jazz geworden ist, das hat damit nichts mehr zu tun. Wenn ich heute höre: ”klassischer Jazz” – dann sträuben sich mir schon die Haare. Man will nun den Jazz gleichberechtigt neben der klassischen Symphonik ansiedeln, dabei hat das nichts miteinander zu tun.
Hatten Sie damals die Anweisung, den Jazz-Anteil im Programm bei der Lied der Zeit zu reduzieren?
Nein, eigentlich nicht.
Aber Sie selbst haben den Jazz nicht besonders gemocht?
Nee, ich mochte den Jazz nicht. Aber das ist auch übertrieben dargestellt worden. Ich wurde in der Richtung sogar einmal in einem Spiegel-Artikel madig gemacht. Dieser Text erschien in den 60er Jahren. Darin wurde Professor Knepler fälschlicherweise als Leiter der Abteilung Musik im Ministerium für Kultur benannt. Und ich, sein Referent, wurde mit der bedauernden Feststellung zitiert, die ”lärmende Jazztrompete” habe den ”dezenten Stehgeiger verdrängt”. Da habe ich an die Redaktion des Spiegel geschrieben und gebeten, mir doch mal zu sagen, aus welcher Quelle sie diesen Ausspruch hätten, der könne niemals von mir stammen. Darauf kriegte ich als Antwort: ”Wir pflegen unsere Informanten nicht bekannt zu geben.”
Die ideologische Gleichsetzung, die damals in der Kulturpolitik der DDR üblich war, also zu sagen: Amerikanischer Jazz = US-Imperialismus, lässt sich aber doch nicht leugnen …
Naja, wenn ich das damals so ausgedrückt haben sollte, dann habe ich sicher im Überschwang ein bisschen daneben gegriffen. Ich würde es heute niemals so formulieren. Mit dem Imperialismus hatte das nichts zu tun. Ich fand diesen Jazz-Kult überzogen. Improvisation ist eben nur ein Teil der Musik.
”Mit Lied der Zeit war Busch am Ziel seiner Wünsche angelangt: Er konnte machen, was er wollte.”
In Ihrem Bericht von 1952 ging es nicht um improvisierte Musik. Da ging es um ”Ami go home”, das war ja eher ein Marschlied wie oft bei Busch, und in einer Aufnahme-Version gab es eine kleine Passage mit einem etwas wilderen Akkordeon und einem leicht versoffenen Klavier. Aber ”ganze Strecken heißester Jazzmusik” waren da eigentlich nicht drin …
Sie haben recht, das war ein falsches Beispiel. Da muss ich mich nachträglich distanzieren.
Ein Punkt, den die Kunstkommission auch stark kritisiert hat, war der sogenannte Formalismus in der Musik. Sie haben diesen Begriff damals sehr genau analysiert und haben ein Referat auf der Orchesterleiter-Tagung gehalten und den Orchesterleitern erklärt, was Formalismus ist, dass es sich dabei sozusagen um inhaltsleere Musik handelt. Auf der anderen Seite haben Sie den Proletkult bei Busch angeprangert. War das nicht ein Widerspruch? Zu sagen: Es darf nicht inhaltsleer sein, aber es darf auch nicht zu viel politischer Inhalt sein?
Es ging ja beim Proletkult nicht darum, dass darin zu viel politischer Inhalt zu finden wäre. Es ging darum, dass dieser Inhalt auf primitive Weise dargestellt wurde. Ich habe ja das Beispiel vom Adenauer in den Zweigen des Tannenbaums genannt.
Würden Sie sagen, dass dies die beiden Hauptkritikpunkte an Lied der Zeit waren: Formalismus auf der einen Seite und Proletkult auf der anderen Seite?
Ja, das kann man sagen. Aber, wissen Sie, ich habe das so gesehen: Busch war endlich am Ziel seiner Wünsche angelangt. Er konnte machen, was er wollte. Ihm stand ein riesiges Instrument zu Gebote, womit er jetzt seine Lieder bringen konnte. Das war sehr verführerisch für ihn. Er hat nur noch Busch gesehen. Was nicht Busch war, das war zweite Garnitur.
War er egozentrisch?
Ja, er war meines Erachtens auch eitel. Aber er hat mir auch die Story erzählt, wie er ’45 aus dem Zuchthaus Brandenburg nach Berlin gelangt ist. Er hatte sich ’n Fahrrad organisiert und fuhr los. Unterwegs wurde er von Russen aufgehalten. Die haben ihm das Fahrrad wegnehmen und ihn festhalten wollen. Da hat er gesagt: ”Ich bin Ernst Busch!” Und da ist ’n Offizier dazugekommen und hat gesagt: ”Singen!” Und da hat er gesungen, und da haben sie ihn laufen lassen. So hat mir das Busch erzählt.
”Die DDR-Leuchtturmwärter der Musikwissenschaft standen unter dem Einfluss des Stalin-Kultes.”
Das ist eine schöne Geschichte, die er oft erzählt hat. Ich glaube, dass Busch mit diesen Geschichten auch großen Eindruck machen konnte gerade bei jungen Leuten. Sie waren damals 26 Jahre alt, als Sie mit der Verstaatlichung von Lied der Zeit befasst waren. Ich frage mich … Woher haben Sie eigentlich das Selbstbewusstsein genommen, als junger Mann solche weit reichenden Entscheidungen und Beurteilungen zu fällen? Waren Sie im Vollbesitz der Erkenntnis, dass Sie auf dem richtigen Weg sind? Was hat Sie so sicher gemacht?
Tja, wissen Sie, die Musikpolitik der DDR war ja ganz allgemein ein bisschen eingeengt. Das ging ja nicht nur von uns aus. Das war zum Beispiel auch im Komponistenverband so. Die führenden Leute im Verband, die alle mehr wussten als ich, waren Georg Knepler, Ernst Hermann Meyer, Nathan Notowicz und Harry Goldschmidt. Alle zusammen nannte man in der DDR das ”mächtige Häuflein” in Anlehnung an die Gruppe der fünf russischen Komponisten Mussorgski, Borodin, Balakirew, Cui und Rimski-Korsakow. Das waren damals Neuerer in der Musik gewesen, die sich gegen Tschaikowski und die anderen gewandt hatten, sozusagen gegen die Salonmusik. Es ging um ”echte” volksverbundene russische Musik, dafür stand das ”mächtige Häuflein”. Und die DDR-Leuchtturmwärter der Musikwissenschaft, Ernst Hermann Meyer und seine Kollegen, haben auch etwas Neues schaffen wollen. Das war natürlich alles diktiert und stand auch unter dem Einfluss des Stalin-Kultes. Stalin hatte ja zum Beispiel Schostakowitsch wegen Formalismus kritisiert. Shdanow war sein Adlatus dafür. Das bestimmte irgendwie das Klima. Auch den Direktiven, die wir aus dem ZK der SED oder sonstwoher bekamen, merkte man diesen Einfluss an. Da ging es gegen den Formalismus, und damit war ja vor allem der westliche Formalismus gemeint, von dem man sich in der DDR abgrenzen wollte. Nun hat es ja tatsächlich im Westen krumme Wege gegeben, die man kritisieren konnte.
Zum Beispiel?
Die ganze Zwölftonmusik ist und bleibt nach meinem Dafürhalten eine Schreibtischmusik. Sie wird niemals Bestand behalten in der Musikkultur.
Warum?
Weil sie praktisch eine konstruierte Musik ist, eingezwängt in feste Regeln. Ich weiß nicht, ob Sie die Regeln der Zwölftonmusik kennen …
Ich habe mich mit Zwölftonmusik nur oberflächlich beschäftigt.
Vereinfacht gesagt:Im Thema müssen alle 12 Töne vorkommen. Es darf keine Anklänge an die Tonalität geben. Und dann müssen diese sogenannten Reihen, man spricht ja auch von serieller Musik, bearbeitet wiederholt werden. Daraus besteht das Material, aus dem dann Musik entsteht. Aber das ist eine so enge Zwangsjacke, mit der auch ein Beethoven oder ein Bach keine bleibende Musik hätte machen können.
”Ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Werk aus einem Konzertprogramm gestrichen zu haben.”
Haben Sie mit der Kunstkommission teilweise nicht auch den Künstlern in der DDR eine Zwangsjacke angepasst? Mit Richtlinien, die aus der Sowjetunion und vom ZK kamen?
Naja, eigentlich nicht. Der Anteil sowjetischer Musik war nicht sehr groß. Und die Konzertprogramme waren durchweg fast nicht zu unterscheiden von denen des Westens.
Indem Sie formalistische und proletkultische Sachen ausgeschlossen haben, indem Sie versucht haben, den Jazz auszuschließen – das ist doch eine Art von Zwangsjacke. Ich meine, in der Gesamtheit haben Sie doch das Universum der Musik beschnitten. Es fand eine Art von Zensur statt …
Nein, ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Es gab eigentlich keine Verbote. Ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Werk aus den Konzertprogrammen unserer Orchester gestrichen zu haben. Ich bekam ja alle Konzertprogramme …
Vorhin haben Sie das Weihnachtslied von Busch aus dem Jahr ’52 erwähnt …
Ja, dazu stehe ich auch. Das würde ich heute noch verbieten (lacht).
Gut, aber es gab ja noch andere Musiker in der DDR, denen Steine in den Weg gelegt wurden …
Widerstehen Sie der Versuchung, Schwarzweiß-Malerei zu betreiben! Im Westen gab es genauso Ausfälle gegen Komponisten. Die gingen nur vielleicht etwas dezenter vonstatten. Ich könnte Ihnen da einige Beispiele nennen. Ich bekam ja die gesamte West-Presse über Musik auf den Schreibtisch und war genau orientiert darüber, was dort los war. Ich machte mir keine Illusionen über die Musikpolitik im Westen. Da wurden Komponisten ignoriert und drangsaliert, das wurde nur nicht publik gemacht.
Sie haben diese Informationen ja offenbar der West-Presse entnommen. Also müssen diese Fälle, von denen Sie sprechen, irgendwie durchgesickert sein …
Naja, teilweise kriegten wir diese Dinge auch unter vier Augen von westlichen Kollegen auf Kongressen erzählt. Zum Beispiel hat man sich über Werner Egk lustig gemacht. Die drei Buchstaben seines Namens übersetzte man mit ”Ein Großer Komponist”. Und man erfand den Slogan: ”Egk mich am Orff!” Dann gab es den Fall eines Professors, der in Bayreuth die Wagner-Kinder musikalisch unterrichtet hatte. Irgendwann muss er in Ungnade gefallen sein, und er hat mir persönlich erzählt, dass er dann angefangen hat, Zwölftonmusik zu schreiben. Die Kompositionen hat er an amerikanische Millionäre verkauft, die ihren eigenen Namen daruntergesetzt und ihn gut bezahlt haben. Zu mir hat er gesagt: ”Ich habe Mist geschrieben, aber ich wollte leben! Und da habe ich diese Sachen über irgendwelche Kanäle rübergeschickt in die Hände von Leuten, die gern mit solchen Werken protzen wollten.” So etwas gab es auch.
Mit Zwölftonmusik hatten Sie wahrscheinlich erst zu tun, nachdem Sie Leiter der Hauptabteilung Musik im Kulturministerium geworden waren …
Das stimmt. Es wurden ja dann auch Zwölftonwerke geschrieben in der DDR.
”Man sagte mir: ’Dein Name ist ein rotes Tuch für Busch!’”
Haben sich Ihre Kompetenzen eigentlich durch den Posten im Ministerium erweitert?
In gewisser Weise ja. Vorher schickte man übrigens meinen ehemaligen Abteilungsleiter Hans Pischner und mich auf eine Dienstreise nach China. Pischner war Delegationsleiter, und ich war Stellvertreter. Man wollte erproben, ob Pischner und Uszkoreit auch zusammenpassen, denn Pischner sollte Leiter der Abteilung Musik werden. Diese Reise war für mich sehr anstrengend. In unserem Sonderzug durch China hatte ich immer einen chinesischen Komponisten oder Musikwissenschaftler an meiner Seite. Der hatte ein dickes Notizbuch dabei und fünf Füllfederhalter, und der hatte den Auftrag, den Deutschen, also mich, ordentlich auszupressen.
Hans Pischner kam ja vom Rundfunk und wurde dann ’54 Leiter der Hauptabteilung Musik im Kulturministerium und später Stellvertretender Kulturminister. Für Busch muss Pischner eine Hassfigur gewesen sein, das geht aus den Archivunterlagen hervor, wobei mir nicht ganz klar ist, warum. Denn Pischner hatte, verglichen mit ihnen, gar nicht so viel mit Busch und Lied der Zeit zu tun …
Das ist merkwürdig. Ich weiß nur, dass Busch großen Groll gegen mich hatte. Und ich habe darunter echt gelitten. Ich habe verschiedentlich Leute, die um ihn waren, gefragt: ”Seht Ihr nicht eine Möglichkeit, dass ich mich mit Busch mal zusammensetze? Das kann nur ein Missverständnis sein. Ich habe ihm doch nichts getan, was es rechtfertigen würde, mich derart zu verachten!” Da haben die gesagt: ”Dein Name ist ’n rotes Tuch! Gib das auf, da ist nichts mehr zu retten” Ich habe es dann aufgegeben.
Der Kulturminister Hans Bentzien ist irgendwann mal mit Pischner zu Busch gegangen, um Missverständnisse auszuräumen. Da waren Sie nicht dabei?
Nee, es wurde immer gesagt: ”Uszkoreit und Busch sollen sich möglichst aus dem Weg gehen.”
Wann haben Sie ihn denn zuletzt persönlich getroffen?
In den 60er Jahren habe ich ihn mal auf dem Rollfeld vom Flugplatz Schönefeld getroffen. Ich flog weg, und er kam gerade an oder umgekehrt, wir begegneten uns jedenfalls. Ich habe ihn begrüßt, und er erwiderte: ”Und das muss mir auch noch heute passieren!” Das war seine Reaktion. Daran merkte ich, dass er immer noch wütend war. Es hat sich aber noch ein Ereignis abgespielt, das die Geschichte vielleicht sogar noch verstärkt hat: Ich war häufig für die Programmgestaltung von Festkonzerten bei Staatsakten verantwortlich …
… darüber hatten Sie ja bei Ernst Hermann Meyer promoviert …
Ja, das war mein Steckenpferd. Bei irgendeinem Festakt Anfang der 60er Jahre, wahrscheinlich zum Jahrestag der DDR, fand ich es vom Kontext her angezeigt, Ernst Busch einzusetzen. Ich habe also Busch mit zwei Liedern ins Programm geschrieben. Becher war schon tot, Bentzien war noch nicht Minister. Es rief mich dann Staatssekretär Abusch an, der damals amtierender Minister war, und sagte: ”Sag mal, was hast denn Du da angestellt? Busch hat Deinen Namen als Autor des Programms gesehen und sofort gesagt: ’Wenn der da mitmacht, dann mache ich nicht mit!’” Da habe ich zu Abusch gesagt: ”Das ist doch kindisch! Was soll das? Es gibt keinen Grund für diese Haltung.” Abusch hat dann noch mal mit Busch geredet und ihn überzeugt. Abusch darauf zu mir: ”Ich habe den Busch von seiner Palme runtergeholt, er macht mit!” Darauf ist das Programm ins Politbüro der SED gegangen, und Ulbricht hat Busch gestrichen. Und jetzt saß ich da und war der Dumme. Was sollte Busch jetzt von mir denken? Der muss doch geglaubt haben, dass ich das mit Absicht gemacht habe: ihn erst ins Programm reinzuschreiben, um ihn dann von Ulbricht streichen zu lassen. Verstehen Sie? Solche ungewollten Dinge hatten ja eine fatale Wirkung! Das war ’ne üble Geschichte, die mich sehr getroffen hat. Ich dachte mir: ”Warum erwischt es immer mich? Warum konnte Ulbricht das nicht durchgehen lassen?”
”Die Parteispitze hat ihn als total größenwahnsinnig abgehakt.”
Warum hat Ulbricht das nicht durchgehen lassen?
Der hatte genauso seine Launen. Außerdem war Busch bei der höchsten Parteispitze nicht gut angesehen. Er hatte bei der Parteiüberprüfung verlangt, von der gleichen Kommission überprüft zu werden, die auch das Politbüro überprüfte. Er wollte sich nur den Leuten stellen, die für Grotewohl, Pieck und Ulbricht zuständig waren. Und da haben sie ihn natürlich als total größenwahnsinnig abgehakt. Seitdem ist er auch nicht mehr Mitglied der Partei gewesen.
Für Busch kam Anfang der 50er Jahre einiges zusammen, was er als persönliche Kränkungen erlebt hat: zum Beispiel die Parteiüberprüfung, aber eben auch die Probleme mit der Kunstkommission. Und er hat sich in seinen Notizen zu diesen Querelen zumindest stichpunktartig geäußert. Ich lese Ihnen das mal vor, weil Sie vorhin gesagt haben, Sie wüssten nicht, warum Busch so sauer war: ”Am 2. Mai habe ich die Bandvernichtung vorgenommen. Der 1. Mai war ein Freitag und ist Feiertag in der D.D.R. (heute noch). Montag den 4. Mai wurde der Betrieb ohne meine Mitwirkung übergeben. Aus diesem 2. Mai u. der persönlichen Bandvernichtung wollte mir die Kunstkommission insbesondere Herr Uzkoreit ein Wirtschafts Verbrechen konstruieren. Nur auf Eingreifen von dem Domprobst Kleinschmidt wurde das verhindert – Herr Uzkoreit sitzt heute noch in der selben Position im Ministerium von Becher.”
Das ist nicht wahr! Ich wollte nur das Repertoire retten! Das war für mich der goldene Fond des Betriebes!
Sie haben das nicht als ”Vernichtung von Volkseigentum” dargestellt?
Nein, das waren für mich schlicht und einfach künstlerische Werte, die jetzt den Vorlauf für einen volkseigenen Betrieb ermöglichen sollten. Denn die Schallplatten sollten ja weiter veröffentlicht werden. Wir konnten ja nicht von heute auf morgen ein komplett neues Repertoire aus dem Boden stampfen. Dass ich ihn als Wirtschaftsverbrecher belangen wollte, das kann nur Busch selbst geschlussfolgert haben. Ich höre das jetzt zum ersten Mal, dass er diese Denkweise hatte.
Der Vorwurf der ”Vernichtung von Volkseigentum” findet sich auch in den Akten, das stammt nicht von Busch …
Ich habe den ganzen Vorgang niemals mit dieser Terminologie belegt. Ich habe nur gesagt: ”Das Repertoire muss gerettet werden.” Was sollten wir mit einem volkseigenen Schallplattenbetrieb anfangen, wenn null Repertoire da ist?
Busch war von Eisler gebeten worden, die künstlerisch nicht gelungenen Aufnahmen seiner Lieder zu vernichten, weil Eisler nicht wollte, dass diese Aufnahmen in falsche Hände gerieten …
Ja, bloß wer spricht denn eigentlich das letzte Wort darüber, ob eine Aufnahme künstlerisch gelungen ist oder nicht?
”Die Bandvernichtung habe ich als kulturpolitischen Verlust empfunden.”
Juristisch gesehen hat Busch die Bandvernichtung wohl am falschen Tag durchgeführt. Hätte er die Sache zwei Tage vorher durchgezogen, dann wäre es ja noch sein Betrieb gewesen. Dann hätten Sie schlecht etwas dagegen sagen können …
Juristisch mag das so sein. Aber ich habe das nie als juristische Frage angesehen. Ich habe das als kulturpolitischen Verlust empfunden! Ich hatte den Busch sogar im Verdacht, dass er in seinem wahnsinnigen Zorn alles vernichten könnte, auch seine eigenen Sachen und damit sich selbst. Dass er nach dem Motto handeln könnte: ”Wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie die DDR auch nicht haben!” Als solchen Typen kannte man ihn ja. Busch war jemand, der richtig aus der Haut fahren konnte.
Ein anderer Punkt, den Busch an Ihrer Person festgemacht hat, war Ihre Ablehnung einer Version von ”Dank Euch, Ihr Sowjetsoldaten”. Hans Bentzien hat das ’61 in einem Schreiben an Alfred Kurella erwähnt, nachdem er zusammen mit Pischner einen Besuch bei Busch zu Hause gemacht hatte. Es ging um die Vertonung von Eisler, die angeblich nicht produziert werden durfte. Stattdessen sei der Vertonung von Meyer der Vorzug geben worden. Bei Bentzien heißt es: ”Genosse Uszkoreit gibt das zu und hält es für einen Fehler, das getan zu haben.” Erinnern Sie sich daran?
Also, mit Busch habe ich über diese Frage überhaupt nicht gesprochen. Das Lied ist mir bekannt, auch dass es Meyer vertont hat. Ich war damals wahrscheinlich der Auffassung, dass man nicht zwei konkurrierende Vertonungen bringen kann. Und als ich mich für eine Vertonung entscheiden sollte, habe ich gesagt: Ich stehe für die von Meyer ein. So etwa war meine Haltung. Meyers Melodie war leichter zu singen, war eingängiger. Das Lied wurde auch viel nachgesungen in dieser Zeit: (singt) ”Sterne unendliches Glühen …” – Aber das war kein Affront gegen Eisler. Und wenn der Eisler sich beleidigt gefühlt hätte, dann hätte ich das zu hören bekommen. Gegen Eisler kann ich nie was gehabt haben. Ich erinnere mich noch, wie ich, das muss so um ’60 gewesen sein, den ersten Band seiner Lieder druckfrisch auf den Schreibtisch bekam. Das war sozusagen das Bestätigungsexemplar – ich hatte ja darauf gedrängt, dass die rauskommen, die Eisler-Lieder. Und als der Band nun vor mir lag, dachte ich mir: Jetzt ruf ich den Eisler an! Ich rief ihn also an und sagte: ”Herr Eisler, ich habe Ihnen was zu geben, kommen Sie mal zu mir!” Eisler kam zu mir, und ich überreichte ihm ganz feierlich das erste Exemplar des ersten Bandes seiner Lieder. Und da sagte er: ”Den behalten Sie! Ich schreibe Ihnen eine Widmung rein.” Er hat mir einige sehr freundliche Zeilen hineingeschrieben. Leider ist dieser Band auch unter den beschlagnahmten Sachen nach meiner Republikflucht gelandet. Ich habe später versucht, herauszufinden, ob die Staatsbibliothek oder die Städtische Bücherei diesen Band noch besitzt, aber das war vergeblich. Meine Bücher und Schallplatten wurden ja an die Bibliotheken gegeben.
Hatten Sie eigentlich privat Schallplatten von Busch?
Natürlich. Ich hatte ’ne riesige Schallplattensammlung. Ich bekam ja von allen Schallplatten, die herauskamen, Belegexemplare.
Haben Sie sich privat auch mal so ’n Busch-Lied angehört oder eher nicht – nach diesen Streitereien mit ihm?
Ach, sicher – vielleicht nicht gerade andachtsvoll (lacht). Aber ich habe es immer fertiggebracht, und dazu musste ich mich gar nicht zwingen, zwischen dem Sänger Busch, den ich nach wie vor verehre, und dem irre gewordenen Feind Busch zu differenzieren. Das waren für mich zwei verschiedene Seiten seiner Persönlichkeit.
Erinnern Sie sich noch an Karl Kleinschmidt?
Eigentlich mehr an seinen Sohn, der auch Musikwissenschaft studierte. Der Dompastor Kleinschmidt, ja …
Er war gut befreundet mit Busch, ist zeitweise wohl auch wie sein persönlicher Manager aufgetreten. Im Jahr ’53 hat er einen Briefwechsel mit dem Vorsitzenden der Kunstkommission, Helmut Holtzhauer, gehabt. Kleinschmidt beklagt sich darin über Holtzhauers und Ihr Vorgehen gegenüber Busch und Lied der Zeit, und Holtzhauer erklärt dann, dass alles korrekt abgelaufen sei. Kleinschmidt schreibt nicht sehr freundlich über die Kunstkommission und über Sie, Sie sind der ”Usz-Mitarbeiter” für ihn, weil das offenbar Ihr Kürzel damals war.
Das stimmt, das war mein Kürzel. Aber dieser Briefwechsel ist mir gar nicht geläufig.
Holtzhauer erwähnt ein Telefonat zwischen Ihnen und Busch, in dem Sie von Busch beleidigt worden seien. Dazu Kleinschmidt: ”Der Hinweis Ihres Briefes auf ein Telefongespräch zwischen Ernst Busch und Ihrem Usz-Mitarbeiter ist mir unverständlich. Ich weiss von einem solchen Gespräch nichts. Ich weiss nur, dass Ihr Mitarbeiter Herrn Ernst Busch ahnungslos oder böswillig tödlich beleidigt hat, und halte es unbesehen für verständlich, daß Herr Ernst Busch sich dagegen mit dem Temperament gewehrt hat, das alle seine Freunde und Verehrer an ihm lieben.” Erinnern Sie sich an dieses Telefonat mit Busch? Dass es da zu Beleidigungen kam?
Schon möglich, aber so hochdramatisch kann es eigentlich nicht gewesen sein. Das dramatischste Telefongespräch mit Busch war nach meiner Erinnererung das mit dem Weihnachtsbaum. Aber da hat er mir nur entgegengehalten: Wenn der Staatspräsident das gut findet, dann brauchst Du es ja nicht abzulehnen!
Fühlten Sie sich bei diesem Gespräch mit Busch von oben herab behandelt?
Ja. Nebenbei bemerkt habe ich Kleinschmidt nicht sehr geschätzt. Ich habe ihn zwar persönlich nicht gekannt, aber ich wusste, was er machte und wie er auftrat: Er war eben der sozialistische Dompastor. Es war der Partei sicher ganz angenehm, dass sie so eine Stütze in der Kirche hatte, aber er hatte beispielsweise auch nicht das Ansehen seiner evangelischen Pfarrerkollegen.
”Die Kunstkommission hatte einen schlechten Ruf, und den musste auch Holtzhauer ertragen.”
Was mir auffällt an diesem Briefwechsel ist, dass sowohl Kleinschmidt, als auch Holtzhauer glauben, in der jeweils höheren Position zu sein. Beide legen ’ne Art von Arroganz an den Tag. Holtzhauer schließt seinen Brief mit dem Satz, für ihn sei die Angelegenheit hiermit erledigt. Darauf Kleinschmidt: ”Sie betrachten den Gegenstand meines Briefes (…) als erledigt. Das ist die Tonart des alten Preussen. In unserer demokratischen Ordnung bittet der Staatsangestellte den Beschwerdeführer allenfalls, die Angelegenheit als erledigt zu betrachten. Der Schlussatz Ihres Briefes ist also jedem Staatsbürger gegenüber fehl am Platze. Er ist es doppelt, wenn damit auf die Eingabe eines Volkskammermitgliedes geantwortet wird.” Und in diesem Stil geht es weiter. Waren Kleinschmidt und Busch sozusagen ein Einzelfall oder haben sich die Leute generell von der Kunstkommission schlecht behandelt gefühlt?
Die Kunstkommission hatte einen schlechten Ruf, und den musste auch Holtzhauer ertragen. Aber ich sah mich davon nicht so sehr betroffen, das galt mehr der Theater- und Literaturabteilung. Denn ich war in der glücklichen Lage, wie auch meine Mitarbeiter, dass die hohen Funktionäre sich um die Musik wenig kümmerten und sich auch nicht zwingen ließen, Entscheidungen zu treffen, weil sie sagten: ”Davon verstehe ich nichts!”. Der Abusch hat mich mal angerufen und gesagt: ”Ich kriege ständig Belegplatten vom VEB Deutsche Schallplatten, ich höre mir die gar nicht an. Ich habe kein Verhältnis dazu, du kannst sie von mir haben.” Ich darauf: ”Ich kriege ja selber welche.” – ”Na, dann kannste sie verschenken”, sagte er.
War das der Grund, warum die ganze Sache mit Lied der Zeit immer verschleppt wurde? Weil sich niemand zuständig fühlte? Ich meine, bevor die Kunstkommission kam, und bevor Sie das vorantrieben, hätte sich ja schon jemand um die Verstaatlichung kümmern können. Busch wollte das ja schon lange, und 1953 war ja ziemlich spät, wenn man es mit anderen Betrieben vergleicht …
Ich meine, diese Verstaatlichung stand im Raum: Die Hutpressen in Ehrenfriedersdorf, der fehlende Schellack, der zum Teil aus Indien importiert werden musste – das waren alles ökonomische Zwänge. Dazu kam die enge musikalische Begrenztheit des Ernst Busch. Ich habe dann sicher nicht nur einmal, sondern mehrmals zu Holtzhauer gesagt:”Der Betrieb muss erweitert werden, der kann nicht GmbH bleiben. Der muss bei der Plankommission mit drinstehen, damit die Materialbelieferung gewährleistet ist. Da sagte Holtzhauer: ”Ich stimme Dir zu, es ist jetzt nämlich auch die Langspielplatte im Kommen, dadurch wird sich einiges ändern.” Die Tschechen mit ihrer Firma Supraphon waren die Ersten, die damit ankamen. Und die suchten jetzt auch in uns Verbündete, weil sie ihren Export erweitern wollten. Der in einen VEB umgewandelte Betrieb hatte dann bald, meines Erachtens sogar schon ab Ende ’53, die erstenLangspielplatten im Programm. Ich kann mich noch an Gespräche mit Holtzhauer erinnern, wo wir gesagt haben: ”Wir müssen diese Langspielplatte aus Vinyl unbedingt einführen, das bedeutet eine Verfünffachung der Spieldauer!” Man konnte ja keine Symphonie bringen auf der Schellackplatte, die hatte ja nur ’ne Spieldauer von sechs, acht Minuten. Noch nicht mal ein symphonischer Satz konnte am Stück gebracht werden, alles musste zerstückelt werden, und die Tonqualität war auch schlecht. Das waren Gründe, dass da mächtig Druck dahinter gesetzt wurde. Und die Tschechen lieferten uns auch als Erste die Masse zur Herstellung der Langspielplatten.
”Lied der Zeit – Das war eine patriarchalische Autokratie.”
Gab es anfangs eigentlich zumindest die Überlegung, Busch in irgendeiner Funktion in den neuen VEB mit zu übernehmen?
Nein. Ich kann mich jetzt nicht detailliert erinnern, dass diese Frage diskutiert worden ist. Aber ich hätte in jedem Fall gesagt, auch in der damaligen Denkweise: ”Busch könnte in dem Betrieb nur stören.” Er war einfach zu sehr Autokrat. Das war ja eine patriarchalische Autokratie, die GmbH Lied der Zeit. Busch bestimmte alles. Von dieser Denkweise wäre er nicht abgegangen. Das hätte Hauen und Stechen gegeben, wenn der Busch da weitergemacht hätte.
Hatte er die Erwartung, dass er in dem neuen Betrieb noch was zu sagen hat?
Ich glaube, er hat selbst begriffen, dass das nicht funktionieren würde. Er wollte ja auch nicht verramscht werden. Er war der Boss gewesen. Wer will schon vom Thron steigen? Man soll nicht einen Leiter als Subordinierten in einem Nachfolgebetrieb einsetzen.
Er hätte ja so ’ne Art Frühstücksdirektor werden können …
Ja, Ehrenmitglied oder so (lacht).
Busch muss sich jedenfalls ausgebootet gefühlt haben. Sonst wäre er nicht so wütend gewesen …
Ich habe den Grund für seinen Zorn nie ganz verstanden. Wenn er mich natürlich verdächtigt hat, ich hätte ihn als Wirtschaftsverbrecher dargestellt, dann wird seine Reaktion verständlich …
Das war im Raum gestanden genauso wie künstlerische Beschneidung und Bevormundung durch die Kunstkommission, über die wir schon gesprochen haben. Sie haben vorhin gesagt, die Kunstkommission habe einen schlechten Ruf gehabt. Das ging ja so weit, dass Künstler und Intellektuelle sich bitter beklagten. Wolfgang Harich hat das getan oder auch Friedrich Wolf, der noch auf dem Sterbebett angeblich gesagt hat, die Partei müsse in Ordnung bringen, was die Kunstkommission angerichtet hat im Fall von Ernst Busch und Gret Palucca. Was war denn eigentlich bei Palucca vorgefallen?
Nichts, soweit ich weiß. Aber das war nicht mein Bereich. Ich weiß nur, dass ein leitender Mitarbeiter, Tilo Vogel, in der Palucca-Schule als Direktor eingesetzt wurde. Aber die Palucca-Schule wurde niemals in Frage gestellt. Natürlich muss man eines sagen: Holtzhauer wurde gehasst. Er hatte eine sehr unverbindliche, kurz angebundene Art. Er war sehr belesen, sehr intellektuell, durchaus auch im etwas abfälligen Sinne: Er wusste, was er wusste. Und die Art und Weise, wie er seinen Standpunkt durchsetzte, hatte manchmal etwas Cholerisches. Ich habe darunter eigentlich nicht zu leiden gehabt, ich konnte ganz gut mit ihm. Aber dem Kollegen Hartig hat er mal ’n ganzen Leitz-Ordner vor die Füße geschmissen und hat gesagt, er soll ihm so ’n Mist nicht noch mal vorlegen.
War Holtzhauer sozusagen ein verdienter Kommunist, war er im Widerstand gewesen?
Er hat im Zuchthaus gesessen in der Nazizeit.
Was war der Grund dafür, dass Holtzhauer, der Chef der Kunstkommission, nicht übernommen wurde ’54 ins neue Kulturministerium?
Naja, es gab eben ’ne gewisse Unzufriedenheit. Und dann müssen Sie sehen: Das war die Zeit des sogenannten Neuen Kurses, der nach dem 17. Juni propagiert wurde. Die Partei sagte: ”Die Künstler müssen beruhigt werden! Die dürfen nicht mehr massenhaft abhauen!” Es ging also darum, die Kulturszene zu besänftigen, und Holtzhauer fiel dieser Entwicklung zum Opfer. Alle, die diesem neuen, weichen Kurs im Wege standen, wurden einfach beseitigt. Dazu gehörte Holtzhauer.
Jemand, den man heute als Hardliner bezeichnen würde?
Ja. Er hat selbständig Entscheidungen getroffen und sich nicht jedes Mal gefragt, wie man das wohl in Moskau handhaben würde. Ich kann mich noch erinnern, wie das war, als ’56 die Chruschtschow-Rede gegen Stalin bekannt wurde: Da unterhielt ich mich mit Hartig, und der sagte zu mir: ”Jetzt wirst Du sehen, wie sich die Leute, die dem Stalin in den Hintern gekrochen sind, beeilen werden, da wieder rauszukommen!”
Busch hatte ja ’49 auch Lieder auf Stalin gesungen …
Das war gang und gäbe. Da hätte keiner, auch nicht aus Überzeugung, gewagt zu sagen: ”Das mache ich nicht.”
Wie würden Sie Hans Pischner charakterisieren?
Ich war ja sein Stellvertreter in der Hauptabteilung Musik im Kulturministerium. Es dauerte nicht lange, da sagte er zu mir: ”Man hat mir angetragen, stellvertretender Minister für Kultur zu werden.” Ich habe geantwortet: ”Warum willst Du dir das antun? Als Hauptabteilungsleiter bist Du auf Deinem Gebiet tätig, da bist Du sattelfest. Aber als stellvertretender Minister musst Du auch außermusikalische Entscheidungen treffen, musst Dich um die Bildende Kunst kümmern und vieles andere.” Also, ich habe ihm abgeraten, aber er war Karrierist, er wollte unbedingt. Der Vorteil für mich war: Ich wurde dadurch ’56 Hauptabteilungsleiter im Kulturministerium. Und ’57 habe ich promoviert, in aller Stille übrigens …
Hatte man Ihnen das nahegelegt: zu promovieren?
Nee, überhaupt nicht. ich musste mir einen Monat Arbeitsbefreiung erkämpfen, um meine Dissertation ins Reine zu schreiben. Und als sich das herumsprach, dass ein Mitarbeiter des Ministeriums promoviert hatte, meldete sich Becher bei mir und gratulierte. Er hat das sehr geschätzt. […]
(Exkurs über die Frage, inwieweit sich Hans-Georg Uszkoreit von den Anschuldigungen der Künstler und Intellektuellen betroffen gefühlt hat, die gegen die Kunstkommission vorgebracht wurden)
”Kurella fragte: ’Kann man nicht durch Änderung des Textes diese schöne Musik der Bach-Passionen retten?’”
Hier vielleicht noch eine Episode: Eines Tages kam ein Dompastor aus Mecklenburg zu mir und sagte: ”Es passiert ein Unglück in Güstrow! Die Matthäus-Passion soll aufgeführt werden, und jetzt bekomme ich kurz vor Toresschluss die Nachricht, dass den Musikern des Volkstheaters Rostock durch einen Beschluss der dortigen Bezirksleitung die Mitwirkung untersagt worden ist. Wenn die nicht mitwirken dürfen, dann platzt die Aufführung! Das gibt einen mittleren Aufstand in Güstrow, wir haben schon 5000 Karten verkauft!” Da habe ich schnell geschaltet, weil ich verhindern wollte, dass 5000 Leute auf den Barrikaden stehen wegen so einem irrsinnigen Beschluss. Ich rief Alfred Kurella vom ZK an und sagte: ”Ich habe eine ganz dringende Angelegenheit, kann ich schnell vorbeikommen?” Ich durfte zu ihm kommen und trug ihm die Sache vor. Er sagte: ”Ich bin der gleichen Meinung. Gut, dass Du mir das erzählt hast! Ich rufe sofort Grotewohl an!” Er rief in meinem Beisein Grotewohl an, teilte ihm mit, was passiert war. Grotewohl sagte: ”Ich kläre das gleich!” Ich sollte dann noch den Bescheid abwarten, und vielleicht zehn Minuten später rief Grotewohl bei Kurella an und teilte mit: ”Wir haben den Beschluss der Bezirksleitung außer Kraft gesetzt, die Musiker können natürlich spielen.” Hinterher gab es ein interessantes Gespräch mit Kurella, der froh war, dass die Sache gut gelöst war, und der nun zu mir sagte: ”Sag mal, das ist doch so ’ne schöne Musik, diese Bach-Passionen und diese Oratorien. Könnte man nicht durch Änderung des Textes die Musik retten?” Da habe ich erst mal nach Luft geschnappt und dann gesagt: ”Genosse Kurella, das haben die Nazis versucht! Die Nazis störten sich bei den Händel-Oratorien an Judas Makkabäus und den ganzen jüdischen Namen. Judas Makkabäus wurde umbenannt in ’der Feldherr’. Auf diesem Gleis befänden wir uns dann! Ich rate dringend ab, auch nur daran zu denken, so etwas zu tun!” Er sah das dann auch ein, aber solche Überlegungen hat es gegeben.
Unglaublich. Aber interessant finde ich auch Ihren Vergleich mit der Zeit des Nationalsozialismus. Dieser Vergleich wurde ja Anfang der 50er jahre oft gezogen, wenn Leute der Meinung waren: Hier läuft was schief! Kleinschmidt schreibt auch sinngemäß an Holtzhauer: ”Sie wollen doch wohl nicht in ein Fahrwasser geraten, das wir alle nur zu gut kennen, und von dem wir glauben, es sei Geschichte.” Kannten Sie diesen Vorwurf auch? Hat man der Kunstkommission mehrmals vorgehalten, sie würde so handeln wie es in der jüngsten Vergangenheit üblich war?
Nein, uns wurde höchstens vorgeworfen, dass wir übers Ziel hinausschießen würden: Sozialistische Diktatur oder Diktatur des Proletariats falsch verstanden, das hat man der Kunstkommission vorgeworfen.
Haben Sie sich diesen Schuh angezogen?
Ich war jedenfalls bemüht, nicht in dieses Fahrwasser zu geraten. Ich könnte mehrere solcher Beispiele bringen, wie ich es eben genannt habe, wo deutlich wird, dass ich dann doch versucht habe, die Vernunft walten zu lassen.
Sie hatten bei der Kunstkommission schon als junger Mann mit Ende 20 ein ziemlich großes Arbeitsfeld. Wie haben Sie das eigentlich bewerkstelligt?
Das war eine Frage der Organisation. Ich war darum bemüht, möglichst viele Aufgaben auf meine Mitarbeiter aufzuteilen und die Dinge nicht alle an mich zu ziehen.
Was waren das für Mitarbeiter? Kamen die aus der Kultur?
Das waren alles Fachleute.
Denn das war ja die Kritik der Künstler: Die Stakuko-Leute seien zu weit weg von der Kultur …
Das war nicht so. Die mussten alle eine entsprechende Berufsausbildung haben.
Wieviele Mitarbeiter hatte denn die Kunstkommission, bevor sie aufgelöst wurde?
Ich schätze, dass wir etwa 100 Mitarbeiter waren. Wir saßen zusammen mit dem Amt für Literatur und Buchwesen in der Wilhelmstraße, wo jetzt die Musikhochschule ”Hanns Eisler” ist. Das war mal die Privatkanzlei von Goebbels gewesen.
Der andere Vorwurf der Künstler war, dass die Kunstkommission nach strikten Plänen vorging. Wurde die Kultur behandelt wie andere Produktionszweige auch?
Nein, man hat da schon unterschieden. Die Kultur sollte den wirtschaftlichen Aufbau unterstützen. Die Leute sollten zufrieden sein, sollten gute Musik hören können und qualitativ hochwertige Schallplatten kaufen können. Unser Kummer war, dass wir den Bedarf an Schallplatten niemals decken konnten, obgleich die Pressen heiß liefen. Am Ende der DDR hat der VEB Deutsche Schallplatten nach Steuer- und allen anderen Abzügen 100 Millionen Mark Gewinn gebracht.
”Auch im Kulturministerium war ich niemals in Versuchung, meinen Einfluss voll auszuspielen.”
Hat man die Schallplattenfirma gleich nach der Umwandlung in einen VEB ’53 technisch aufgerüstet?
Das passierte erst, als Harry Költzsch der Chef wurde. Er war ja studierter Volkswirtschaftler und Leiter der Haushaltsabteilung in der Staatlichen Kunstkommission gewesen. Becher hat ihn dann gefragt, ob er den Posten bei der Schallplatte übernehmen will. Das Interregnum musste beendet werden. Költzsch hat sich schnell gut eingearbeitet und hat das dann 35 Jahre lang gemacht.
War Költzsch eigentlich auch in erster Linie Klassik-Liebhaber?
Nee, seine Lieblingsmusik war eigentlich Mireille Mathieu. (Lachen) […]
Sie waren dann von ’54 bis ’63 in Bechers Ministerium. Aus Archivdokumenten und Zeitzeugenaussagen geht hervor, dass es auch in dieser Zeit Beschwerden von Künstlern gab über ein zu hartes Vorgehen von ihrer Seite. Zum Beispiel hat der Dresdener Dirigent Heinz Bongartz solche Vorwürfe erhoben. Ist Ihnen das noch in Erinnerung?
Ja, mit Bongartz gab es mal eine Divergenz. Ich weiß aber nicht mehr, worum es da ging. […]
Wissen Sie, mir ist glücklicherweise dieses Machtdenken ferngeblieben. Ich wusste, welchen Einfluss ich hatte. Wenn man in so einer Funktion ist, dann weiß man das einfach. Aber ich war niemals in Versuchung, diesen Einfluss auszuspielen. Ich habe einmal derb zugeschlagen, das stimmt: Da war mir mitgeteilt worden, dass man im Halleschen Symphonie-Orchester die ungarische Geigerin Maria Vermes als 1. Konzertmeisterin engagiert hatte. Und einige Musiker hätten dagegen protestiert, hieß es, ja, sie hätten lautstark vor dem Orchester gesagt, diese Frau solle sich an den Kochtopf stellen und nicht ans Geigenpult. Diese Konzertmeisterin kam zu mir und hat sich bitterlich beklagt. Da habe ich den Hörer genommen, ich war wütend, und habe dort angerufen und gesagt: ”Wenn sich die betreffenden Musiker nicht sofort bei der Kollegin entschuldigen, werde ich dafür sorgen, dass sie fristlos entlassen werden!” Da habe ich sozusagen mal die Keule geschwungen, aber ich fühlte mich auch im Recht. Ich hätte das wahrscheinlich gar nicht durchsetzen können, die zu entlassen, aber das hat natürlich gewirkt. Weil das so ’ne Ausnahmesituation war, habe ich sie auch im Gedächtnis behalten.
In Gesprächen mit Leuten aus der DDR-Kulturszene habe ich den Eindruck gewonnen, dass einige Musiker und Veranstalter sich vom Kulturministerium stark behindert fühlten. Das betraf in den frühen 60er Jahren vor allem den Jazz.
Ja, ich weiß. Damals hat mich der Theaterschriftsteller Peter Hacks zu sich nach Hause eingeladen, um mit mir über Jazz zu diskutieren. Ich bin also hingegangen, und wir haben uns dann sachlich unterhalten. Er wollte mir weismachen, dass ich falsch läge mit meiner Einschätzung des Jazz. Und ich habe versucht, den Jazz etwas differenzierter zu verstehen. Letztendlich haben wir uns dann geeinigt. Das war so eine Begebenheit, an die ich mich erinnere. […]
(Exkurs über die Rolle des Jazz in der DDR und über Vorwürfe des Jazz-Veranstalters Werner ”Josh” Sellhorn, die Uszkoreit von sich weist)
”1956 rief mich zum ersten und letzten Mal Bert Brecht an.”
Die Popularität des Jazz und überhaupt die Beliebtheit westlicher Musik in der DDR war ein kaum lösbares Problem für die Kulturadministration. Man wollte doch im Osten immer mindestens mithalten mit dem Westen, auch auf dem Gebiet der Musik …
Das stimmt, ich habe sogar Mitte der 50er Jahre mal versucht, das per Auftrag umzusetzen. Ich war damals Hauptabteilungsleiter und habe alle Komponisten der DDR aufgerufen, Sinfonien, Opern, Konzerte, Kammermusiken zu schreiben. Dafür wurde viel Geld ausgegeben: Eine Oper wurde mit 20.000 Mark honoriert, eine Sinfonie mit 5.000 bis 8.000 Mark. Paul Dessau wollte die Oper ”Herr Puntila und sein Knecht Matti” beisteuern. Ich habe ihm dann den Vertrag zugeschickt; der lautete: ein Drittel des Honorars bei Auftragserteilung, das zweite Drittel bei Ablieferung und das dritte Drittel nach Abnahme. Meine Verpflichtung bestand darin, dafür zu sorgen, dass die abgenommenen Werke auch aufgeführt werden. Darum ging es ja hauptsächlich, denn was nützt es, einen Kompositionsauftrag zu erteilen, wenn die Komposition nicht gespielt wird? Der Zuspruch war gut, die Komponisten machten sich an die Arbeit. Da rief mich zum ersten und letzten Mal Bert Brecht an: ”Herr Uszkoreit, Sie haben einen Kompositionsauftrag an Paul Dessau vergeben, darin schreiben Sie von einer Abnahme. Dessau wird nicht abgenommen, der wird angenommen und aufgeführt.” Da habe ich gesagt: ”Herr Brecht, tut mir leid, aber wir können jetzt nicht zweierlei Maß anlegen. Wir schreiben das in allen Verträgen, und ich bin nicht der Meinung, dass ich jetzt besonders anerkannte Komponisten mit einem Sonderauftrag versehen muss. Ich bin für gleiche Bedingungen. ”Gut”, sagte Brecht. Dessau lehnte dann den Auftrag ab. Er schrieb die Oper auch so.
Ohne Auftrag und ohne Geld?
Ohne Auftrag und ohne Geld.
Fanden Sie das arrogant damals?
Nee, ich fand das aus Dessaus Sicht schon verständlich. Aber ich versuchte ihm klarzumachen, dass ich jetzt nicht Sonderkonditionen einführen konnte. Wenn ich sage: Ein Werk wird abgenommen, dann wird es ja auch zur Aufführung angenommen – Ausnahmen kann man da nicht machen. Sofort wären andere Komponisten gekommen und hätten gesagt: Bei Dessau steht der Passus nicht drin.
War das generell das Problem der frühen DDR-Kulturpolitik, dass die Künstler das Gefühl hatten, es wird auf sie nicht individuell genug eingegangen?
Das kann ich nicht sagen. […]
Wie würden Sie denn ihre kulturpolitische Arbeit nachträglich einordnen? Sie waren von ’51 bis ’63 an maßgeblicher Stelle tätig. Wie sehen Sie sich selbst?
Ich war immer bemüht, meine Pflicht zu tun und meinem Gewissen zu folgen. Als 1963 ich im Kollegium offiziell verabschiedet wurde, hat Bentzien meine Verdienste herausgestellt. Er hat gesagt: ”Wenn wir heute ein Gewandhaus-Orchester haben, einen Kreuzchor, einen Thomanerchor und eine ganze Fülle von international anerkannten Kräften, dann ist das auch zu einem Teil dem Kollegen Uszkoreit zu danken.” Das war mir Anerkennung genug. Und ich durfte mir dann aus den Gemälden, die das Ministerium für Kultur besaß, ein Bild als Geschenk aussuchen.
Was haben Sie sich ausgesucht?
Einen farbigen Holzschnitt aus Polen mit Pelikanen …
… der wahrscheinlich auch in der DDR geblieben ist, als Sie in den Westen gingen …
Ja. […]
”Ich schlug eine 50/50-Regel vor, aber Abusch wollte 60/40.”
Bei Ihrer Arbeit in der Kunstkommission und im Kulturministerium ging es nicht nur um künstlerische Dinge, Ihre Arbeit stand auch im Zeichen des Ost-West-Konflikts. Bei Lied der Zeit haben Sie die westlichen Schlager kritisiert, die auf Amiga rauskamen. Auch in der Ära nach Busch gab es bei Amiga populäre angloamerikanisch geprägte Musik – das ließ sich ja nicht gänzlich umgehen. Haben Sie das dann auch kritisiert?
Das war natürlich auch wieder ’ne ökonomische Frage. Da ging es nicht nur um Ideologie. Die AWA hat alles, was in der DDR gespielt wurde, minutiös abgerechnet. Und alles, was aus dem Westen kam, war gebührenpflichtig. Dieses Geld wurde an die GEMA transferiert. Das waren jährlich zig Millionen Valuta, die gezahlt werden mussten. Ich war ja dabei, als diese sogenannte 60/40-Verordnung besprochen wurde, das muss etwa ’58 gewesen sein, das war noch zu Abusch‘ Zeiten. Die Initiative ging damals von meiner Abteilung aus. Ich hatte in der Presse gelesen, dass es in Brasilien und in Frankreich Bemühungen gab, den Import von ausländischer Musik zu drosseln, um die Künstler im eigenen Land nicht zu benachteiligen. Ich brachte darauf den Vorschlag ein, in der DDR nach dem Prinzip 50/50 zu verfahren: 50 Prozent der gespielten Musik sollten aus der DDR und dem sozialistischen Ausland stammen, und 50 Prozent aus dem westlichen Ausland, also paritätisch. Diese Vorlage hat mir dann Abusch um die Ohren geschlagen und gesagt: ”Das ist die typische Gleichmacherei mit dem Westen! Ich verlange 60/40!” Das hat Abusch mir diktiert, und so ist es auch gekommen. Diese Verordnung galt für öffentliche Veranstaltungen, im Grunde für alle Bereiche des kulturellen Lebens in der DDR.
In dieser Zeit wurde auch der berühmte ”Lipsi” eingeführt, sozusagen als Antwort der DDR auf den als westlich-dekadent geltenden Rock’n’Roll …
Ja, das war so ein Nebenprodukt dieser Entwicklung. Ich persönlich hielt davon gar nichts. Das war ein Kunstprodukt, das keine Wirkung entfalten konnte. Die Leute haben doch darüber gelacht!
War das überhaupt auf Dauer durchzuhalten, diese Boykott-Haltung hinsichtlich westlicher Popmusik?
Ach was, es wurde geschummelt an allen Ecken und Enden. Die Kapellen haben dann einfach ihre Aufstellungen, die sie bei der AWA einreichen mussten, nicht wahrheitsgemäß ausgefüllt. Aber ich muss sagen: Manchmal haben die Kapellen einen miesen West-Schlager einem wirklich guten DDR-Schlager vorgezogen, bloß weil sie der Meinung waren, im Westen sei alles besser.
Dazu trug auch der Rundfunk bei, vor allem der RIAS, der den Rock’n’Roll in die DDR hineinsendete …
Nicht nur der West-Rundfunk war unser Problem. Auch unser eigener Rundfunk unterstand uns nicht, der war ja direkt der Parteiführung unterstellt, also Gerhart Eisler. Der Rundfunk machte sozusagen seine eigene Musikpolitik. Mir wurde oft von Musikschaffenden in der DDR vorgehalten: ”Sie verlangen was von uns! Hören Sie sich mal an, was der Rundfunk so bringt!” Da musste ich sagen: ”Tut mir leid, darauf habe ich keinen Einfluss!” Der Rundfunk hat sich nicht wirklich an die 60/40-Regel gehalten. […]
”Den Chefposten an der Musikhochschule Dresden habe ich durch eine Partei-Intrige verloren.”
1963 haben Sie das Kulturministerium verlassen …
Ja, ich wollte schon seit einiger Zeit aus dem Ministerium raus. Aber ’62 kam Bentzien als Kulturminister, mit dem ich mich gut verstand. Ich hatte ihm noch von dem Job abgeraten, er hat das sogar in seinen Memoiren verewigt. Ich sagte zu ihm: ”Ich versteh‘ nicht, dass Du Minister werden willst! Das ist ein so käsiger Verein mit dem Abusch und den anderen Herren hier. Also, ich bin bald weg hier.” Benztien sagte: ”Du kannst jetzt nicht weggehen, bleib wenigstens noch ein bisschen da! Alle Leute, die ich kenne, verabschieden sich – das ist ja deprimierend.” Ich sagte: ”Gut, dann bleibe ich noch ’ne Weile, bis sich was anderes bietet.” 1963 war es dann so weit: Ich sollte als Künstlerischer Direktor zur Schallplatte gehen, mit Költzsch war schon alles verabredet, der wollte mich gerne haben. Mit ihm fand überhaupt eine hervorragende Zusammenarbeit statt. Als alles fast unterschriftsreif war, rief mich auf einmal Bentzien an und sagte: ”Kommando zurück! Der Rektor der Musikhochschule Dresden, Professor Karl Laux, muss abgelöst werden, das geht nicht mehr. Du wirst das machen!” Da habe ich dem Költzsch, der wütend wurde, gesagt: ”Du, hör mal, das wird nischt.”
Sie wollten lieber nach Dresden?
Eine Musikhochschule zu leiten, das war schon ’ne ehrenvolle Sache. Der Job bei der Schallplatte blieb mir ja immer noch. So war ich von ’63 bis ’68 an der Musikhochschule Dresden als Dozent und seit 1965 Professor für Musikgeschichte und Rektor. Ich bin da nach fünf Jahren durch eine Partei-Intrige ein bisschen rauskatapultiert worden. Kurz vorher war ich vom Senat in geheimer Abstimmung einstimmig wiedergewählt worden. Aber die Partei dort war mit mir nicht einverstanden und hat dafür gesorgt, dass ich abgelöst wurde. Ich ging dann zu Költzsch und sagte: ”Jetzt stehe ich zur Verfügung.” – ”Gut”, sagte er, ”dann kommste zu mir. Einen künstlerischen Leiter habe ich schon, Du wirst Leiter der Abteilung Wissenschaft.” Es gab bei der Schallplatte ja drei oder vier Musikwissenschaftler, die Konzeptionen fürs Repertoire erarbeiteten. Und ich wurde nun der Leiter und hatte für eine wissenschaftlich fundierte Repertoire-Gestaltung vor allem im klassischen Bereich zu sorgen. […] Zum Schluss war ich dann Chefredakteur von Eterna, war also für die gesamte klassische Musik zuständig. Da unterstanden mir ein Dutzend Musik- und Toningenieure und viele Mitarbeiter, das war an sich eine schöne Aufgabe.
Theoretisch hätten Sie in dieser Zeit noch mal den Busch treffen können, der ja seine Aurora-Reihe in Kooperation mit der Schallplatte herausbrachte …
Ich musste ihm aus dem Weg gehen. Für mich war Busch tabu. Költzsch und andere sagten zu mir: ”Halt Dich fern von Busch! Für den bist Du ein rotes Tuch!” […]
Aus den Akten geht hervor, dass sich Harry Költzsch in den 60er Jahren sehr für dieses Busch-Projekt eingesetzt hat. Er hat wohl auch angeregt, ’67 diese zwei Aurora-Mappen für die Sowjets zum Jubiläum der Oktoberrevolution zu machen, die ja ziemlich teuer waren …
Das ist richtig.
Was kostete denn durchschnittlich eine Klassik-Produktion?
Ganz unterschiedlich: 30.000 bis 40.000 Mark eine Sinfonie, 150.000 bis 250.000 Mark eine Oper. Dass auch Busch für seine Produktion einiges Geld verbraucht hat, das war mir klar. Aber ich habe mich da völlig rausgehalten. Ich habe auf diese Produktion weder befürwortend noch benachteiligend eingewirkt. Grundsätzlich fand ich es schon richtig, dass das gemacht wird. […]
Wie lange waren Sie bei der Schallplatte?
Bis zu meinem Weggang ’75.
Sie haben eine Dienstreise nach München genutzt für ihre ”Republikflucht”, um es im Obrigkeitsdeutsch der DDR zu sagen …
Ja.
War das von langer Hand geplant oder eher spontan?
Meinen Entschluss hatte ich schon zwei Jahre vorher gefasst. Das hatte einen ganz konkreten Anlass: Meine Mutter, die in Krefeld lebte, war ’72 gestorben. Und ich hatte beantragt, zur Beerdigung fahren zu dürfen. Wobei ich der Meinung war, dass dies ein ganz reales Ersuchen war. Denn ich war ’n paar Wochen vorher dienstlich auch im Westen gewesen …
Sinneswandel: ”Mit diesem Staat mache ich Schluss!”
Sie waren doch sowieso Reisekader, oder?
Eben, eben. Doch in diesem Fall hat man mich von Pontius zu Pilatus geschickt: Das Ministerium sagte, das ZK sei zuständig. Das ZK sagte, das Ministerium sei zuständig. Und dann wieder hieß es beim Ministerium, der Költzsch sei zuständig. Die haben mich buchstäblich im Kreis geschickt. Es war Wochenende, und ich fühlte mich verschaukelt. Da habe ich mir gesagt: Um Millionen Valuta-Devisen ranzuschaffen, bin ich gut genug. Aber meine Mutter unter die Erde zu bringen, das gestattet man mir nicht! Mit diesem Staat mache ich Schluss!”
Hätten Sie nach der Beerdigung im Westen bleiben wollen?
Nee, ich wollte nur zur Beerdigung und danach wieder zurück in die DDR. Ich hatte auch die begründete Erwartung, die Genehmigung zu kriegen: ’65 war mein Vater gestorben, und da bekam ich von Bentzien anstandslos eine Reisegenehmigung. Ich durfte damals sogar mit dem Auto zur Beerdigung fahren.
Waren Sie zwischenzeitlich in Ungnade gefallen?
Ich weiß es nicht. Meine letzte Auslandsreise mit Költzsch war ‚im Januar 74. Wir waren in Japan, in Tokio und Kyoto. Und auf dieser Reise habe ich den Költzsch noch mal auf Ehre und Gewissen gefragt: ”Sag mal, was war eigentlich vor zwei Jahren los, als meine Mutter gestorben war? Warum kriegte ich damals keine Reisegenehmigung?” Da sagte er: ”Das war von der Stasi von vornherein abgelehnt worden. Man hat Dich nur noch zum Schein von einer Stelle zur andern geschickt.”
Und warum hatte die Stasi das abgelehnt?
Ich habe keine Ahnung. Es ist mir völlig unverständlich, denn sie hätten dann ja auch meine dienstlichen Auslandsreisen unterbinden müssen.
Dann sind Sie ’75 in den Westen gegangen. Haben Sie Familie in der DDR zurückgelassen?
Ja, drei meiner Kinder. Mein ältester Sohn war schon im Westen. Er hatte 1968 gegen die Besetzung der Tschechoslowakei protestiert. Heute ist noch an der Rückseite der Universitätsbibliothek in Berlin zu lesen: ”DUBCEK– das haben die nicht weggekriegt, die Farbe war ziemlich haltbar. Er hatte mit anderen zusammen, den Söhnen von Havemann, mit denen er befreundet war, solche Losungen an Häuser geschrieben. Er wurde dafür zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt. Da er irgendeine der Bewährungsauflagen nicht erfüllte, musste er schließlich doch ins Gefängnis und die 15 Monate bis auf den letzten Tag absitzen. Dann wurde er entlassen mit der Auflage, sich einen Arbeitsplatz in Berlin zu suchen, andernfalls hätte er Aufenthaltsverbot für Berlin bekommen. Da kam er zu mir und sagte: ”Was soll ich machen?” Ich habe dann mit dem Direktor unserer Absatzabteilung gesprochen und gefragt: ”Sag mal, brauchst Du nicht einen Hilfsarbeiter?” – ”Natürlich, immer!” – Ich sage: ”Der hat nur den Fehler, dass er erstens mein Sohn ist und zweitens politisch gesessen hat.”– ”Macht nichts”, sagt er, ”Schick ihn her!”[…] So ist mein Sohn Hilfsarbeiter geworden in der Absatzabteilung des VEB Deutsche Schallplatten, ohne dass Költzsch das mitgekriegt hat. Er bekam das aber doch eines Tages auf den Schreibtisch serviert, rief mich zu sich und sagte: ”Bist Du von allen guten Geistern verlassen? Wie kannst Du deinen Sohn mit dieser Vergangenheit bei uns in der Firma anstellen!” Ich sagte: ”Was würdest Du machen, wenn es Dein Sohn wäre? Würdest Du dem nicht auch helfen?” Und dann wurde das stillschweigend hingenommen. Nach einem knappen Jahr war er eines Tages weg. Er ist in einem Container, der Bitumen transportierte, in den Westen geflüchtet.
”Mit einer deutschen Wiedervereinigung zu meinen Lebzeiten habe ich nicht mehr gerechnet.”
Und 1975 trafen Sie ihn wieder …
Ja, ich besuchte ihn in West-Berlin auf meiner Rückreise von München. Ich hatte mich mit ihm verabredet, und er holte mich dann am Bahnhof Zoo ab. Wir verbrachten den Tag zusammen und besprachen alles Mögliche, und am Ende sagte ich: ”Jetzt oder nie! Jetzt bleibe ich einfach hier! Wer weiß, wann ich wieder mal die Chance habe …” Ursprünglich hätten nämlich Költzsch und ich diese Reise nach München gemeinsam machen sollen. Költzsch war kurz vor Toresschluss zu mir gekommen und hatte gesagt: ”Ich kann terminlich nicht und habe auch keine große Lust. Aber alles, was wir da zu regeln haben, kannst Du auch alleine machen.” Da habe ich gesagt: ”Gut, mache ich.” Also, normalerweise war man bei solchen Reisen ins westliche Ausland zu zweit. Dadurch dass ich nun allein war, war alles einfacher. Ich hatte schon ein-, zweimal zuvor zusätzlich zu meinen Reiseunterlagen meine wichtigsten Dokumente mitgenommen bei Fahrten in den Westen. Aber dann ist es mir doch zu riskant erschienen. Wir wurden zwar als Dienstreisende nicht kontrolliert, aber wenn man mich doch kontrolliert hätte, wäre ich mit solchen Unterlagen sofort aufgeflogen.
Waren Sie kein überzeugter DDR-Bürger?
Ich war es mal gewesen. Aber ich wurde es immer weniger, vor allem als ich diese Lügnerei um die Anerkennung der Helsinki-Akte ’75 mitkriegte. Die DDR veröffentlichte den Wortlaut im Gesetzblatt, ohne dass davon etwas in der Realität eingehalten wurde. Für meine Begriffe ging es allmählich bergab mit der DDR, ohne dass ich gleich das Ende dieses Staates vorhergesehen hätte. Die Ereignisse 1989 haben mich dann eigentlich sehr überrascht. Ich hatte mich darauf eingerichtet, dass ich eine deutsche Wiedervereinigung nicht mehr erleben würde. Es gab ja diesen Ausspruch von Willy Brandt, dass man von deutscher Einheit gar nicht erst zu sprechen bräuchte, oder so ähnlich. Die Zeit, in der ich wegging, war die Ära der sogenannten Ostpolitik, die vom Westen her kam. Diese Politik der Entspannung war letztlich schuld daran, dass ich keine meiner Qualifikation entsprechende Tätigkeit gefunden habe nach meinem Weggang in den Westen. Ich hatte mich an der Musikhochschule Wuppertal beworben und sogar schon mit Handschlag bestätigt bekommen, dass ich als Professor für Musikgeschichte anfangen könnte. Und dann bekam ich kurzfristig ohne Begründung eine Absage. Dann hatte ich mich bei der Firma Philips, mit der ich engen Kontakt hatte, in Amsterdam beworben, die suchten einen Musikwissenschaftler. Ich rief meinen ehemaligen Partner dort an und sagte: ”Herr van der Vossen, Sie suchen jemanden. Ich bin jetzt hier.” – ”Ja, das weiß ich.” – Ich sagte: ”Würden Sie mich denn nehmen?” – ”Herzlich gern”, sagt er, ”aber ich lese Ihnen mal ein Fernschreiben vor von Herrn Költzsch: ’Dr. Uszkoreit ist republikflüchtig. Sollten Sie in Erwägung ziehen, ihn in Ihrer Firma anzustellen, sind unsere Beziehungen sofort unterbrochen.’ Sie werden verstehen, dass ich das nicht riskieren kann.”
Denn man hat gerne auch die Orchester-Aufnahmen vom VEB Deutsche Schallplatten in Lizenz rausgebracht …
Natürlich.
Diese Episode scheint Ihr Verhältnis zu Költzsch nicht allzu sehr belastet zu haben …
Wir verstehen uns wieder einigermaßen – auch wenn er der Meinung ist, dass die ganze Wende Käse ist, und dass es allen noch mal leid tun wird. Naja …
Würden Sie sagen, dass Sie Sozialist sind oder waren?
Ja, wissen Sie, jeder anständige Mensch müsste eigentlich Sozialist sein. All die theoretischen Grundsätze des Sozialismus kann ja jeder unterschreiben. Nur die Theorie und die Praxis klaffen doch ziemlich auseinander. Ich würde mich nicht mehr als Sozialist bezeichnen.
Ihre Erfahrungen im ”goldenen Westen”, wie es halb ironisch immer hieß, waren anfangs eher negativ …
Nee, ich hatte ja keine Illusionen. Ich hatte zu meinem Sohn gesagt: ”Mein Entschluss steht fest: Ich bleibe hier, auch wenn ich Schrauben sortiere in einem Materiallager, das ist mir egal. Ich gehe nicht aus Karrieregründen.”
Was haben Sie letztendlich beruflich gemacht im Westen?
Ich wurde nicht ganz allein gelassen. Es wurde meinethalben sogar eine Kommission gegründet, die in Köln zusammentrat. Da waren führende Musikwissenschaftler des Westens dabei, die ich persönlich kannte. Die sagten zu mir: ”Sie sind in einer so unglücklichen Zeit hierher gekommen. Bei uns herrscht an den musikwissenschaftlichen Instituten der Universitäten noch immer eine Erbfolge. Da brauchen Sie sich als Seiteneinsteiger keine Hoffnungen zu machen. Es gibt aber jetzt ein neues Weiterbildungsgesetz in Nordrhein-Westphalen in Bezug auf die Volkshochschule. Die suchen dringend wissenschaftliche Mitarbeiter. Bewerben Sie sich mal da!” Das habe ich dann gemacht. Und so wurde ich an der Volkshochschule in Schwerte stellvertretender Leiter für Kunst, Musik und Literatur. Ich habe unterrichtet, schöne Lehrprogramme gemacht und mich auch ein bisschen erholt von dem Zwang der Administration auf höchster Ebene.
Sie waren in der DDR Jahre lang in Chefpositionen gewesen. Sie haben viel aufs Spiel gesetzt durch Ihre Flucht. Hatte Ihre Familie in der DDR Nachteile dadurch?
Ja, aber nicht so direkt. Die haben mein Verhalten damals nicht ganz verstanden, wobei sie mittlerweile alle rübergekommen sind. Aber meine Familie hatte teilweise auch Verständnis für mich. Ich hatte ja keinem vorher etwas sagen können. Das wäre Selbstmord gewesen. Das war ja das Fatale an so einer Geschichte, dass man sie am Ende mit sich allein ausmachen musste.
”Ich habe eigentlich immer nur unterschieden zwischen guter und schlechter Musik.”
Lassen Sie uns zum Schluss noch mal kurz über Musik sprechen, und was Sie Ihnen persönlich bedeutet. Sie kommen ja von der Orgel, von der klassischen Musik, was man auch auf Ihrer Homepage nachlesen kann. Mich würde interessieren, ob es, abgesehen von Bach und den Klassikern, auch populäre Musik gab und gibt, die Ihnen gefällt: Unterhaltungsmusik, die Sie vielleicht als junger Mann gern mochten, zum Beispiel zu der Zeit, als Sie in Rostock als Parteisekretär an der Uni gearbeitet haben…
Ich habe eigentlich immer nur unterschieden zwischen guter und schlechter Musik. Und den Grundsatz habe ich mit gutem Ergebnis auch immer wieder vertreten. Die Beatles gehören zum Beispiel zu den Besten, die es je auf dem Gebiet gegeben hat. Die werden immer noch unterschätzt. Die werden vielleicht eines Tages noch mal hoch gewertet werden.
Ich glaube, die wurden und werden sehr hoch gewertet …
Ja, sie wurden sehr hoch gewertet – aber eigentlich mehr von der Jugend als Kult-Idole. Auf dem Gebiet der Unterhaltungsmusik sind die Lieder von Lennon und McCartney unschlagbar! Was denen eingefallen ist! Es ist nicht so, dass ich diese Art von Musik nicht gewürdigt hätte. Ich hatte ja in den 50er Jahren auch die Komponisten zu betreuen, und die kamen nicht selten zu mir und sagten: ”Wann machen Sie endlich Schluss mit dem Herbert Roth und diesen thüringischen Rennsteig-Heimatliedern und dieser schrecklichen Tanz- und Unterhaltungsmusik?” Da habe ich gesagt: ”Schreibt Lieder, die so populär sind wie die, dann bringe ich die gerne raus!” […] Es ist für meine Begriffe eine große Herausforderung, Lieder zu schaffen, die echte Popularität erreichen. Busch ist das in manchen Fällen gelungen, auch wenn vieles, von dem, was er gesungen hat, heute vergessen ist. Aber es kann ’ne Renaissance geben. Echte Leistungen bleiben bestehen. Das ist wie mit den Beatles – die bleiben. […] Ich höre mir den Busch gelegentlich sogar noch an. Kennen Sie die CD ”Fragen eines lesenden Arbeiters”? Die finde ich sehr schön. Vor allen Dingen ist die Tonqualität sehr gut, das waren ja ursprünglich ganz simple Bandaufnahmen in Mono, und die haben sie entsprechend bearbeitet, sodass der Klang jetzt einwandfrei ist.
Das sind ja auch Beethoven-Lieder drauf. Sie finden nicht mehr, dass sich Busch bei den klassischen Sachen als Sänger überschätzt hat?
Nein. Das, was er gesungen hat, das ging noch, das konnte er. Es war auch insofern für ihn nicht schlecht: Seinem Ruf in der DDR hat das ja gedient. Er ist dadurch aus dieser Barrikaden-Enge rausgekommen. Er galt ja als der ”Barrikaden-Tauber” in der Weimarer Republik. Das war sein Markenzeichen, und das war in der DDR natürlich von der Spezifik des Genres her nicht mehr so gefragt. Die gesamte Musik bestand ja aus sehr viel mehr als aus diesen Kampfliedern.
War Busch in der DDR ein Staatskünstler?
Auf seine Art war er ein Staatskünstler in der DDR. Er war ja solo, ein Unikum im besten Sinne des Wortes. Er hatte keine vergleichbaren Kontrahenten. Hermann Hähnel war nur ein schwacher Abklatsch. Busch hatte einfach diese Kehle mitbekommen, das war sozusagen genetisch bedingt. Die Stimme können Sie auch unter tausend anderen Stimmen sofort identifizieren. Die ist unwiederholbar und einmalig. Und wie gesagt: Für mich war es ein echter Kummer, dass ich diese Divergenz mit Busch hatte.
Warum haben Sie darunter gelitten?
Ich war der Meinung, dass seine Feindseligkeit völlig unbegründet war. Ich fand das unsinnig. Ich habe ihm ja nichts antun wollen!
Die Verstaatlichung seiner Firma hätte auch ohne Ihre Mitarbeit stattgefunden. Wobei die Art und Weise, wie sie abgelaufen ist, schon mit Ihrer Person verknüpft ist …
Gut, aber die Federführung hatte das Ministerium für Leichtindustrie. Wir von der Kunstkommission waren nur für den ökonomisch-kulturpolitischen Teil zuständig. […] Es ging damals natürlich auch um ganz praktische Dinge, die bei einem solchen Betrieb einfach funktionieren mussten: Es konnte nicht angehen, dass ständig die zur Herstellung nötigen Materialien fehlten. Allein der Druck der Schallplattentaschen war jedes Mal ein Drama. Die Druckerei in Gotha hat gesagt: ”Wir drucken lieber fünf Millionen Zuckertüten als 100.000 Schallplattenhüllen!” Es war das Verdienst von Költzsch, all das in den Griff gekriegt zu haben. Er hat den Betrieb am Laufen gehalten und die Produktionszahlen kontinuierlich erhöht. […]
Haben Sie Lieblingslieder von Busch, die Ihnen sofort einfallen, wenn Sie seinen Namen hören?
”Vorwärts und nicht vergessen”, ”Spaniens Himmel” und da, wo er lyrisch wird: ”Anmut sparet nicht noch Mühe”. Das hat er gut gemacht.
Interview: Jochen Voit
Foto: Jochen Voit
Textfassung autorisiert von Dr. Hans-Georg Uszkoreit am 15. 10. 2008.

Klaus Volkenborn
über maoistische Moden an der DFFB in den 70er Jahren, seinen Film "Unversöhnliche Erinnerungen" und die Wahrnehmung der linken Ikone Ernst Busch in der Bundesrepublik
„Wir haben damals gesagt: Es ist schon 'ne Menge erreicht, wenn so ein Mann im West-Fernsehen einem Millionenpublikum vorgestellt wird!“
(Gespräch am 21. April 2005 in Berlin)
Klaus Volkenborn ist Jahrgang 1945. In Aschau (Bayern) geboren wächst er in Leverkusen auf und absolviert nach der Schule eine Lehre bei einer Werbefilmfirma in Düsseldorf. Mit 22 Jahren geht er nach Berlin, wo er Wirtschaftswerbung studiert und sich in der Studentenbewegung engagiert. 1970 bewirbt er sich an der vier Jahre zuvor gegründeten Filmakademie (DFFB), besteht die Aufnahmeprüfung und spezialisiert sich auf politische Dokumentarfilme. Zusammen mit den Filmstudenten Karl Siebig und Johann Feindt dreht er 1978 ein Porträt über Ernst Busch fürs ZDF: „Vergeßt es nie, wie es begann“. In derselben Konstellation entsteht ein Jahr später der Film, der ihn bekannt macht: „Unversöhnliche Erinnerungen“ – ein bewegendes Doppelporträt zweier am Spanischen Bürgerkrieg beteiligter Deutscher, von denen der eine als Interbrigadist auf Seiten der Spanischen Republik kämpfte und der andere als Flieger der Wehrmacht auf Seiten des Putschisten Franco. In den 80er und 90er Jahren arbeitet Klaus Volkenborn erfolgreich als Regisseur und Drehbuchautor und wird zu einem der wichtigsten deutschen Dokumentarfilmproduzenten. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Andres Veiel erweist sich als äußerst fruchtbar („Die Spielwütigen“). Am 18. November 2005 stirbt Klaus Volkenborn in Berlin.
Anmerkung: Kennengelernt habe ich Klaus Volkenborn im Frühjahr 2005, als ich auf der Suche war nach einer Kopie des Films „Vergeßt es nie, wie es begann“. Ich wollte den Film im Kino Krokodil in Berlin zeigen und die beteiligten Filmemacher zu einem Podiumsgespräch einladen. Klaus Volkenborn hat sofort zugesagt, mir zu helfen. Er stellte mir die Filmkopie zur Verfügung und nahm sich Zeit für ein Interview. Ob er zum Filmabend im Mai kommen würde, konnte er noch nicht sagen. Dass gesundheitliche Gründe ausschlaggebend für sein Zögern waren, wusste ich nicht. Die Filmveranstaltung im Krokodil wurde ein Erfolg, Heide Breitel und Karl Siebig waren als Gäste gekommen – Klaus Volkenborn war leider nicht da. Als ich ihm kurz darauf die 16mm-Kopie zurückbrachte, entschuldigte er sich für sein Fernbleiben. Ich erzählte ihm stolz, dass über 100 Leute zu dem Abend gekommen seien; er freute sich und sagte, ich solle doch beim nächsten Mal einen seiner Filme zeigen, den er selbst auch gut fände. Und weil sich 2006 der Beginn des Spanischen Bürgerkriegs zum 70. Mal jährt, schlug er mir „Unversöhnliche Erinnerungen“ vor. Wir kamen überein, den Film im nächsten Mai im Krokodil zu zeigen. Diesmal würde er auch ganz sicher kommen. Er wollte über die politischen Folgen berichten, die sein Film nach der Erstausstrahlung ausgelöst hatte. Klaus Volkenborns unerwarteter Tod machte diesen Plan und all seine anderen Pläne zunichte. Was bleibt sind seine Filme.
Nachtrag: „Unversöhnliche Erinnerungen“ lief am 19. Mai 2006 im Kino Krokodil in Berlin.
Jochen Voit: Sie waren in den 70er Jahren Student an der DFFB. Wie muss man sich die damalige Akademie vorstellen?
Klaus Volkenborn: Es war natürlich anders als heute. Der Altersdurchschnitt war zum Beispiel viel höher. Da waren teilweise Leute, die schon ’nen Beruf hatten oder ein abgeschlossenes Studium, da waren Literaturkritiker dabei und was weiß ich. Sehr politisch bewusste und teilweise in der Studentenbewegung verankerte Leute. Es war ja, das ist es auch heute übrigens noch, ein sehr privilegiertes Studium, ein ziemlich teurer Studienplatz, wenn man das umrechnet, was da an Jahresetat zur Verfügung stand – jeder Student konnte pro Jahr einen Film mit einem bestimmten Etat machen, der sich von Studienjahr zu Studienjahr steigerte. Aber damals ging es den Leuten eben nicht nur ums Filme-Machen, sondern auch um politischen Einsatz. (…) Im Rahmen der Studentenrevolte hatte es ja auch eine Besetzung der Akademie gegeben (…) mit der Konsequenz, dass Studenten rausgeschmissen wurden. Das war ’68, muss also einer der ersten Jahrgänge gewesen sein. Die Filmakademie ist, soweit ich weiß, 1966 gegründet worden. Es ging damals darum, wenn ich das richtig erinnere, die Filmakademie irgendwie in den Dienst des Internationalismus zu stellen oder gegen den Vietnam-Krieg in Position zu bringen, oder was auch immer, jedenfalls: politisch zu instrumentalisieren.
Das war ja nicht die eigentliche Zielrichtung der Akademie …
Natürlich nicht, das ist ja eine Einrichtung des Bundes gewesen. Nee, die Studenten haben das gefordert. Aber mit der Administration der Akademie war das natürlich nicht umzusetzen, die hatten logischerweise andere Aufgaben. Ist ja auch ein bisschen kindisch anzunehmen, dass so was funktioniert mit ’ner staatlichen Institution, aber das waren halt so die Vorstellungen: da hat man eben die Akademie besetzt, um mit dieser Besetzung zu erreichen, dass irgendwelche Forderungen unterstützt werden (…). Die Antwort war diese mittlerweile berühmte Relegation von 18 Studenten. (…) Harun Farocki ist zum Beispiel einer von den Relegierten; es gibt ’ne ganze Reihe von Beteiligten, die später ihren Weg gemacht haben.
Haben Sie diese Ereignisse im Hinterkopf gehabt, als Sie sich für die DFFB beworben haben?
Nö, aber ich hab schon im Hinterkopf gehabt, dass das ein sehr politischer Laden ist. Ich war ja auch aktiv in der Studentenbewegung, das war schon ein wichtiger Aspekt für mich. Vorher hatte ich Werbung studiert an der Akademie für Graphik, Druck und Werbung, also Wirtschaftswerbung. Aber eigentlich war mir klar, dass ich keine Reime für Büchsenmilch machen will, dass mich so was nicht interessiert. Ich hab die Ausbildung zu Ende gemacht, bin also diplomierter Werbewirt, habe aber parallel schon Kontakte zu Akademie-Studenten gehabt, weil die eben sehr aktiv in der Studentenbewegung waren. Mit dem Werbe-Studium war ich 1970 fertig, ging dann an die FU, weil da am meisten los war. An der Filmakademie habe ich mich im Herbst und Winter ’70 beworben, da musste man ’ne Vorprüfung machen. Und die Aufnahmeprüfung war dann im Mai ’71, die ging eine Woche lang: ’nen Film machen, ’ne Szene inszenieren und was weiß ich, und dann hatte ich die Aufnahmeprüfung geschafft.
„Es gab Leute in meiner Klasse, die gesagt haben: ‚Ich fahr doch nicht durch die Ostzone!'“
Wo kommen Sie ursprünglich her?
Aus Leverkusen. (…) Nach Berlin bin ich 1967 gegangen, da war ich 22 Jahre alt.
Was für eine Vorstellung hatten Sie damals von Berlin?
Berlin, das hieß für mich zunächst Großstadt.
Stand Berlin darüber hinaus auch für politische Aufbruchstimmung?
Das fing ’67 gerade erst an. Aber die Wahrnehmung von Berlin war zu der Zeit mehr dadurch geprägt, dass es praktisch eingemauert war, ’ne Insel in der DDR. Auch dass es nicht besonders angenehm war, dorthin zu kommen. Es gab Leute in meiner Klasse, die gesagt haben: „Ich komm dich da nicht besuchen, da kann man ja nur hinfliegen“, oder: „Ich fahr doch nicht durch die Ostzone!“. Nein, wirklich – bis hin zu Sprüchen wie „Da muss man ja Angst haben, dass man nicht mehr wiederkommt …“. Das ist heute kaum mehr vorstellbar, was die Leute, auch in meiner Familie, für ein Bild von der DDR hatten. Das hieß ja auch gar nicht DDR, sondern Ostzone oder SBZ.
Ihre Eltern haben auch so geredet?
Ja. Die hatten regelrecht Angst davor, dass, wenn man da hinfährt … Zum Beispiel gab es im Westen die Ansicht, dass man zum Jahrestag des Mauerbaus am besten nicht in die DDR einreisen sollte. Das würde dort nämlich als Provokation empfunden, hieß es, man würde dann schikaniert werden (lacht) – solche Legenden hat es damals gegeben! (…) Insofern war mein Bild von Berlin auch dadurch geprägt. Und ansonsten war es halt ’ne Großstadt, das hieß: wegzukommen aus der Kleinstadt. Wobei das bei mir ja auch nicht über Nacht ging. Ich habe in Düsseldorf ’ne Lehre gemacht bei ’ner Werbefilmfirma, daher kam die Verbindung nachher zum Werbestudium. Aber als ich dann nach Berlin kam, war relativ schnell klar, dass hier mehr los ist als nur: Großstadt.
Kommen Sie aus einem konservativen Elternhaus?
Schon eher. Wobei das eine eigenartige Konstellation war: Meine Mutter war ein feuriges Jungmädel gewesen beim BDM, hat sich dafür aber sehr geschämt. Meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Und der spätere Lebensgefährte meiner Mutter war Mitglied der KPD. Sie hat im Druckgewerbe gearbeitet, und die Drucker sind ja traditionell sehr links gewesen. Und durch ihren Lebensgefährten, den sie nach dem Krieg kennengelernt hat, der dann so etwas wie ein Altlinker war, der nichts mehr mit der KPD am Hut hatte und dann SPD gewählt hat, hat sie wohl ’ne andere Sicht der Dinge bekommen. Sie ist eigentlich sehr liberal gewesen. Aber das Elternhaus insgesamt … Ich kann mich an meinen Opa erinnern, der hatte noch bis weit in die 50er Jahre hinein sein Hitlerbärtchen.
Aus Verehrung?
Ja, denk ich schon. Und über Hitler wurde bei uns zu Hause, wie bei allen in meiner Generation, kaum gesprochen. Wenn man schon mal das Thema aufbringen wollte, und sei es aus Provokation, dann hat die Oma immer gleich gesagt: „Komm, lass es sein! Verdirb jetzt nicht die Stimmung!“
Haben Sie kritische Fragen gestellt?
Natürlich.
Mit 20?
Nee, schon früher. Aber man hat schnell gemerkt: Da wird nicht gerne drüber geredet – jedenfalls solange der Opa lebte, und der lebte ja noch. Ich bin ja in einer Großfamilie aufgewachsen ohne Vater, meine Mutter war berufstätig, und meine Großeltern haben mich praktisch erzogen. Ich bin also gemeinsam mit den Geschwistern meiner Mutter aufgewachsen; meine Mutter war die älteste von vier Kindern, und ihr jüngster Bruder ist drei Jahre älter als ich, mit dem bin ich aufgewachsen als wären wir Geschwister.
Das heißt, die Anschauungen des Lebensgefährten Ihrer Mutter haben sie weniger beeinflusst …
Nee, nee. Der war damals sozusagen noch unter Verschluss. Das war ’ne nicht-öffentliche Beziehung, das ging gar nicht in den 50er Jahren. Dass die ’ne Liebesbeziehung hatten, hab ich erst später erfahren. Den kannte ich nur als Herrn Sowieso, der eben auch in derselben Firma wie meine Mutter arbeitete. Der kam dann zu Weihnachten am zweiten Weihnachtstag oder mal zu Ostern zu Besuch auch zur Familie, aber der gehörte nicht zur Familie. Das war mehr so ’n Anstandsbesuch. Erst später ist mir klar geworden, dass die sich schon damals geliebt haben müssen, dass das eine sehr enge und nicht nur kollegiale Beziehung war.
Die beiden haben das erst sehr spät öffentlich gemacht?
Ja, zumal der Mann eben noch verheiratet war – also eine ziemlich komplexe Angelegenheit (lacht). Jedenfalls hat Politik in der Erziehung in meiner Jugend gar keine Rolle gespielt.
„Ich hab mich schon als fortschrittlich gefühlt, weil ich den Spiegel gelesen habe.“
Kamen Sie erst in Berlin mit linker Kunst und Ideologie in Berührung? Oder kannten Sie schon vorher irgendwelche Texte oder Filme?
Ich hab mich schon als fortschrittlich gefühlt, weil ich den Spiegel gelesen habe. Ansonsten kannte ich gar nichts, keine Theorien, keinen Brecht, keine linke Kunst und Kultur. Ich weiß, dass ich zum 16. Geburtstag ein Buch von Böll, ich glaub: „Der Clown“, geschenkt bekommen habe. Das war sozusagen das Bildungsbürgerliche, Liberale, Aufgeschlossene, was möglich war. Aber weiter ging das nicht.
Fiel das alles für Sie damals zusammen: Linke Kultur, linke Politik und urbanes Leben?
Na ja, ich denke, die Reihenfolge war anders: Wenn man in so ’ne Großstadt kommt , fühlt man sich ja erst mal verbunden mit denjenigen seiner Generation, die da was zu sagen haben oder glauben, was zu sagen zu haben, die was tun oder was tun wollen. Allein deswegen hat man, zumindest ging mir das so, ’ne gewisse Sympathie für diese Leute und ihre Ziele. Man hatte ja auch mitgekriegt, was ein paar Monate vorher passiert war: dass Benno Ohnesorg erschossen worden war. Natürlich hatte ich das verfolgt. Da entstand schon aus einem Gerechtigkeitsgefühl heraus ’ne gewisse Auflehnung gegenüber der Obrigkeit. Also dass man sagte: „Das kann doch nicht sein, dass ein Student, der nichts gemacht hat, einfach erschossen wird!“ So weit ging das Politikverständnis schon aufgrund des Lesens von Spiegel oder von Report-Gucken oder Panorama, was es damals gab im Fernsehen: Dass der blöde Schah besser in Persien geblieben wäre – das schien mir klar zu sein. Das war eine gewisse An-Politisierung, aber ohne einen großen gesellschaftlichen oder gar theoretischen Rahmen dafür zu haben. Das war mehr: die da oben, wir da unten. Und dann kam das mit den Amerikanern und dem Vietnamkrieg dazu, und es kam zu dieser eigenartigen Melange: Einerseits hörte man die Doors und Jefferson Airplane und integrierte die amerikanische Kultur in diese Anti-War-Bewegung und andrerseits wurden aus der linken Bewegung heraus die bereits vorhandenen älteren kulturellen Produkte der Linken reingebracht, und so lernte man auch die kennen.
Gehörte Anti-Amerikanismus zur linken Bewegung damals?
Ja.
Oder ging es immer nur um den Spezialfall Vietnamkrieg?
Es war wie gesagt eine eigenartige Melange. Man liebte den Rock ’n‘ Roll und die Musik, die aus Amerika kam, und Coca Cola und den amerikanischen way of living und amerikanische Filme. Es war ja nicht so, dass sich linke Studenten nicht auch im Zoo-Palast Filme wie „Bullitt“ oder so angeschaut haben.
Unter den Filmplakaten bei Ihnen im Treppenhaus hat das mit James Dean einen prominenten Platz …
Ja, genau: James Dean – der gehörte auch zu den Helden! Mit denen ist man aufgewachsen. „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ ist ja ’n Film, der auch ein Lebensgefühl der damaligen Generation zum Ausdruck gebracht hat. Wobei der Generationenkonflikt, um den es da geht, nicht politisch geprägt war. Bei uns ist er dann politisch geprägt worden: durch den Faschismus und die unbewältigte Vergangenheit und durch die Weigerung der Elterngeneration, sich damit auseinanderzusetzen.
„Es wurde teilweise mehr Mao gelesen und politisch diskutiert als filmisch gearbeitet.“
Kommen wir wieder zur DFFB. Wie politisch war die Akademie, an der Sie ab 1971 studierten?
Es wurde teilweise mehr Mao gelesen und politisch diskutiert als filmisch gearbeitet. Das nahm manchmal groteske Züge an. Wobei es nach der Relegation, von der ich am Anfang gesprochen habe, eine schwierige Situation war – auch für die Direktion: Vorher war es ein Führungs-Duo gewesen, einer ist schließlich übrig geblieben – das war Dr. Rathsack, der dann lange Zeit Direktor an der Akademie war. Und der hat, rückblickend jedenfalls, ’ne ganz geschickte Politik gemacht. Der hat den Studenten für ’ne bestimmte Zeit unheimlich viel Freiraum gegeben. (…) Er hat gesehen, weiser Mann (lacht), dass das nicht über Jahrzehnte gehen wird, dass das ’ne temporäre Erscheinung ist. (…) Das hat aber dann zu ziemlichen Auswüchsen geführt. Es gab einen Akademischen Rat, das war das Verwaltungsgremium der Akademie, dem der Direktor vorstand. Und dieser Rat bestand aus 12 Leuten: vier Studenten, vier Dozenten und vier von der Administration, also der Studienleiter Hans Helmut Prinzler, heute Leiter der Kinemathek und des Filmmuseums, dann der Dr. Rathsack und noch zwei Leute aus der Verwaltung. Das Ganze war als Versuch gedacht, die Studenten einzubinden. Es ging um Mitbestimmung, was aber die Studenten zum großen Teil falsch verstanden haben.
Das klingt fast so, als hätten Sie sich nicht so recht als Teil dieser Studentenschaft an der Akademie gefühlt …
Ich hatte tatsächlich ein anderes Verständnis von Marx und von dem, was Sozialismus ist. Ich hatte zumindest versucht, mich auch wissenschaftlich damit zu beschäftigen, es ist ja immerhin eine Philosophie. „Das Kapital“ ist kein dummes Werk, das kann man nun wirklich nicht sagen. Und ich habe mich da richtig reingekniet, das hat mir Spaß gemacht, weil es einen hohen Erkenntniswert hatte. Und als ich an die Akademie kam, hatte ich mich eben schon drei Jahre während meines blöden Werbestudiums mit Psychoanalyse, mit Freud, aber auch mit der Linken: mit Marcuse, mit Marx und Lenin und allem, was es da gab, ernsthaft beschäftigt. Und an der Akademie wurde das Ganze nun ziemlich Mickymaus-mäßig betrieben, alles sehr linksradikal geprägt, sehr maoistisch. Die sind da alle mit dem Mao-Hütchen rumgerannt …
War es eher eine Mode?
Es war ’ne ziemliche Mode. Hinzu kam, dass ich aus einem kleinbürgerlichen Haus kam. Und viele von denen waren ziemlich großbürgerliche Jüngelchen. Und das war dann mitunter paradox: einerseits mit dem Mercedes des Vaters vorfahren und sich gleichzeitig (lacht) für die chinesische Revolution und Gleichheitsideale einsetzen – das war reichlich plump, wie ich fand, ein Radikalismus der dumpfen Art.
Sie haben das gleich durchschaut?
Ja, aber ich befand mich auch schnell in einer misstrauisch beäugten Minderheit. Ich hab mich zwar auch als Linker begriffen, aber ich galt dann eben als Revisionist. Ich gehörte plötzlich zum sozialistischen Lager, ich war so ein böser Anhänger der Sowjetunion, was ich übrigens gar nicht war und worum es auch gar nicht ging. Aber ich habe eben die Systemauseinandersetzung und das, was mal geplant war mit dem Sozialismus bei seiner Entstehung, historisch begriffen und nicht so albern aufgefasst wie die Mehrzahl dieser Studenten.
Was war für die Studenten so attraktiv an der chinesischen Revolution?
Wenn man Mao liest, dann hat man es mit stark vereinfachten Losungen zu tun. Da braucht man sich nicht groß mit auseinandersetzen. Oder sagen wir so: Die Programmatik der chinesischen Revolution ist ein bisschen simpler als das, was Marx im Sinn hatte. Bei Marx ging es mehr um gesellschaftliche Prozesse, und bei Mao war es mehr eine idealistische Angelegenheit: Die Leute müssen einsehen, dass der Sozialismus der richtige Weg ist – als wäre es eine reine Bewusstseinssache. Dabei hatte der Marx den Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt und gesagt: „Das Sein bestimmt das Bewusstsein.“ Und nicht umgekehrt. Das heißt: Wenn die Verhältnisse so werden, kann man eventuell zum Revolutionär werden. Wenn es sich so ergibt. Aber nicht aus irgendeinem Idealismus heraus.
Wie sehr war dieser Idealismus die vorherrschende Haltung unter den Studenten der Akademie?
Es ging so weit, dass diese Studenten, die ja die politische Mehrheit an der Akademie bildeten, aus ’nem falschen Verständnis von Selbst- oder Mitverwaltung heraus nur noch Leute einstellen wollten, die ihrer Auffassung waren. Da hat es Berufungsverfahren gegeben, Anhörungen von Dozenten – die waren wie Tribunale. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das war unerträglich! Der akademische Rat hat die Dozenten mitberufen. Aber vorher mussten sich die Bewerber bei der Studentenversammlung vorstellen. Und die Studentenversammlung hat diesen Leuten die Pistole auf die Brust gesetzt. Da wurde gefragt: „Bist du für den Sozialismus, ja oder nein?“ Da hat’s Erscheinungsformen gegeben (lacht) – unfassbar, wenn man sich das heute noch mal vergegenwärtigt, was da abgelaufen ist! Wer da nicht für den Sozialismus war, der konnte kein Dozent werden. Und natürlich hat’s Opportunisten gegeben, die ham gesagt: „Natürlich bin ich für den Sozialismus! Rotfront!“ – und die sind dann Dozenten geworden – auch wenn sie unter Umständen völlig bescheuert oder beschränkt waren.
Wie konsequent wurde diese weltanschauliche Selektion durchgezogen?
Es gab schon Leute, die wirklich was wussten und die nicht auf dieser Linie lagen, die man verschont hat: wie Ulrich Gregor, Filmhistoriker und Jahre lang Leiter des Internationalen Forum des jungen deutschen Films – einer, der viel von Film versteht. Gut, der war nun mal da, den hat man irgendwie toleriert. Aber andere Leute, die wirklich was auf der Pfanne hatten, die hat man versucht zu isolieren oder rauszuekeln, oder man hat versucht, wenn sie sich neu beworben haben, dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst kommen.
Die Qualität ihrer Arbeiten war nicht weiter wichtig?
Nee. Die mussten sich politisch einbinden lassen. Teilweise ging es so weit, wie im Fall der Gruppierung KPD/ML, dass die Arbeit an der Akademie komplett instrumentalisiert werden sollte. Da wurden dann mit den Mitteln der Akademie, die für Studentenfilme zur Verfügung standen, Propaganda-Filme für diese K-Gruppe gemacht. Die hat bundesweit bestanden, war aber von der Größenordnung her ’ne Sekte. Es gab ja mehrere K-Gruppen, die sich auch an der Akademie gegenseitig bekämpft haben. Es gab die KPD/AO, die KPD/ML (lacht) und was weiß ich alles.
Und es gab die SEW, die Sozialistische Einheitspartei West-Berlins.
Ja, aber das waren ja die Bösen. Die waren ja noch schlimmer als die Kapitalisten.
Da haben Sie sich am ehesten wiedergefunden.
Ja, ich war da Mitglied. (…)
„Die Haltung: „Oh, schau mal, in China machen sie’s richtig!“, fand ich wenig hilfreich. Ich war der Meinung: Ich lebe hier und schau mir die hiesigen historischen Verhältnisse an.“
Warum? Weil Sie die weniger weltfremd fanden?
Nö. Aus meiner Sicht hatte das ’ne andere Grundlage. Es geht jetzt nicht darum, wozu die DDR am Ende geführt hat. Aber wenn man sieht, welche Leute sich etwa in den 20er und 30er Jahren zu der Gesellschaftsform Sozialismus bekannt haben, stellt man fest, dass das nicht gerade die blödesten waren. Es ging dabei aber um ein anderes Verständnis von Sozialismus: Da war der Sozialismus sozusagen gesellschaftlicher Gegenentwurf und nicht ein Instrument für ein paar verrückt gewordene Studenten, die irgendwelche Machtgelüste oder pubertäre Gefühle oder weiß der Teufel was ausleben wollten. Sondern da ging ’s um die Erkenntnis: So wie sich die Gesellschaft entwickelt, kann ’s ja eigentlich nicht weitergehen. Ich meine, vor ’33 stand ’s ja auch auf der Kippe: Wozu es geführt hätte, wenn die KPD tatsächlich mit so simplen Menschen wie Thälmann an die Macht gekommen wäre, will ich allerdings in Gottes Namen auch nicht wissen. Wäre wahrscheinlich was Ähnliches dabei rausgekommen wie in der DDR. (…) Entscheidend ist, dass es gerade in Deutschland eine gesellschaftliche Bewegung gegeben hat, die mich interessierte. Und hier ging es nicht um kleine Splittergruppen wie in den 70er Jahren, sondern um eine echte gesellschaftliche Grundlage. So habe ich den Sozialismus kennengelernt, ich habe mich aus einer historischen Sicht der Dinge damit beschäftigt. Auch die Haltung: „Oh, schau mal, in China machen sie ’s richtig!“, fand ich wenig hilfreich. Ich war der Meinung: Ich lebe hier und schau mir die hiesigen, auch historischen Verhältnisse an.
Gab es bestimmte Erlebnisse, die Ihre politische Haltung festigten?
Ich habe alte Kommunisten kennengelernt, die mich sehr beeindruckt haben. Und dann kam der Antifaschismus bei mir hinzu, der aus der Auflehnung gegenüber dem eigenen Elternhaus und aus einem Gerechtigkeitsgefühl heraus entstand. Und dann habe ich eben ’73 oder ’74 den ersten Film gemacht – „Die Straße im Widerstand“ – über alte Leute in Charlottenburg in der Krummestraße. Da gibt ’s ein schönes Buch von Jan Petersen, das heißt „Unsere Straße“. Darin wird die Geschichte dieser Straße erzählt, die eben sehr rot war vor ’33 und die dann von den Nazis als Fanal begriffen wurde. Ziel der Nazis war es, diese Straße kaputt zu machen und dort die Präsenz zu erobern. Leute wurden verschleppt und umgebracht. Und ich habe dann alte Menschen gefunden, die noch in der Straße wohnten, die diese schlimme Zeit überlebt hatten, die im KZ gesessen hatten oder im Zuchthaus. So kam ich auch in Kontakt mit der SEW, denn einige dieser alten Kommunisten waren in der SEW. Das waren Maurer, Gärtner, was weiß ich, proletarische oder kleinbürgerliche Leute mit ’ner sehr klaren Haltung gegen den Faschismus, die auch ihr Leben dafür riskiert hatten und die in West-Berlin lebten und vollkommen isoliert waren. Die kriegten keine Entschädigung als Verfolgte des Naziregimes, weil sie sich nicht losgesagt hatten von der KPD beziehungsweise SED. Die hatten auch keine Rentenansprüche für die Zeit, in der sie politisch inhaftiert waren. Im Gegensatz dazu hatten ehemalige SS-Leute durch ein Urteil erreicht, dass ihnen die Zeit in der SS für die Versorgung anerkannt wurde. Und diese armen Leute, die ich da kennengelernt habe, hatten als Ansprechpartner nur die VVN, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, das war mein erster Kontakt damals. Und als mir das alles klar wurde, habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte mir: Wo leben wir hier eigentlich? Wir sind aufgewachsen mit der Kollektivschuld, Vorreiter des Widerstands waren für uns die Geschwister Scholl und Graf Stauffenberg. Und plötzlich merkt man, dass uns in der Schule ein wesentlicher Teil der deutschen Geschichte vorenthalten wurde. Und da wird man natürlich sauer und ist ziemlich erbost über dieses System. Das war ein wichtiger politisch-emotionaler Zugang für mich. (…)
Die Aktivitäten der Studenten an der DFFB haben Sie dagegen wenig beeindruckt …
Diese Jüngelchen mit ihrem sozialistischen Disney-Look waren einfach albern (lacht). Das ganze Gehabe war ziemlich kindisch.
Gilt das auch für die Filme, die damals an der Akademie gemacht wurden?
Nö, das muss man trennen. Es gibt ein paar ganz interessante, bisschen romantisierende Sachen aus der Zeit. Ich denke zum Beispiel an „Liebe Mutter, mir geht es gut“ von Christian Ziewer (1971). Da zeigt sich eine Tendenz, die man als Gegenaufklärung verstehen muss. Zunächst einmal wusste man ja damals nichts über die Antifaschisten, über die Kommunisten, die unter uns lebten. Kommunisten waren ja Menschen, vor denen man sich gruselte, also ganz gefährliche Kerle – wie auf den Postern der 50er Jahre, auf denen der Kommunist das Messer quer im Mund hat. Das heißt, man wusste kaum etwas über Kommunismus und Antifaschismus. Wenn man sich nun aber damit auseinandersetzte, konnte man an den Punkt kommen, an dem man sagt: Wir sollten uns mehr mit den Menschen an der Basis beschäftigen: einerseits mit der Minderheit der Antifaschisten und Kommunisten, andrerseits eben mit den Arbeitern. Die Arbeiter waren ja Teil unserer Gesellschaft, wurden aber lange in der Kultur und Kunst ausgeblendet. Gut, es gab Max von der Grün und ein paar andere Schriftsteller, die sich damit beschäftigt haben, ansonsten war das alles sehr bürgerlich. Wer hat sich denn schon mit der Arbeitswelt beschäftigt? Erst durch die 68er rückte die Arbeitswelt mehr in den Blickpunkt. Und dann gab ’s eben auch Filmemacher an der Akademie wie Christian Ziewer und Max Willutzki, die Spielfilme gemacht haben, in deren Mittelpunkt das Arbeitsleben stand. Das waren ernsthafte Anliegen. Die waren keine Maoisten. Die kamen auch selber aus dieser Welt. Christian Ziewer war, glaub ich, vorher Schlosser.
Welche Rolle hat die Gewaltfrage damals an der Akademie gespielt? In dem mehrteiligen Dokumentarfilm „Was war links“ von Andreas Christoph Schmidt (2003) wird eine Verbindung zur RAF angedeutet. Holger Meins war ja auch Student an der DFFB. Wie radikal hat man sich mit dem Thema Gewalt auseinandergesetzt?
Zu diesem Thema wurden Filme gemacht, klar. Es war ja auch eine sehr gefährliche Sicht der Dinge: Nehmen wir den Sprengstoffanschlag im Kaufhaus 1968: Der war ja im Vergleich zu dem, was in Vietnam passierte, lächerlich. Aber das ist halt ein schmaler Grat, denn natürlich haben wir damals gesagt: „Was regt ihr euch denn so darüber auf? Das ist doch nur ein symbolischer Akt gewesen!“ Genauso wie beim Pudding-Attentat auf Humphrey von Teufel und Co. Als der amerikanische Vizepräsident nach Berlin kam, haben die ein Pudding-Attentat auf ihn vorbereitet – so etwas wie ein Happening. Und das wurde auch gleich in die terroristische Ecke gedrängt. Meine Sicht der Dinge war, dass die Frage der Auseinandersetzung mit der Gewalt gar nicht aus der Studentenbewegung heraus kam, sondern der Studentenbewegung quasi aufgezwängt worden ist durch die Art und Weise, wie die Gesellschaft eben mit dieser Bewegung umgegangen ist, die sich …, ja: für mehr Freiheit einsetzte und die einfach andere Auffassungen hatte. Man hatte ’s ja schon am 2. Juni gesehen (am 2. Juni 1967 war Benno Ohnesorg erschossen worden; JV) und auch danach: Demonstrierende Studenten wurden ja ziemlich übel niedergeknüppelt. Die Gesellschaft hatte auch gar keine Erfahrung mit so einer Situation. Dann wurden die Notstandsgesetze diskutiert und durchgesetzt, das war ein erheblicher Einschnitt in die bürgerlichen Rechte. Das war schon so ’ne Entwicklung, wo man sich mehr als Opfer empfunden hat und aus dieser Opferrolle heraus gesagt hat: „Gegengewalt!“ Das war der Entwurf. „Wir wenden keine Gewalt an, sondern wir wehren uns.“ Das war Gegengewalt.
Bot die Akademie Platz für Leute, die auch ernst machen wollten? Die nicht nur über Gewalt reden wollten?
Ich muss ehrlich sagen: Das hab ich zu meiner Zeit nicht so mitbekommen, dass der Meins da war… , also das war nicht so ’n Thema – jetzt nicht aus Verdrängung, sondern ich hab das nicht mitbekommen. Ich kann mich auch gar nicht persönlich an ihn erinnern. (…) Der war auch ’71 schon im Untergrund, als ich da hinkam. Der war zwar da gewesen, war aber komischerweise an der Akademie kein richtiges Thema… Ansonsten gab es den schönen Film von Harun Farocki „Worte des Vorsitzenden“, dann gab ’s ’nen Lehrfilm, wie man Molotov-Cocktails herstellt und so was. Und das mit den Molotow-Cocktails war, glaub ich, schon ein bisschen ernster gemeint. Wobei die Leute sich wahrscheinlich über die Konsequenzen auch nicht klar waren oder besonders weit gedacht haben. Das war mehr Provokation. Das Ganze an der Akademie hatte immer so ’n gewisses Element der Provokation.
Also Haschrebellen und Spaßguerilla?
Ja, genau. Ich glaube übrigens auch, dass diese Befreiung von dem Baader in diesem Institut, als der seinen Freigang hatte, und als man gesagt hat: „Den befrei’n wir jetzt, den hol’n wir da raus!“, dass das mehr ’n Unfall war – also jetzt nicht, um die zu verteidigen. Aber dass das Ganze ziemlich naiv und dumm und nicht durchdacht war. Sondern das war mehr so ’ne rebellische Aktion: „Jetzt zeigen wir ’s dem mal, dem Staat!“ Dass dabei jemand erschossen wurde, das war sozusagen der Anfang vom Ende. Damit war die Grenze überschritten, da gab es auf einmal ein Opfer. Das hat dann zu solchen Legitimationen geführt wie „Was ist denn schon ein so ’n Toter gegen soundsoviel tausende durch Napalm-Bomben verbrannte Kinder in Vietnam?“ Da wurde es dann sehr gefährlich und eigentlich unerträglich. Die fälligen Auseinandersetzungen haben aber nicht mehr so richtig stattgefunden, glaub ich … Mein Thema war ohnehin mehr der Antifaschismus. Weil ich darauf aufmerksam machen wollte, das war meine Programmatik, dass das sozusagen ’ne Linie in der deutschen Gesellschaft ist.
Der Maurer und der General: „Unversöhnliche Erinnerungen“
Das war auch die Verbindung zwischen Ihnen, Karl Siebig und Johann Feindt. Haben Sie sich an der Akademie schnell gefunden?
Ja. Wir haben ja dann auch einen wichtigen Film gemacht – ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der lief zufälligerweise vorgestern Abend im Fernsehen: „Unversöhnliche Erinnerungen“. (…) Die Idee war ganz simpel, ähnlich wie bei „Straße im Widerstand“: Wenn man sieht, dass es solche Antifaschisten gibt, und wie die leben, wie sehr die für ihr Recht kämpfen müssen, und dass die nicht anerkannt sind und keine Versorgungsansprüche haben und so weiter und dann auf der andern Seite sieht, welche Leute zum Teil in der Bundeswehr an obersten Positionen stehen, alte Nazis nämlich, dann kommt natürlich schon die Frage auf: Wie kann das eigentlich sein? Was ist da eigentlich in diesem Land passiert? Dass jemand, der sich gegen den Faschismus gewehrt hat, Schwierigkeiten hat, zu seinem Recht zu kommen und jemand, der fröhlich mitgemacht hat, in der neuen Demokratie Bundeswehrgeneral wird. Daraus ist die Idee entstanden, einen Film zu machen, der zwei solche deutschen Lebenswege zeigt.
Wie sind Sie vorgegangen?
Ich habe in Remscheid einen Maurer gefunden. Ich musste ja jemanden finden, der klug ist, der weise ist, der ’ne Sicht der Dinge hat. Der auch reden kann, ohne dogmatisch zu sein. Es gab ja viele, die dann in abstrakte Phrasen und Parteichinesisch verfallen sind – nee, ich wollte jemanden, der wirklich lebendig erzählt, der das erlebt hat. Und dann wollte ich jemanden von der anderen Seite finden. Das war ’ne Art Walraff-Arbeit, die ich da geleistet habe, bis ich in diese Kreise reingekommen bin, bis ich so ’nen Ex-Bundeswehrgeneral gefunden habe, der sich bereit erklärte, mitzumachen.
Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen?
Nö. Ich hab mich natürlich nicht als Antifaschist dargestellt, als fanatischer schon gar nicht. Meine Herangehensweise war mehr Neugier. Also zu sagen: Mich interessieren diese Lebenswege. Ich hab dem auch erzählt, dass wir jemand andern, der im Spanischen Bürgerkrieg auf der anderen Seite der Barrikaden gekämpft hat, auch ’n Deutscher, dass wir auch zu dem gehen. Der General war ein ganz eigenartiger Mann, der hat gesagt: „Es kann doch gar nicht sein, dass sich junge Leute für mich interessieren, so interessant bin ich doch gar nicht.“ Da hab ich gesagt: „Ganz so würde ich das nicht sehen, aber in gewisser Weise hamse Recht; es geht uns nicht nur allein um Sie, sondern auch um den Spanischen Bürgerkrieg, wo ja Deutsche auf beiden Seiten gekämpft haben. Und zwar, obwohl sie jeweils nichts damit zu tun hatten. Aber die Antifaschisten taten es, weil sie sich gesagt haben, sie könnten den Faschismus bekämpfen, und die Nazis aus ’nem ganz anderen Grund.“ Das hab ich damals zu ihm gesagt. „Und ansonsten interessiert mich, wie solche Lebenswege verlaufen, warum Sie auf der Seite der Barrikade gelandet sind und warum der andere da gelandet ist – darüber mach ich ’nen Film.“ Nach dem anderen Mann hat er zunächst gar nicht gefragt.
Haben die beiden sich mal kennengelernt, der Maurer und der General?
Nee. Wobei der General irgendwann mal gesagt hat: „Ach, ich würde ihn vielleicht doch gern mal kennenlernen, muss ja doch ’n interessanter Mann sein.“ Da hab ich zu dem Ludwig gesagt, Ludwig hieß der Maurer: „Der General hat gesagt, er würde dich vielleicht auch mal gerne besuchen.“ Da hat der Ludwig gesagt (lacht): „Was soll ich mit dem Mann reden?“
„Die Zeitungen haben auf den General eingeprügelt“
Wie war die Resonanz der beiden auf den Film? Wie hat der General reagiert?
Der General war empört. Also, es war so: Ich hab ihm nicht gesagt, dass er den Film zu sehen kriegt. Es gab ’ne Vereinbarung mit beiden, dass sie jeweils ihr Material zu sehen kriegen. Der General wusste schon, dass die Aussagen gegeneinander gestellt werden. Ich hab dann gesagt: „Es geht mir nicht darum, dass Sie mir jetzt künstlerisch (reinreden; JV). Aber falls Sie sagen: ’Das habe ich zwar vor der Kamera so gesagt, aber wenn ich das jetzt hier noch mal so sehe ’n halbes Jahr später, dann ist mir das doch zu pointiert oder zu übertrieben’ oder was auch immer, dann können wir darüber reden. Sind ja Ihre Aussagen. Ich will Ihnen ja nich irgendwat da in den Mund legen.“ Das heißt, er hat das dann hier abgenommen, ist hierher gekommen, hat sich das alles angeschaut. Und wir haben ihm dann sogar, weil ich gesagt hab: „Was sollen wir da lange rumeiern?“, den ganzen Film gezeigt. Und dann hat er den ganzen Film gesehen und dann kam: „Ach, den Mann müsste ich eigentlich wirklich mal treffen.“ Dann hat er mir zu dem Film gratuliert. Er hat mich sogar noch an dem Abend, als der Film ausgestrahlt worden ist im ZDF, spät abends angerufen und gesagt: „Das ist ja ein wunderbarer Film geworden. Also, auch meine Leute hier, wir haben uns den natürlich gemeinsam angeguckt, sind ganz begeistert.“ Und am nächsten Tag kamen dann die Kritiken. Und da wurde er als Fossil dargestellt. Also vor allen Dingen die Welt am Sonntag, die FAZ, also die für ihn maßgebliche Presse, die haben ihn aussortiert. Die haben gesagt, dieser Mann ist in keiner Weise repräsentativ für irgendwas. Sondern das ist ein Monster, ein Fossil. Also Monster nicht im Sinne von böse, sondern als irgendetwas Abartiges. Wenn man sich diese Kritiken anguckt … das ist wirklich unglaublich. Die haben so auf diesen General eingeprügelt …
Der Film selbst wurde in den Kritiken aber sehr gelobt.
Ja, der Film wurde hoch gelobt, der hat auch mehrere Preise gekriegt und was weiß ich. Aber das Schreckliche für den General war, dass er plötzlich von den eigenen Leuten Prügel kriegte. Aber eher nach dem Motto: Wie kann jemand so blöde sein und das sagen, was er denkt, vor der Kamera! (…) Es hatte ziemlich weite Auswirkungen am Ende, weil wir uns natürlich auch mit der Gegenwart beschäftigt haben, mit dem, was gerade in der Bundeswehr los war. Es gab damals ’nen Vorfall, das war wirklich ein Glücksfall für uns Filmemacher, dass bei ’ner Einführung von Offiziersanwärtern eine Feier veranstaltet wurde. Und da haben junge Offiziere – weiß der Teufel, wer auf die Idee kam und wie so was entsteht – ’n Feuer gemacht im Aschenbecher und symbolisch Juden ins Feuer geworfen. Also ’nen Zettel genommen, „Jude“ drauf geschrieben und ins Feuer geworfen. So, und unser netter General hatte auch dazu was zu sagen … Er war übrigens kein dummer Mann, auch kein unsympathischer Mann, wie gesagt alles andere als ein Monster, ’n netter bürgerlicher alter Herr, sehr nationalkonservativ, für den der Krieg ’n Abenteuer war, und der sich noch erinnern konnte, dass er sich als erstes nach dem Spanischen Bürgerkrieg von seinem Sold ’n Paar schöne Schuhe gekauft hat und ’n Mercedes Coupé und es war alles wunderbar. So war das Leben für ihn. Und als ich ihn gefragt habe, ob er nicht Angst gehabt hätte, als der Krieg damals ausbrach, sagte er: „Angst? Im Gegenteil! Es ging ja alles so schnell, wir hatten nur Angst, dass wir unsere Orden nicht zusammenkriegen.“ So einer war das, für ihn war Krieg ’n Abenteuer – für Ludwig, also für den Maurer, war Krieg die Hölle. Und der General sagt dann im Zusammenhang mit diesem Vorkommnis bei der Bundeswehr am Ende (des Films, JV) auf meine Frage, was sich denn bei der Bundeswehr im Vergleich zu früher geändert habe, sinngemäß: Man kann nichts Schlechtes über die Bundeswehr sagen, eigentlich ist das alles in Ordnung, das sind ordentliche Leute da. Aber eines muss er sagen, das hätte es früher bei ihm nicht gegeben, da gab ’s doch diesen Vorfall mit diesem Feuer – und dass da jemand hingeht und das meldet, das hätte es bei ihm früher nicht gegeben. Das heißt, er hat sich nicht darüber aufgeregt, was die da gemacht haben, sondern darüber, dass es rausgekommen ist. Und das hat natürlich Wellen geschlagen.
Und das wollte er nicht rausgeschnitten haben?
Nee, nee. Er war wirklich der Überzeugung, dass das so gut ist.
Muss man so jemanden vor seiner eigenen Naivität schützen? Hatten Sie nicht das Gefühl, ihn vorzuführen?
Nö, eigentlich nicht. (Pause) Also, erstens hat er Gelegenheit gehabt, das zu sehen. Zweitens glaube ich, dass er auch nach der Presseschelte immer noch der Meinung war, dass das so ist. Und ich denke: Wenn jemand ’ne Auffassung hat, die kritisierenswert ist, muss er es auch ertragen, wenn er deswegen kritisiert wird.
Als dann die Kritiken kamen, war er empört?
Dann war er empört. Dann hat er sich an die Springer-Presse gewandt. Und er hat sich an den Intendanten des ZDF gewandt, der war auch ehemaliger Jagdflieger, er hat sich also an seinen Kameraden gewandt. Ich komm jetzt nicht auf den Namen, also nicht Stolte, Stolte war Programmdirektor zu der Zeit … Aber das ging natürlich alles nicht so einfach. Der Film hatte mittlerweile ’ne ziemlich große Aura, hatte enorme Kritiken gekriegt. Er hatte sogar zur Folge, dass beim ZDF ’ne neue Telefonleitung gelegt werden musste, weil das Zuschauertelefon überlastet war. Die Leute haben da dermaßen angerufen! Und ich hab einen ganzen Ordner nur mit Briefen, die Leute geschrieben haben, die nicht fassen konnten, dass so was möglich sein kann. (…) Manche Leute haben auch Geld geschickt für den Ludwig. Nur ’ne kleine Geschichte: Ludwig, der Maurer, musste als KPD-Mitglied aus Deutschland fliehen und ist dann in Spanien gelandet. Und seine Frau lebte mit ihrem Sohn in Remscheid. Da kam dann die Gestapo und hat sie ins Gefängnis geschmissen und hat von ihr verlangt, dass sie sich von ihrem Mann scheiden lässt. Weil er ist ja ein Landesverräter und so. Und nur dann, wenn sie das tut, wenn sie sich von ihm scheiden lässt, darf sie ihren Sohn behalten. Ansonsten wird sie entsprechende Konsequenzen zu tragen haben. Und da hat sie sich scheiden lassen, weil sie natürlich Angst um ihr Kind hatte … Der Ludwig ist dann nach ’45 wieder zurückgekommen, und die Scheidung (lacht) ist aufrechterhalten worden. Das heißt, die mussten wieder heiraten.
(Ende der ersten Kassettenseite)
(…) Bei der Goldenen Hochzeit, wenn die 50 Jahre verheiratet sind, kriegen die von der Stadt ein Präsent, ich glaub: 1000 D-Mark oder 500 D-Mark, jedenfalls ein Geldgeschenk und so ’n Präsentkorb. Und der Bürgermeister kommt ihnen gratulieren, weil 50 Jahre verheiratet zu sein ist ja schon ’ne Menge. Und die haben natürlich auch erwartet, dass an ihrem goldenen Hochzeitstag jemand kommt, weil sie die Zeit der Scheidung natürlich nicht mitgerechnet haben. Und dann haben sie das nicht gekriegt. Dann haben sie nachgefragt und dann hieß es: „Ja wieso? Sie sind doch gar keine 50 Jahre verheiratet!“ Und das erzählt er in dem Film und ist traurig darüber. Und die Frau weint auch ein bisschen, also sie weint nicht, aber sie ist schon sehr gerührt, also sie ist sehr empört, nicht gerührt, immer noch zornig über diese Ungerechtigkeit. Und das hat solche Wellen geschlagen, dass Leute Geld geschickt haben. Denn die beiden erzählen auch, dass sie eben keine Rente kriegen für die Zeit, in der er gezwungenermaßen im Ausland war oder im Gefängnis gesessen hat. Denn die Alliierten haben ihn später auch noch festgehalten, er kam erst ’46 zurück … Für mich war es schön zu sehen, wie so ganz normale Leute darauf reagiert haben und gesagt haben: „Das kann doch nicht sein!“ – auch aus so ‚m Gerechtigkeitsempfinden heraus. Die haben mir in ’nem Umschlag 20 D-Mark geschickt und geschrieben, ich soll das weiterleiten.
Eine erstaunliche Wirkung für einen Film zu einem solchen Thema …
Ja. Ich denke auch, dass die beim ZDF damals begriffen haben, dass der General da wenig Handhabe hatte. Der dachte halt, dass er da was verhindern kann, aber das ging eben nicht. Aber die haben den Film eben über 20 Jahre nicht mehr ausgestrahlt, und komischerweise jetzt zweimal hintereinander: im letzten Jahr und jetzt in diesem Jahr schon wieder, weil das auch wieder enorme Reaktionen gebracht hat.
„Das konnte man von der Wirkung her nicht mehr übertreffen.“
Wie haben der Maurer und seine Frau reagiert?
Die waren glücklich. Der Bürgermeister ist gekommen und hat sich entschuldigt. Das hat richtig Kreise gezogen. Der Film ist auch im Bundestag zu ’ner kleinen Anfrage geworden, weil man erreichen wollte, dass dem General sein Generaltitel aberkannt wird. Man hat auch ’ne Gesetzesänderung erreicht, was die Verfolgten des Naziregimes angeht, dass deren Renten neu berechnet werden müssen. Dann gab ’s einen SPD-Abgeordneten, der mich kontaktiert hat. Und der hat dann dem Bürgermeister von Remscheid, der auch SPD war, richtig einen auf ’n Deckel gegeben und dafür gesorgt, dass der Bürgermeister ’n paar Tage später (lacht) beim Ludwig vorstellig wurde, sich entschuldigt hat und ihm den Korb überreicht hat und so weiter. Also, dem Ludwig hat das richtig gutgetan. Der stand zum ersten Mal in seinem Leben für das, was er alles ertragen und durchgemacht hat, so ’n bisschen im Mittelpunkt. Der ist leider dann zwei Jahre später gestorben, der war schon recht alt.
Was stand in den Briefen, die Sie nach der Ausstrahlung des Films erhalten haben?
Das waren über 100 Briefe, die wir gekriegt haben, was ja schon ’ne enorme Aktivität zeigt. Weil wer schreibt schon so schnell ’nen Brief? Da muss ja schon einiges passieren … Und da waren halt ’n paar Spinner dabei, die rumgeschimpft haben, dass Kommunisten nicht ins Fernsehen gehören und so. Aber die Mehrheit schrieb aus so ’nem demokratischen Bewusstsein heraus: Es könne doch nicht sein, dass in unserer Gesellschaft so was geht … Insofern war das unsere Verbindung – das war das Thema, das Karl Siebig, Johann Feindt und mich interessierte. Das war dann aber auch damit abgearbeitet. Das konnte man auch von der Wirkung her nicht mehr so richtig übertreffen.
„Ich bin dann in den schönen Laden in der Karl-Marx-Allee und hab mir Busch-Platten gekauft.“
Wieviele Filme haben Sie zu dritt gemacht?
Einen haben wir noch gemacht über Borgwart. Der Karl hat mit dem Johann noch einen gemacht über Henry Ford. Zusammen haben wir … eins, zwei, drei … vier Filme gemacht. Und Karl Siebig und Frido Feindt haben darüber hinaus zusammengearbeitet, und ich habe wieder mit Frido zusammen zwei Filme gemacht, wovon ich einen geschnitten und einen produziert habe.
Bei dem Film über Ernst Busch „Vergesst es nie, wie es begann“ war auch noch Heide Breitel dabei …
Ja, als Cutterin. Sie war Dozentin an der Akademie und hat bei diesem Film den Schnitt gemacht. Es war so, dass damals das Geld von der DFFB nicht ausgereicht hat – und deswegen hatte der Karl Siebig das ZDF kontaktiert. Da gab ’s diesen Walter Schmieding, der war Kulturredakteur und hatte auch ’ne eigene Sendung, ziemlich markante Figur im Fernsehen der 70er Jahre. (…) Wir haben also den Film mit dem ZDF gemacht, und weil das ja professionell geschnitten werden musste, hat dann die Heide Breitel als Dozentin den Schnitt gemacht.
War Ihnen Ernst Busch bereits vor diesem Filmprojekt ein Begriff? Oder haben Sie ihn erst durch Karl Siebig kennengelernt?
Nee, nee, ich kannte ihn schon. Das war ja schon ’78. Und wenn man überlegt, wie lang ich da schon politisch aktiv war …
Wissen Sie noch, wie sie ihn oder seine Musik kennengelernt haben?
Na ja, wenn man auf solche politischen Veranstaltungen ging, hörte man natürlich „Vorwärts und nicht vergessen“ oder was weiß ich. Also, die ganzen Lieder, die kannte man. Oder bei der Erste-Mai-Demo wurden die doch gespielt, die Lieder. Wir ham ja nicht nur gegen den Vietnamkrieg demonstriert, das ging ja dann ineinander über … gut, in der Friedensbewegung war das vielleicht nicht mehr so … Aber die proletarische Kultur wurde ja damals wieder entdeckt.
Können Sie das zeitlich zuordnen, wann Sie diese Kultur für sich entdeckt haben?
’71, ’72, ’73, so.
Hatten Sie die Busch-Platten aus dem Pläne-Verlag?
Ja. Und ich hatte ja noch einen Vorteil: Ich konnte ja dann die Platten aus der DDR kaufen. Ich bin dann in den schönen Laden in der Karl-Marx-Allee und hab mir Busch-Platten gekauft. Ich hab die auch noch.
Welche Lieder mochten Sie besonders? Hatten Sie ein Lieblingslied?
Ich komm jetzt nicht auf den Titel … also weniger diese Lieder, die man so … ich muss auf die Platte gucken … weil da singt er einfach auch hervorragend …
Hatten es Ihnen eher die Spanien-Lieder angetan oder eher diese klassischen Arbeiterlieder oder eher die Brecht-Sachen?
Nee, das ist mehr so … es gibt ein Lied … Gott, wie heiß das? Da muss ich die Platte holen …
Eher ’n Liebeslied?
Nee, nee, kein Liebeslied. Das ist von Eisler … aber es ist eben nicht so ’n … wie soll ich sagen, so ’n Marschlied. Also nicht so: Komm, Unterhaken, Zack-zack-zack, Vorwärts und nicht vergessen – sondern ’n bisschen differenzierter, aber gleichzeitig sehr … Ich muss die Platte holen, das will ich jetzt wissen.
Können wir ja gleich machen. Sie haben „Vorwärts und nicht vergessen“ erwähnt. Das wurde regelmäßig gespielt auf politischen Veranstaltungen, sagen Sie …
Ja, natürlich.
Gilt das auch für die Veranstaltungen der K-Gruppen?
Der K-Gruppen? Nö, weiß ich gar nicht. Da war ich ja nicht. (…) Mich interessierte die Linke, die in Verbindung mit den Gewerkschaften stand und aus der Arbeiterbewegung heraus kam. Das andere war ’ne intellektuelle Bewegung, die sozusagen von der Ideologie her kam und nicht aus ’ner gesellschaftlichen Bewegung heraus. Meinen ersten Film habe ich zum Beispiel gemacht über ’ne Fabrikbesetzung. Also, mich hat das immer schon interessiert, dieser Unterschied in der Gesellschaft. Ich meine, auch wenn man bürgerlich oder kleinbürgerlich aufwächst, kriegt man mit: ’n paar Straßen weiter leben die Menschen anders als wir. Und auch damals in den 50er Jahren wurde mir nahegelegt: Mit denen und denen spielst du besser nicht, weil das sozusagen nicht unser Niveau ist. Die haben mich aber am meisten gereizt – und nicht die auf meinem Niveau. Eher die, bei denen es auch ’n bisschen rauher zuging und wo die Leute auch anders miteinander umgingen. Wo man auch mal (lacht) zum Essen bleiben durfte – sonst wurde man ja wieder nach Hause geschickt: „So, jetzt muss gegessen werden, kannst dann gleich wiederkommen!“ – So ging ’s ja bei den Kleinbürgerlichen zu, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn heute Freunde kommen, wird einfach mitgegessen. Aber damals hieß es wirklich: „So, jetzt wird gegessen, jetzt musst du leider nach Hause gehen.“ Und insofern hatte ich da schon ’ne ganz andere Affinität auch zu dieser Welt. Und durch die Nähe zur Arbeiterbewegung kam natürlich auch irgendwann, als das Politische hinzukam, Ernst Busch dazu – seine Lieder, die bei vielen Anlässen gespielt wurden. Die Gewerkschaften haben ja den Busch auch nicht versteckt; ich meine, sie haben ihn nicht gerade vor sich hergetragen. Aber bei der IG Metall oder so wurde ja auch die Arbeiterkultur gepflegt. Es war nicht alles so politisch verbrämt und instrumentalisiert, wobei die SED natürlich versucht hat, das zu instrumentalisieren.
Vorhin haben Sie Jefferson Airplane und die Doors genannt. Gab es da so einen eigenartigen Crossover in der Zeit, wo man als Linker all das unter einen Hut gebracht hat: die Doors, Ernst Busch und die Stones und Ton Steine Scherben?
Ja, klar war ’s ’n Crossover. Wobei mir Ton Steine Scherben eigentlich zu simpel waren. Ich hab ja später mit Rio Reiser zusammengearbeitet. Aber die Texte der ersten beiden Platten waren ja ziemlich vereinfachend. Aber diesen Kontext gab ’s schon. Ich meine, auf der ersten Doors-Platte ist ja auch ein Lied von Brecht drauf! Das war eben eine andere kulturelle Bewegung – die haben sich ja auch damit beschäftigt, dass es schon mal was gab. Auch in den USA mit ihrer Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung …
Waren die Doors links? Oder: War man links, wenn man Doors gehört hat?
Also, nicht alle, die Doors gehört haben, waren links und umgekehrt.
Es gehörte zum Lebensgefühl dazu, diese Musik zu hören …
Ich denke, schon. Aber zum Beispiel bei den Stones war das eigentlich egal. Da ging ’s mehr um das Rebellische.
Sehr rebellisch wirkte Ernst Busch wahrscheinlich nicht mehr, als Sie ihn 1978 persönlich kennenlernten …
Doch. Dieses „Ich bin kein Herr!“, das war ja kein flotter Spruch von ihm. Das kam so richtig aus ihm heraus. Das war ein durch und durch bodenständiger Mensch. (…). Und wenn man dem Ernst Busch dann zum ersten Mal gegenübertrat, war das schon beeindruckend. Weil man einfach merkte: Da ist jemand, ’ne Persönlichkeit mit ’nem Charisma und mit einer Ausstrahlung und einem Selbstbewusstsein … Bürgerliche Leute haben ja doch oft ’ne andere Art, sich zu präsentieren. Sie achten darauf, wie sie wahrgenommen werden und ob die Krawatte jetzt richtig sitzt. Und der Mann hatte so ’ne Ausstrahlung, der brauchte da gar nicht drauf achten. Der hatte sozusagen (lacht) ein geerdetes Selbstbewusstsein, ohne arrogant oder irgendwie unangenehm zu sein. Er war einfach da, war ’ne imposante Erscheinung. Da merkte man einfach, dass so was gewachsen ist. Unkorrumpierbar, selbstständig, nicht angepasst an irgendwas oder beeinflusst – sondern bei dem ist ’ne Persönlichkeit gewachsen, der hat seine Sicht der Dinge.
Was war Ihr Aufgabenbereich bei diesem Film?
Mein Schwerpunkt war Ton. Manchmal habe ich auch Gespräche geführt.
Wie haben Sie Sich vorbereitet auf die Arbeit? Hatten Sie Material von Karl Siebig?
Ja, Karl Siebig wusste am meisten. Wir haben die Themen besprochen. Und natürlich hatte ich Karls ersten Film über Busch gesehen Aber ich hab mir auch Bücher besorgt über Eisler und Brecht. Ging ja gar nicht so sehr nur um Ernst Busch, sondern einfach auch um diese Zeit, in der er gelebt hat. Deswegen kommen ja auch seine Zeitgenossen vor, die haben wir ja noch getroffen: Walter Mehring zum Beispiel. Insofern habe ich mich schon damit beschäftigt, vor allem mit der Literatur. Das war ja das Positive an der DDR, dass man an diese Bücher relativ schnell rankam. Da gab ’s ’nen wunderbaren Laden am Ernst-Reuter-Platz, „Das Politische Buch“, da konnte man alles kriegen, was man brauchte.
Sie sagen, es ging gar nicht so sehr um Ernst Busch selber, sondern es ging …
Na ja, der Titel ist ja schon so programmatisch: „Vergesst es nie, wie es begann“. Das hatte ja schon so was …
… ’n bisschen was Didaktisches.
Ja, ’n bisschen was. Der Film ist auch, glaube ich, nicht besonders gut. (…) Aber ich bin mal gespannt. Mal sehen, ob ich es schaffe, zu Ihrer Vorführung zu kommen. Interessieren würde es mich schon. Wobei ich nicht glaube, dass der Film uns so gelungen ist.
Er ist relativ spröde, das ist richtig.
Ja, auch von der Linie her. Vielleicht, weil der Busch für uns doch zu sehr auf ‚m Sockel war. Und ich glaube nicht, dass das der Dramaturgie gut getan hat. Es war ja auch ein Studentenfilm; ich glaube, es war Karl Siebigs zweiter Film.
Aber das ZDF hat immerhin koproduziert.
Ja, ja, das ZDF hat koproduziert. Die haben uns aber unheimlich freie Hand gelassen. Also, das war sehr angenehm. Das ZDF hat ja dann auch ziemlich böse Kritiken einstecken müssen: Warum man so ’n Film ohne Kommentar zeigt und so.
Schwierig ist sicher, dass die Zeitzeugen, die im Film zu Wort kommen, nicht vorgestellt werden …
Genau, das war didaktisch nicht gut. Man wusste nicht, um wen ’s geht; man wusste gar nicht, wo der herkommt, wer das ist. Man fragte sich, warum jetzt nur dieser Teil des Lebens von Ernst Busch gezeigt wird und nicht das ganze Leben von Ernst Busch. Den ersten Film, den Karl Siebig über Busch gemacht hatte, kannte keiner beim ZDF, der wurde auch nicht vorher ausgestrahlt. Das war eben nicht journalistisch – aber filmisch war es auch nicht gut genug.
Die Resonanz war also nicht so positiv?
Nee, die Resonanz war nicht gut. (…)
Können Sie noch mal beschreiben, was Sie gemeint haben, als Sie gesagt haben, es ging gar nicht so sehr um Busch? Was war dann die Motivation, den Film zu machen?
Na ja, das war ’ne Ikone. Das war ’ne Ikone, und gleichzeitig war die Zeit, in der er gelebt hat, kulturell wahrscheinlich eine der spannendsten Phasen in der neueren deutschen Geschichte.
Es ging also nicht darum, diese Ikone in Frage zu stellen, die Ikone haben Sie mit übernommen …
Ja.
Fanden Sie, dass er zu Recht eine Ikone war?
Na ja, ich denke schon. Wenn jemand so aufrecht wie er durchs Leben geht und auch bereit ist, für seine Auffassungen die Konsequenzen zu tragen – das ist schon etwas, was man erst mal, ja, wie soll ich sagen, bewundert und verehrt. Das ist schon beachtlich, wie er sich verhalten hat in der Zeit des Faschismus. Und wie er auch später in der DDR sich nicht unbedingt für alles hat einvernehmen lassen – ohne seine Loyalität zur Idee des Sozialismus, oder wie immer man das nennen will, zu verraten oder zu verkaufen. Und er ist auch nicht einer von denen geworden, die diesen blöden Spruch eines Literaten oder Politikers glauben, den ich auch nicht glaube: „Wer mit 20 nicht links ist, hat kein Herz, und wer es mit 50 immer noch ist, der hat kein‘ Verstand“ oder so. So sehe ich das Ganze nicht. Was mich mehr beschäftigt hat, ist sozusagen, warum man bestimmte Zusammenhänge, obwohl man glaubt, sein Instrumentarium zu haben, trotzdem nicht durchschaut. Mittlerweile habe ich verstanden, wie bestimmte Systeme funktionieren können. Weil falsche Loyalität auch zu solchem Mitläufertum führt – und man konnte auch in der DDR mitlaufen.
Buschs Loyalität gegenüber der DDR haben Sie aber nicht hinterfragen wollen?
Na ja, die war ja nicht so eindeutig … Er war ja nicht so fest integriert in dieses System. Ich denke schon, er hat sich so ’nen Freiraum erschaffen. Er hat sich ja nicht vor jeden Karren spannen lassen.
Aber er hat Lieder gesungen, die heute für den Beton-Sozialismus schlechthin stehen: Hymnen auf Stalin und die Partei …
Aber das sind ja Lieder aus der Arbeiterbewegung.
Na ja, das sind Lieder aus der frühen DDR, die für konkrete Anlässe geschaffen wurden …
Gut, die Stalinismus-Frage haben wir nicht angesprochen. (…) Kann auch sein, dass man das eher ’n bisschen verdrängt hat. Das war ja auch ’n unangenehmes Thema (lacht), das muss man ja auch mal sagen. Da bin ich ja auch drauf gestoßen, als ich mich mit dem Spanischen Bürgerkrieg beschäftigt habe, da war ’s ja auch so: Die Kommunisten untereinander haben sich ja auch nicht gerade sehr ordentlich behandelt, also die unterschiedlichen Strömungen … Das meinte ich ja vorhin auch: Wenn man von einer bestimmten Sache überzeugt ist, auch wenn es nicht nur um Ideologie geht, sondern wenn man glaubt, dass das Ganze auch ’ne systematische und theoretische, quasi wissenschaftliche Grundlage hat, dann kann man trotzdem verblendet sein oder jedenfalls bereit sein, bestimmte Teile der Wahrheit einfach auszublenden und nicht wahrzunehmen. Oder Rechtfertigungen zu finden. Wenn man sich in so ’ner Auseinandersetzung befindet mit ’nem System, das man nicht für richtig hält, also dem kapitalistischen System, und gleichzeitig existiert ’n Gegenentwurf, dann ist man bereit, bestimmte Dinge eher zu verteidigen und als Kinderkrankheiten abzutun. Und das ist ja auch so. Ich denke, man kann schon sagen: Wenn der Kapitalismus sich anders verhalten und Deutschland ’ne andere Rolle bekommen hätte, wer weiß, ob ’s zu so ’ner Art der Spaltung gekommen wäre. Man weiß es nicht. Aber die Pläne waren nun mal da: vom Bollwerk auf der einen Seite mit West-Berlin als Speerspitze. Diese Pläne haben mit Sicherheit dazu beigetragen, zwei so unversöhnliche Systeme zu etablieren, die sich in vielem doch sehr ähneln. Man kann sich die Entwicklung in den USA angucken, als dem Hochland des Kapitalismus, da gibt ’s ja auch Erscheinungsformen, wo man etwa versucht, Medien zu regulieren in großen Konzernen, die einiges gemeinsam haben mit dem, was in der DDR oder der Sowjetunion passiert ist. Es geht um Macht und Kontrolle – in Amerika unter dem Begriff der Freiheit und der Menschenrechte, in der DDR unter dem Begriff des Sozialismus. In der DDR ging es um nichts anderes. Die Klasse, die da an der Macht war, die wollte halt auch nur noch ihre Besitzstände wahren. Das muss man einfach auch sagen, wenn man so ’n Altlinker ist, dass man da nicht bereit war, sich damit konsequent genug auseinanderzusetzen – obwohl man, wenn man in Leipzig war, es auch bestimmt hätte wahrnehmen können.
Vorhin haben Sie gesagt, dass der Film über Busch nicht besonders gelungen sei. Hängt das vielleicht mit einer Herangehensweise zusammen, die den Busch eher als Zeitzeugen sehen möchte?
Ja. Wobei über Politik gar nicht so viel geredet wurde. Es ging mehr um die Kultur.
In einem der Gesprächsprotokolle von diesem Film habe ich eine Stelle gefunden, wo Sie und Ihre Kollegen über eine Interview-Passage diskutieren. Einer von Ihnen freut sich über die Geschichte, die Busch gerade erzählt hat. Dann kommt aber gleich einer mit dem Einwand, man müsse jetzt aber zur Revolution 1918 kommen, darum würde es doch vorrangig gehen. Sie wollten offenbar schon aufs Politische hinaus …
Klar. Diese Tendenz war da. Und wenn man in so ’nem Eifer ist und jung ist … – wie alt waren wir da? Wir waren 33, das ist ja noch relativ jung …
Schön, dass Sie das sagen, ich bin 33 (lacht).
Ja? (lacht) Na, das ist doch jung. Wobei ich glaube, dass es ein großer Unterschied ist, ob man vor 30 Jahren 33 war oder ob man heute 33 ist.
Inwiefern?
Ich glaube, dass man heute mit 33 weiter ist und viel mehr weiß als man damals in dem Alter wusste. Aber vielleicht täusche ich mich auch …
Ich glaube, dass Sie damals relativ klare politische Vorstellungen hatten, die Sie auch in dem Busch-Film vermitteln wollten.
Ich muss ehrlich sagen: Mir sind die politischen Implikationen bei anderen Filmen, die ich gemacht habe, dem Film über die Fabrikbesetzung oder bei „Unversöhnliche Erinnerungen“, wesentlich klarer. Bei dem Busch vermischt sich das viel mehr, weil ’s ’ne komplexere Konstellation war: Zum einen waren wir aus dem Westen …
Im Vorgespräch haben Sie gesagt, in der DDR sei man Ihnen mit der Haltung begegnet: „Jetzt kommen die West-Berliner Schnösel und nehmen uns den Ernst Busch weg“. Wer hatte diese Haltung Ihnen gegenüber?
Ich will das jetzt nicht Konrad Wolff in den Mund legen, aber das war schon so ’n bisschen die Haltung der Filmemacher, der kulturell Beflissenen, der politisch Denkenden. In Leipzig (beim Filmfestival, JV) hat man das schon gespürt. (…) Ich war ja oft da, ich hab ja fast jedes Jahr ’nen Film in Leipzig gehabt. Da haben wir natürlich auch über Busch geredet. Da hat man diese Haltung auch hinter den Kulissen mitbekommen. Das ist so meine Wahrnehmung, mein Eindruck von damals. Genau belegen kann ich das jetzt nicht – dafür ist das auch zu lange her. Und dafür war der Film leider auch, das meine ich jetzt gar nicht böse, am Ende doch zu unbedeutend. Hat auch zu wenig bewirkt, hat auch zu wenig Eindruck hinterlassen, weil er nicht so gut ist.
„Ein Film darf nicht nur gut gemeint sein.“
Haben Sie daran die Qualität Ihrer Filme bemessen, dass sie was bewirken?
Ja, ich denke schon. Aber ich glaube, ein Film muss gut sein, um was bewirken zu können. Ein Film darf nicht nur gut gemeint sein. Wenn er nicht gut ist, bewirkt er eben auch nichts. Denn die Leute, die sich damit auseinandersetzen müssen und sollen und wollen, die müssen ja in irgendeiner Form angesprochen werden. Und wenn die Form nicht funktioniert, dann funktioniert die Absicht auch nicht. (…)
Sind Sie auch durch Ihre Ausbildung im Werbefach besonders kompetent in solchen Fragen der Wirkung?
Es ist mir vor allem wichtig, wenn man sozusagen eine Botschaft an den Mann bringen will, dass man sich darüber Gedanken macht, wie das funktionieren kann. Und zwar auch unter Berücksichtigung ethischer Normen – propagandistische oder polemische Darstellungen tun das eher nicht. Dazu gehört eben auch die Frage: Wie weit darf man bei so ’nem General gehen? Und wenn man sich den Film anguckt, kann man sagen, dass ich den sehr fair behandelt habe. Dass ich aber natürlich auch wusste, dass er mir bei der einen oder anderen Frage wahrscheinlich ins Messer laufen würde. Denn ich hatte ja ein bestimmtes Bild von diesen Menschen, ich hab sie ja kennengelernt und zwar reihenweise, diese ganzen Jagdflieger. Und auch in abstoßenden Szenen. Also, junge Offiziersanwärter, die, wenn sie einen zu viel getrunken hatten, auf meine Frage „Warum bist du eigentlich in die Bundeswehr gegangen?“ gesagt haben: „Na, weil wir uns Ostpreußen wieder holen wollen! Eines Tages werden wir wieder ’n Großdeutsches Reich haben!“.
Diese politische Brisanz und Konkretheit haben Sie offenbar bei der Beschäftigung mit Busch, der Ikone der Linken, vermisst. Da ging es auch weniger um Aktualität …
Genau, da war es mehr Ehrfurcht.
Umso reizvoller wäre es gewesen, so jemanden so darzustellen, dass er den Leuten noch was zu sagen hat. Und das ist offenbar nicht gelungen, wenn Sie den Film jetzt so kritisch sehen und sagen, er sei auch nicht gut angekommen.
Ich denke, wenn man den Film unter den damaligen Zusammenhängen sieht, gibt es auch noch eine andere Bedeutung. Ernst Busch wurde ja außerhalb der DDR (…) wenig wahrgenommen. Das hat damit zu tun, dass die Westdeutschen bis zur Wiedervereinigung von den Ostdeutschen eigentlich weniger wussten als umgekehrt. Nun ist der Ernst Busch ’ne Figur der deutschen Kulturgeschichte, wenn man so will, aber einer verdeckten, und in der Bundesrepublik bewusst nicht wahrgenommenen, verschütteten Kulturgeschichte. Insofern war das ein anderes Anliegen, und da hat man gesagt: Wenn uns das gelingt, dass im Zweiten Deutschen Fernsehen so ein Film über so eine Persönlichkeit, die eigentlich bei uns nicht wahrgenommen wird, gezeigt wird, ist das schon ein Fortschritt. Man muss sich nur mal vorstellen, wie damals die Auseinandersetzung lief: Es ging darum, ob man die DDR „DDR“ nennen darf oder ob es die sogenannte DDR ist und so weiter. Das waren Fragen, wo selbst in der SPD Leute gesagt haben: Die DDR muss anerkannt werden, es muss eine andere Form des Umgangs gefunden werden; und auch wenn eines Tages die Wiedervereinigung kommen sollte – aber so wie im Moment der Kalte Krieg das Verhältnis bestimmt, geht es nicht weiter. (…)
War es wirklich so, dass Busch im Westen unbekannt war?
Natürlich, aber sicher! Außer den politisch Bewussten und politisch Engagierten hat den doch keiner gekannt.
Aber es gab doch viele politisch Bewusste und Engagierte in der Zeit.
Ja, ja. Aber Augenblick mal! Wenn man jetzt ins Fernsehen geht, mit wieviel politisch Bewussten hat man es denn da zu tun? Man muss sich das mal vorstellen: Wir sprechen jetzt nicht von Berlin. Wenn ich zurückgegangen bin nach Leverkusen oder nach Köln oder nach Düsseldorf, wo ich die Lehre gemacht hab – ja, Pustekuchen! Da kannte doch kein Mensch Ernst Busch.
Obwohl die Busch-Platten in Dortmund herausgebracht wurden?
Ja, gut, in der Gewerkschaftsbewegung sah es anders aus. Aber das war doch nicht die Reali…, das war doch nicht die …, wie soll ich sagen, die merkbare Wahrnehmung. Das waren absolute Minderheiten.
Pläne hatte immerhin in den Jahren vor Ihrem Film mehrere 10.000 Busch-Platten im Westen verkauft.
Ja, aber entschuldige mal, was sind mehrere 10.000 Stück? (…) Die gesellschaftliche Relevanz ist doch minimal gewesen. Insofern ist es ’ne Gegenkultur gewesen. Und das Fernsehen war -damals gab ’s ja noch kein Privatfernsehen, wobei das für die sowieso nicht interessant gewesen wäre – ’ne quasi staatliche, öffentliche Institution. Wenn da etwas über den Äther gegangen ist, dann hatte das ’ne ganz andere gesellschaftliche Relevanz, als wenn man irgendwo 10.000 Platten an die verkaufte, die sowieso schon von Ernst Busch begeistert waren. Es ist ja nicht so gewesen, dass es einen Markt gegeben hat, wo Leute Gelegenheit hatten, Ernst Busch kennenzulernen. Da gab es halt den erwähnten Laden „Das politische Buch“ am Ernst-Reuter-Platz in der Knesebekstraße – aber da sind ja eh nur die reingegangen, die Bescheid wussten. Das passierte ja auch teilweise mit den Filmen, die wir gemacht haben – dass die nur von bestimmten Leuten angeguckt worden sind in den Verteilungszirkeln.
Gut, aber immerhin wurden diese Pläne-Platten von den Asten in der ganzen Bundesrepublik vor den Unis verkauft …
Klar, es ging auch rein in die Gewerkschaftsbewegung, später vielleicht auch in die Friedensbewegung und so weiter. Trotzdem muss man sagen, dass der Busch kulturell im Westen keine Rolle gespielt hat. Und ich denke, wenn ich mir das jetzt so vergegenwärtige,
dass für uns damals wichtig war, ein gewisses Ziel, nämlich Öffentlichkeit, zu haben – das haben wir auch erreicht. Und damit ist vielleicht auch die Frage beantwortet, wie weit man da geht in der Einordnung und Beurteilung der Figur Busch; auch in der Frage, welche Rolle er spielte, und vielleicht auch in ’ner eigenen Stellungnahme dazu, die implizit höchstens rüberkommt als Bewunderung und Anerkennung. Wir haben gesagt: Es ist schon ’ne ganze Menge erreicht, wenn so ein Mann im westdeutschen Fernsehen einem Millionenpublikum vorgestellt wird.
Wissen Sie noch den Sendetermin?
Ja, ich hab vorhin nachgeguckt. Das war Juli ’79. (…)
Es ist sicher richtig, dass Busch vorher durch die Schallplatten hauptsächlich linken Leuten bekannt war. Aber das war nicht nur auf das Gewerkschafts- und parteimäßig organisierte Leben beschränkt. In Gerd Koenens Buch „Das rote Jahrzehnt“ heißt es zum Beispiel, dass sich die K-Gruppen „an den metallischen Revolutionsgesängen des Ernst Busch berauscht“ hätten … Ich glaube, dass Maoisten, Anarchisten und alle möglichen sich als links begreifende Leute diese Lieder gehört haben.
Ja, klar. Was bei Busch unverdächtig war und darum integrierbar, ob jetzt in die SEW oder in die K-Gruppen, war die Tatsache, dass er unbestritten ’ne Arbeiterfigur war. Wobei er eine parteipolitische Zuordnung nie in den Vordergrund gestellt hat. Er hat nicht ständig gesagt: „Ich bin Kommunist!“, sondern er war Sänger, Arbeitersänger, Künstler. Er hat sich sozusagen in den Dienst einer Sache gestellt, einer guten Sache oder wie auch immer (lacht). Aber er war ja kein vordergründig politischer Agitator aus seinem Selbstverständnis heraus, sondern ist ja darüber hinausgegangen. Insofern war das natürlich auch in den 20er Jahren viel integrierter in größere proletarische Zusammenhänge … Weil Sie vorhin nach Liebesliedern gefragt haben: Die Leute, von denen Sie eben gesprochen haben, die sich an seiner Stimme berauschten (lacht), die kannten mit Sicherheit nur drei, vier Lieder. Die kannten halt „Vorwärts und nicht vergessen“ und „Spaniens Himmel“. Und wenn man weiß, was der Busch alles gemacht hat … (…)
Zum Schluss möchte ich Sie bitten, noch etwas zu den Dreharbeiten bei Busch in Ost-Berlin zu sagen. Wie war das?
Ich weiß noch, dass wir immer über die Bornholmer Straße eingereist sind, immer schön unser Carnet und die ganzen Papiere dabeihatten. Aber so oft waren wir gar nicht bei ihm, glaube ich. Wie oft? Vielleicht sieben-, achtmal. Man musste das entsprechend vorher anmelden: die Tage und dann die Geräte. Das war immer ein ziemlicher Aufwand mit den Papieren. Dann sind wir mit dem VW-Bus der Akademie zur Grenze gefahren, wurden kontrolliert, haben alles vorgezeigt. Ich glaube, das ging sogar mit Unterstützung des ZDF, die hatten auch ’n Büro in Ost-Berlin, das ging über Journalistenvisum. Eigentlich war es gar nicht so wild. Natürlich musste man alle Papiere dahaben, und die Koffer wurden aufgemacht, es wurde geprüft, ob auch die Geräte alle drin sind – man durfte ja keine Geräte dalassen oder andere Dinge mitbringen.
Und dann fuhren Sie nach Hohenschönhausen in die Leonard-Frank-Straße …
Genau.
Wie liefen die Sitzungen? Wie war die Atmosphäre?
(…) (Exkurs über Irene Busch) Es war ein sehr bürgerliches Haus, ’ne alte Villa, könnte man sagen. Das war schon ein bisschen anders, als ich es gewohnt war … – wie hab ich damals gelebt? In ’ner Studentenbude. Das sind so Erinnerungen in meiner Wahrnehmung … ich will nicht sagen, ich hätte mich da nicht wohl gefühlt, das wäre jetzt falsch. Es war ’ne freundliche Atmosphäre. Busch war ’n sehr warmherziger Mensch. Ich war gern in seiner Nähe, das war sehr angenehm, auch wenn er sehr sprunghaft war und auch ’n bisschen launisch. Aber das fand ich spannend.
Waren Sie per Sie?
Ja, ja. Wir waren per Sie … weiß ich gar nicht … ich glaub schon … das ist interessant, das weiß ich nicht mehr … (…) Meistens waren wir im Wohnzimmer, wo der Flügel stand. Viele Bücher hatte er. Man musste auch aufpassen, weil er physisch nicht mehr sehr belastbar war, weil er schon sehr angeschlagen war. Deswegen war das gar nicht so intensiv. (…)
Interview: Jochen Voit
